Eine qualitative Studie zum Heimaufenthaltsgesetz
Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Leopold - Franzens - Universität Innsbruck; eingereicht von Katharina Angerer bei a. o. Univ. Prof. Dr. Volker Schönwiese
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Einleitung
-
2 Zum Heimaufenthaltsgesetz
-
2.1 Das Gesetz
- 2.1.1 Geltungsbereich (§2)
- 2.1.2 Freiheitsbeschränkungen im Sinne des HeimAufG (§3)
- 2.1.3 Einschränkung der persönlichen Freiheit mit Willen der Bewohnerin oder des Bewohners
- 2.1.4 Zulässigkeit einer Freiheitsbeschränkung (§4)
- 2.1.5 Anordnung und Vornahme einer Freiheitsbeschränkung (§5)
- 2.1.6 Dokumentations-, Aufklärungs- und Meldepflichten (§§ 6, 7)
- 2.1.7 Vertretung (§8)
- 2.1.8 Rechte und Pflichten der Bewohnervertretung (§§ 8,9,10)
- 2.1.9 Gerichtliche Überprüfung (§§ 11ff)
- 2.1.10 Länger andauernde Freiheitsbeschränkungen
- 2.2 Die Rolle der Gerichte und die Position der RichterInnen
-
2.1 Das Gesetz
- 3 Paradigmen in der Betrachtung von Behinderung
- 4 Einstellung
- 5 Zur Methode
- 6 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
- 7 Schlussfolgerungen und Diskussion der Ergebnisse
- 8 Schlusswort
- 9 Literaturverzeichnis
- Eidesstattliche Erklärung
- Lebenslauf
Vor meinem Studium lernte ich im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres die Arbeit mit Menschen mit Behinderung kennen. Während dieser Zeit setzte ich mich viel mit der Situation von Menschen mit besonderen Bedürfnissen auseinander. Dort fiel auch die Entscheidung, ein Studium aufzunehmen, in dem ich mich vertieft mit dieser Thematik beschäftigen könnte.
Im Laufe des Studiums der Erziehungswissenschaften, insbesondere natürlich im Studienzweig "Integrative Pädagogik und Psychosoziale Arbeit", bekam ich immer mehr theoretische Inputs zum Thema Behinderung, die ich durch Praktika und Nebentätigkeiten auch in der Praxis erproben konnte. Durch diese Schwerpunktsetzung im Studium und auch in beruflicher Hinsicht war es für mich nahe liegend ein Thema für meine Diplomarbeit zu wählen, das aus dem Themenfeld "Behinderung" stammt.
Frau Mag. Petra Flieger, die sich mit Freiheitsbeschränkungen und dem Heimaufenthaltsgesetz beschäftigt und auch studentische Arbeiten betreut, die Aspekte dieser Thematik behandeln, gab den Anstoß, sich in diesem Zusammenhang mit RichterInnen und deren Bildern von Behinderung befassen. So entstand das Konzept zu dieser Arbeit. Ziel soll es sein, die Perspektive der RichterInnen als AkteurInnen in der Durchsetzung des Heimaufenthaltsgesetzes einzufangen und vor einem theoretischen Hintergrund zu deuten.
Ein großer Dank gilt deshalb an dieser Stelle Frau Mag. Petra Flieger, die mit viel Engagement und ihrer tollen Begleitung einen großen Beitrag zum Gelingen dieser Arbeit geleistet hat. Außerdem möchte ich mich bei Frau Dr. Elisabeth Villotti und Frau Mag. Jasmin Sailer von der Bewohnervertretung Tirol bedanken, die mir als "gate-keeper" den Zugang zum Feld geöffnet haben und mir eine wertvolle Hilfe (nicht nur) in juristischen Fragen waren. Bei meinen InterviewpartnerInnen, die ihre Zeit und ihre Gedanken meiner Forschung zur Verfügung gestellt haben, möchte ich mich hier ebenfalls bedanken.
Ich möchte hier auch meinem Freund Marcus danken, der es verstand, mich immer wieder zu motivieren und neuen Mut zu geben, wenn es nötig war.
Der größte Dank gebührt aber meiner Familie und insbesondere meinen Eltern, die mich in allem stets liebevoll unterstützt und mir dieses Studium ermöglicht haben.
Im Zuge des Heimaufenthaltsgesetzes, das in Österreich seit 2005 in Kraft ist, gab es eine Reihe von Gerichtsverfahren, die sich mit der Einhaltung dieses Gesetzes, das unter anderem die Freiheitsrechte von Menschen mit Behinderung, die in Einrichtungen leben, regelt, befassten. Die RichterInnen, die in diesen Angelegenheiten zu entscheiden haben, werden in ihrer Urteilsbildung auch von ihren Einstellungen zu und ihren Bildern von Behinderung beeinflusst. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie diese Bilder von Behinderung aussehen und in den Einstellungen sichtbar werden.
Der erste Abschnitt bietet einen kurzen Überblick über das Gesetz, um einen Einblick in die Thematik, auf deren Basis diese Arbeit entstand, zu geben.
In einem nächsten Schritt wird der wissenschaftliche Diskurs zu Bildern von Behinderung beleuchtet. Die Vorstellung davon, was Behinderung sei, veränderte sich im Lauf der Zeit. Diese Wandel werden in den wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit Behinderung auseinandersetzen, als Paradigmenwechsel gehandelt. Von einer Vorstellung von Behinderung als Krankheit bis zu einem Denken, das Menschen mit Behinderung zugesteht, gleichberechtigte, mit allen Rechten und Pflichten ausgestattete BürgerInnen zu sein, ist es ein langwieriger Prozess. Inwiefern dieser in den Einstellungen der befragten RichterInnen bereits vollzogen ist, soll in dieser Arbeit geklärt werden.
Dazu wird mithilfe des sozialpsychologischen Einstellungskonstruktes, sowie den damit verwandten Phänomenen Vorurteil, Stereotyp und Stigma versucht, eine Brücke zwischen der Analyse der Theorie zu Paradigmen in der Betrachtung von Behinderung und den empirischen Ergebnissen der Einstellungsforschung zu schlagen.
Den zweiten Teil dieser Arbeit stellt die empirische Untersuchung, in deren Rahmen qualitative Interviews mit RichterInnen an Bezirksgerichten geführt wurden, dar. Nach einer Darstellung und Begründung der gewählten Methode wird die Analyse und Diskussion der Ergebnisse stehen.
Theoretischer Teil
Inhaltsverzeichnis
-
2.1 Das Gesetz
- 2.1.1 Geltungsbereich (§2)
- 2.1.2 Freiheitsbeschränkungen im Sinne des HeimAufG (§3)
- 2.1.3 Einschränkung der persönlichen Freiheit mit Willen der Bewohnerin oder des Bewohners
- 2.1.4 Zulässigkeit einer Freiheitsbeschränkung (§4)
- 2.1.5 Anordnung und Vornahme einer Freiheitsbeschränkung (§5)
- 2.1.6 Dokumentations-, Aufklärungs- und Meldepflichten (§§ 6, 7)
- 2.1.7 Vertretung (§8)
- 2.1.8 Rechte und Pflichten der Bewohnervertretung (§§ 8,9,10)
- 2.1.9 Gerichtliche Überprüfung (§§ 11ff)
- 2.1.10 Länger andauernde Freiheitsbeschränkungen
- 2.2 Die Rolle der Gerichte und die Position der RichterInnen
Das Heimaufenthaltsgesetz (HeimAufG), das seit 1. Juli 2005 in Kraft ist, regelt unter anderem die Durchführung freiheitsbeschränkender Maßnahmen in Einrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder einer geistigen Behinderung. Die Zulässigkeit von Freiheitsbeschränkungen wird durch dieses Gesetz genau geregelt (vgl. Verein für Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft und Bewohnervertretung 2005[1], im Internet). Ziel dieses Gesetzes ist es "für einen besseren Schutz der Persönlichkeitsrechte der Heimbewohnerinnen und zugleich auch für eine - diesbezüglich bisher nicht vorhandene - rechtliche Absicherung des Pflegepersonals." (ebd., im Internet) zu sorgen. Das Gesetz bestimmt außerdem, dass den betreffenden Menschen eine Bewohnervertreterin/ ein Bewohnervertreter zur Seite gestellt wird, die bzw. der ihre Rechte vertritt (vgl. Barth 2005a, im Internet).
Das Heimaufenthaltsgesetz gilt in Alten- und Pflegeheimen, in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung (auch in vollzeitbegleiteten Wohnformen) und "in anderen Einrichtungen, in denen wenigstens drei psychisch kranke oder geistig behinderte Menschen ständig betreut oder gepflegt werden können" (§2 Absatz 1 HeimAufG). Für Menschen mit psychischen Krankheiten oder geistigen Behinderung gilt das Gesetz außerdem in Krankenanstalten (vgl. Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet; Barth 2005a, im Internet).
"Eine Freiheitsbeschränkung im Sinne des Bundesgesetzes liegt dann vor, wenn eine Ortsveränderung einer betreuten oder gepflegten Person (...) gegen oder ohne ihren Willen mit physischen Mitteln, insbesondere durch mechanische, elektronische oder medikamentöse Maßnahmen oder durch deren Androhung unterbunden wird." (§3 Abs. 1 HeimAufG)
Bereits die Androhung von Schritten wird also als eine Beschränkung der persönlichen Freiheit gewertet. Der Verein für Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft und Bewohnervertretung weist in seiner Broschüre zum Heimaufenthaltsgesetz außerdem darauf hin, dass bereits eine Freiheitsbeschränkung vorliegt, wenn die Bewohnerin/der Bewohner in einer bestimmten Situation das Gefühl hat, er oder sie könnte den Ort nicht verlassen (vgl. Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet).
In welchem zeitlichen und räumlichen Umfang sich eine Einschränkung der Mobilität abspielt, ist hier irrelevant (vgl. Barth 2005a, im Internet; Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet). Wird eine Einschränkung von den betreffenden BewohnerInnen bewusst erlaubt, handelt es sich dabei nicht um eine Freiheitsbeschränkung im Sinne des Gesetzes (vgl. Barth 2005a). Beispiele für Freiheitsbeschränkungen im Sinne des Heimaufenthaltsgesetzes wären das Hindern am Verlassen des Bettes durch ein Gitter oder einen Gurt oder das Unterbinden des Bewegungsdrangs durch Medikamente (vgl. Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet). Barth weist außerdem darauf hin, dass als Freiheitsbeschränkung im Sinne des Gesetzes nur eine Maßnahme gesehen werden kann, die an Personen angewendet wird, die die Möglichkeit zu willkürlicher Bewegung haben. Bei bewusstlosen Menschen beispielsweise ist dieses Gesetz nicht gültig (vgl. Barth 2005a, im Internet).
Es wird auch nicht als Freiheitsbeschränkung im Sinne des HeimAufG gewertet, "wenn der einsichts- und urteilsfähige Bewohner einer Unterbindung der Ortsveränderung, insbesondere im Rahmen eines Vertrages über die ärztliche Behandlung, zugestimmt hat." (§3 Abs. 2 HeimAufG) Wichtig ist in diesem Fall, dass sich die Bewohnerin oder der Bewohner im Klaren über die Auswirkungen ihrer oder seiner Entscheidung ist. "Die Einwilligung kann sich (...) nur auf eine konkrete Situation und einen zeitlich überschaubaren Rahmen beziehen." (Barth 2005a, im Internet) Diese Einwilligungen müssen dokumentiert und der Bewohnervertretung sowie der Vertrauensperson gemeldet werden. BewohnerInnen können diese jederzeit widerrufen (vgl. Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet).
Eine Freiheitsbeschränkung ist nur dann zulässig, wenn es sich um Menschen mit einer psychischen oder geistigen Behinderung handelt, die durch ein Verhalten, das auf ihre Beeinträchtigung zurück geführt wird, die Gesundheit und das Leben anderer oder sich selbst gefährden. Eine weitere Voraussetzung stellt die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme dar. Es muss außerdem sichergestellt sein, dass "diese Gefahr nicht durch andere Maßnahmen, insbesondere schonendere Betreuungs- und Pflegemaßnahmen, abgewendet werden kann" (§4 Abs. 3 HeimAufG). In einem Präzedenzfall, der am Obersten Gerichtshof geschaffen wurde, wird Personalmangel als Rechtfertigung für freiheitsbeschränkende Maßnahmen ausgeschlossen (vgl. Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet).
Eine Freiheitsbeschränkung muss grundsätzlich von einem Arzt oder einer Ärztin angeordnet werden. Handelt es sich um Maßnahmen, die kürzer als 24 Stunden bzw. einmalig durchgeführt werden, dürfen auch die Pflegedienstleitung, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen oder die pädagogische Leitung eine Beschränkung anordnen (vgl. ebd.). Barth (2005a, im Internet) weist darauf hin, dass auch hier ein Arzt oder eine Ärztin herangezogen werden kann. Medikamentöse Beschränkungen müssen in jedem Fall von Ärztinnen angeordnet und auch gemeldet werden. Die angeordnete freiheitsbeschränkende Maßnahme "muss unter Einhaltung fachgemäßer Standards und unter möglichster Schonung der Bewohnerin durchgeführt werden. Die Freiheitsbeschränkung muss umgehend beendet werden, wenn die Vorraussetzungen nicht mehr vorliegen." (Verein für Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft und Bewohnervertretung 2005, im Internet)
Der Grund, die Art, der Beginn und die Dauer einer Freiheitsbeschränkung müssen schriftlich genau dokumentiert und die Bewohnerin oder der Bewohner darüber aufgeklärt werden. Diese Aufklärung hat auf eine der/dem Betroffenen angepasste Weise zu erfolgen. Die Einrichtungsleitung muss informiert werden und deren Aufgabe ist es nun, die Vertreterin oder den Vertreter und eine Vertrauensperson der Bewohnerin oder des Bewohners zu verständigen und ihnen die Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äußern (vgl. Barth 2005a, im Internet).
BewohnerInnen haben das Recht, sich selbst eine Vertretung zu suchen, beispielsweise eine Rechtsanwältin oder Angehörige, um für sie zu sprechen. Unabhängig davon wird der Bewohnerin oder dem Bewohner eine gesetzliche Vertretung zur Seite gestellt. Diese Aufgabe übernimmt der zuständige Verein für Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft und Bewohnervertretung (vgl. Barth 2005b, im Internet). BewohnervertreterInnen werden bei diesem Verein angestellt und beim zuständigen Bezirksgericht und den betreffenden Institutionen namentlich bekannt gemacht (vgl. Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet).
Die Bewohnervertretung wird über alle Be- und Einschränkungen der Freiheit in den in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Einrichtungen informiert. "Ihre Aufgabe ist es, die Angemessenheit der Freiheitsbeschränkung zu hinterfragen. Sie wird versuchen, bei manchen Fällen möglichst zeitnah mehr Informationen zu erhalten." (Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet) Die Bewohnervertretung muss also die Institutionen besuchen und sich einen Überblick über die Situation verschaffen, um zu entscheiden, ob eine Überprüfung durch das Gericht notwendig ist. Die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Freiheitsbeschränkung müssen überprüft werden. Gespräche mit allen beteiligten AkteurInnen sowie eine Einsicht in die Akten und Dokumentationen der Institution gehören ebenfalls zu den Rechten von BewohnervertreterInnen (vgl. Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet). Sie sind dazu verpflichtet, die BewohnerInnen "über beabsichtigte Vertretungshandlungen und sonstige wichtige Angelegenheiten zu informieren" (Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet), sie zu vertreten und ihren Wünschen so weit wie möglich zu entsprechen. Außerdem ist es die Pflicht von BewohnervertreterInnen, die Strukturen der jeweiligen Einrichtung zu berücksichtigen und relevante Informationen an die zuständigen Behörden weiterzuleiten. BewohnervertreterInnen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet (vgl. Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet; Barth 2005b, im Internet).
Das Bezirksgericht ist für die Überprüfungsverfahren im jeweiligen Sprengel zuständig. Es schreitet ein, wenn vonseiten der Bewohnerin/des Bewohners, einer Vertrauensperson, der Bewohnervertretung oder der Heimleitung bzw. einer anordnungsbefugten Person ein Antrag auf Überprüfung eingebracht wird. Dieser muss keine bestimmte Form aufweisen und kann auch mündlich erfolgen (vgl. Barth 2005b, im Internet).
Innerhalb von sieben Tagen muss nun eine erste gerichtliche Anhörung der Bewohnerin/des Bewohners in der Institution stattfinden. In dieser verschafft sich das Gericht einen Überblick über die Situation in der Einrichtung, hört die beteiligten Personen (BewohnerInnen, deren VertreterInnen, die/den Anordnungsbefugte/n, Pflegepersonal...) an und nimmt Einsicht in die relevanten Aufzeichnungen. Zusätzlich können noch unabhängige Sachverständige hinzugezogen werden (vgl. Barth 2005a, im Internet). Am Ende der Anhörung steht eine sofortige Entscheidung, ob die Freiheitsbeschränkung zulässig ist. Wird eine Maßnahme vom Gericht vorläufig für zulässig erklärt, muss binnen 14 Tagen eine Mündliche Verhandlung angesetzt werden (vgl. §13 Abs. 1 HeimAufG). Befindet das Gericht die Freiheitsbeschränkung für unzulässig, muss diese sofort aufgehoben werden (vgl. §13 Abs. 2 HeimAufG).
Bei der Mündlichen Verhandlung muss nun eine Sachverständige oder ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Außerdem müssen die Bewohnerin oder der Bewohner, die Vertrauensperson, die Bewohnervertretung, die anordnungsbefugte Person sowie die Einrichtungsleitung und fallweise weitere Auskunftspersonen geladen werden (vgl. Barth 2005a, im Internet). Das HeimAufG schreibt fest, dass die Einrichtungsleitung dafür Sorge zu tragen hat, dass die Bewohnerin oder der Bewohner an der Verhandlung auch teilnehmen kann.
"Das Gericht und die anderen an der Verhandlung Beteiligten haben darauf zu achten, dass die Verhandlung unter möglichster Schonung des Bewohners durchgeführt wird und von anderen Bewohnern tunlichst nicht wahrgenommen werden kann." (§14 Abs. 2 HeimAufG)
Der Verweis auf die Schonung der Bewohnerin oder des Bewohners erscheint mir äußerst wichtig, da deren oder dessen Wohl ja im Mittelpunkt des Verfahrens stehen soll. Die Vermeidung der Teilnahme anderer BewohnerInnen an diesem Prozess allerdings erscheint mir fraglich. Möglicherweise ist diese ebenfalls im Kontext der Schonung von BewohnerInnen zu sehen.
Das Gericht entscheidet in dieser Verhandlung über die Zulässigkeit, Art und Weise und Dauer der Beschränkung. Die Maßnahme kann in diesem Beschluss für maximal 6 Monate für zulässig erklärt werden. Ist das nicht der Fall, muss sie sofort aufgehoben werden (vgl. §15 Abs. 2f HeimAufG). Es besteht auch die Möglichkeit gegen diesen Beschluss Rekurs zu erheben. Die Freiheitsbeschränkung muss auch aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen für deren Durchführung wegfallen oder "die vom Gericht festgelegte Frist abgelaufen ist" (Verein für Sachwalterschaft 2005, im Internet).
Bei Freiheitsbeschränkungen, die wahrscheinlich nach der gesetzlich festgelegten Frist nicht aufgehoben werden, muss erneut die Bewohnervertretung eingeschaltet werden. Diese kann wieder einen Antrag auf Überprüfung stellen oder unter Angabe von Gründen darauf verzichten. Wird nochmals ein Überprüfungsverfahren durchgeführt, kann das Gericht nun eine Dauer der Beschränkung von bis zu einem Jahr festsetzen (vgl. §19 Abs. 1ff HeimAufG).
Immer wieder wird im Gesetz auch darauf hingewiesen, alle Informationen der Bewohnerin oder dem Bewohner "in geeigneter, seinem Zustand entsprechender Weise" (z.B. §15 Abs. 1 HeimAufG) zu vermitteln. Es wird also darauf Wert gelegt, den Menschen mit Lernschwierigkeiten oder einer psychischen Erkrankung als Subjekt zu behandeln. Durch diese Formulierung wird vom Gesetzgeber eine Auseinandersetzung mit der Person gefordert, die auf seine oder ihre speziellen Bedürfnisse eingeht.
Im Endbericht des Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie zur Implementation des Heimaufenthaltsgesetzes (Hofinger et al. 2007) wurden die Position der RichterInnen und die Rolle der Gerichte in diesen Verfahren untersucht. Es wird darauf hingewiesen, dass viele der RichterInnen bereits Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung hatten, allerdings im Kontext von Sachwalterschafts- und Unterbringungsgesetz. In diesen Fällen allerdings werden die Menschen mit Behinderung aus einer ganz anderen Perspektive gesehen:
"Wenn sie (die RichterInnen; Anm.) dann mit der gleichen Person im Rahmen eines Verfahrens nach HeimAufG konfrontiert sind, in dem es um die Rechtmäßigkeit von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen geht, haben sie die Aufgabe, die Person gleichsam unter umgekehrten Vorzeichen zu betrachten." (Hofinger et al. 2007, S. 90)
Während in Angelegenheiten, die eine Sachwalterschaft betreffen, in erster Linie eine defizitäre Sichtweise auf die Lebenssituation des betreffenden Menschen mit Behinderung angewandt wird, muss es im Rahmen des HeimAufG eine Perspektive sein, die mehr auf die Persönlichkeitsrechte der Person ausgerichtet ist. Ebendiese Sichtweise der RichterInnen im Zusammenhang mit dem HeimAufG soll in dieser Arbeit beleuchtet werden.
Vonseiten der RichterInnen, die im Rahmen dieser Implementierungsstudie befragt wurden, war zu hören, dass zur Rolle einer Richterin oder eines Richters nicht nur die Vermittlung zwischen den einzelnen Parteien gehört, sondern auch ein Handhaben der oft aufgeheizten Stimmung. Es wird als Schwierigkeit beschrieben, die Differenzen zwischen den einzelnen Positionen zu überbrücken (vgl. ebd., S. 91). Wie die AutorInnen dieser Studie feststellen, handelt es sich bei den Verfahren zum HeimAufG um Gutachterprozesse. Die RichterInnen sind mit ihrem Wissen nicht in der Lage, zu beurteilen, ob etwa eine psychische Erkrankung vorliegt. Ein Gutachten, das von ExpertInnen erstellt wird, dient der Urteilsfindung. "Zwar wird öfters darauf hingewiesen, dass man im Laufe der Zeit doch ein gewisses Verständnis auch für psychiatrische, geriatrische und pflegewissenschaftliche Fragen entwickle, letztlich aber ist man auf das Urteil der Gutachter angewiesen." (ebd., S. 92) Besonders im Falle von medikamentösen Freiheitsbeschränkungen müssen sich RichterInnen auf die Kompetenz ihrer GutachterInnen verlassen. Auch dieses sich mit der Zeit entwickelnde Verständnis für die Lebensumstände von Menschen mit Behinderung soll in den Interviews mit den RichterInnen zur Sprache gebracht werden.
[1] Verein für Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft und Bewohnervertretung wird künftig mit ‚Verein für Sachwalterschaft' abgekürzt.
Inhaltsverzeichnis
Im folgenden Kapitel soll es um verschiedene theoretische Konzeptionen zu Behinderung gehen. Um einen Zugang zu den impliziten Menschenbildern zu bekommen, werden diese Konzepte erörtert. Auch die Auseinandersetzung um die Paradigmen in der Behindertenhilfe ist in diesem Lichte zu sehen.
In der Beschäftigung mit dem Phänomen Behinderung gab es in den letzten Jahren und Jahrzehnten einige Kontroversen. Was verstehen wir nun eigentlich unter Behinderung? Wie lässt sich dieses Phänomen erfassen? Dazu gibt es vielfältige theoretische Herangehensweisen. Allerdings lässt sich der aktuelle Diskurs zu Behinderung, laut Schillmeier (2007, S. 79) als von zwei Modellen geprägt begreifen: Einerseits einem medizinischen, das einen körperlichen oder geistigen Defekt, der der einzelnen Person eigen ist, als Behinderung beschreibt und andererseits einem sozialen Modell, das Behinderung als ein gesellschaftlich entstandenes Phänomen, als soziale Kategorie begreift. Andere AutorInnen (z.B. Cloerkes 2007, S. 10) gehen von vier konkurrierenden Paradigmata in der Betrachtung von Behinderung aus: einem personorientierten, einem interaktionistischen, einem systemtheoretischen und einem gesellschaftstheoretischen Modell. Allerdings weisen die letzteren drei eine Gemeinsamkeit auf: sie beziehen sich alle auf Behinderung als soziale Kategorie. Deshalb wird auch hier diese Dichotomie von individuenzentrierten und sozialen Modellen beibehalten.
Behinderung wird in der klassischen Heil- und Sonderpädagogik, die ihre Anfänge am Beginn des 19. Jahrhunderts hat, als medizinischer Sachverhalt behandelt. Normalität wird durch die Kategorien Gesundheit und Funktionsfähigkeit definiert, während Abweichungen als Krankheit und als ‚behindert' eingestuft werden (vgl. Schönwiese 2002, S.183). Mittels ausgefeilter Diagnoseverfahren werden Behinderungen und Menschen mit Behinderungen kategorisiert und schematisiert. Wie Eggert (2000, S.41) zeigt, ist die Klassifikation von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung eine Praxis, die bereits im 18. und 19. Jahrhundert weit verbreitet war. Unter dem wissenschaftlichen Begriff der Oligophrenie wurden Menschen mit Lernschwierigkeiten als ‚schwachsinnig' oder ‚blödsinnig' eingestuft. Durch die langjährige Zuständigkeit der Psychiatrie für Menschen mit so genannter geistiger Behinderung entwickelte sich ein Schema der Klassifizierung von geistigen Behinderungen im Rahmen der psychiatrischen Diagnostik. In Anlehnung an Michel Foucault werden von Elbert (1982, im Internet) vier Operationsschritte, die ein ‚behindertes Selbst' produzieren, unterschieden:
In der Selektion werden Merkmale zu Symptomen erklärt und als abweichend von der Norm definiert. Der zweite Schritt, die Ätiologie, ist mit der "Suche nach den ‚wahren' Ursachen" (Schönwiese 2002, S. 184) beschäftigt. In der Diagnose werden die beobachteten Symptome und die gefunden Ursachen gemäß einem Puzzlespiel einem der bekannten Krankheitsbilder zugeordnet (vgl. Elbert 1982, im Internet). Mithilfe dieser Diagnose, die von nun an einen festen Bestandteil der Person darstellt, kann dann eine Prognose über zukünftige Verhaltensweisen, Möglichkeiten und Therapiechancen abgegeben werden (vgl. ebd.).
ÄrztInnen ordnen so einen Menschen einem bestimmten Krankheitsbild zu, das von nun an Teil seines oder ihres Lebens sein wird. Das entscheidende Moment ist hier, wie Elbert anführt, die Existenz von "totalen Bildern" vom Menschen, geistiger Behinderung oder auch Abweichung in diesem medizinischen Modell, die auf einzelne Menschen angewandt werden, ohne deren Individualität zu berücksichtigen (vgl. ebd.).
Eine Behinderung kann aus dieser Perspektive also als ein Bündel von Symptomen gesehen werden, dessen Grund in einer organischen Schädigung liegt. In diesem medizinischen Modell von Behinderung wird eine Kausalität zwischen dem Defekt und der sozialen Benachteiligung angenommen. Jede Problematik oder Schwierigkeit im sozialen Leben von Menschen mit so genannter geistiger Behinderung kann auf das Defizit zurückgeführt werden. In der WHO-Definition von Behinderung aus dem Jahr 1980 wird die Entstehung von Behinderung als kausale Abfolge von einer Gesundheitsschädigung über eine Funktionseinschränkung bis zur sozialen Benachteiligung erklärt (vgl. Lindemann/Vossler 1999, S. 105). Allerdings findet in dieser Definition bereits eine soziale Komponente eine Erwähnung, weshalb diese von einigen AutorInnen, zum Beispiel Feyerer (2003, im Internet) oder Hollenweger (2006, S. 50), bereits als Abkehr von einem rein medizinischen Modell von Behinderung gewertet wird. Die soziale Benachteiligung wird aber nur als Folgeerscheinung der körperlichen Schädigung gesehen, was eine Wirkung anderer Faktoren auf die Entstehung von Behinderung negiert.
In einer solchen Sichtweise wird Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung jede Eigenaktivität zur Gestaltung ihres Lebens abgesprochen, außerdem finden keinerlei Einflüsse Erwähnung, die nicht in der Person selbst liegen. Behinderung wird in diesem Sinne als objektivierbare und rein individuelle Kategorie begriffen:
"Das besondere Verhalten eines Menschen wird damit als individuelle ‚pathologische' Eigenschaft zur persönlichen Schuld; seine unverstandenen Äußerungen sind ‚unsinnige' Verhaltensantworten eines irrenden Gehirns. Von Interesse ist primär der Defekt und die Verfahren zur Behebung einer vermuteten Schädigung." (Mattner/Gerspach 1999, S.21)
Hier wird deutlich, dass eine unter diesem Paradigma agierende Pädagogik ihr Augenmerk auf den Defekt legt. Alle Äußerungen eines Menschen können auf ebendiesen Mangel zurück geführt werden. Als Ziele werden die Behebung des Defekts und eine Anpassung an eine Normalität des Durchschnittsmenschen gesehen. Durch Therapien und spezielle Fördermaßnahmen sollen Abweichungen von der Normalität aus der Welt geschaffen werden. SpezialistInnen wissen, was zu tun ist. "Der Betroffene selbst wird dabei zum inkompetenten Objekt erklärt und auch so behandelt." (Feyerer 2003, im Internet) Lindemann und Vossler sprechen von einem "geteilten Menschenbild" zwischen Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung und den Professionellen in diesem Bereich:
"Während man sich selbst als eigenständig handelndes Subjekt begreift, erscheint das pädagogische Gegenüber als jemand, der sich nur aufgrund seiner Störungen und Mängel verhält und dessen Defizite ausgeglichen werden müssen." (Lindemann/Vossler 1999, S.115)
Mattner und Gerspach (1999) beschreiben am Beispiel der Frühförderung die Konzentration auf einen Mangel und die Auswirkungen der Forcierung von Therapien desselben:
"Das Normale im/am Kind bzw. dessen Entwicklungsprozess wird infolgedessen als irrelevant, das Störende hingegen als das Allumfassende, ja Determinierende für die Entwicklung des Kindes erklärt." (Wöhler 1987, zit. nach Mattner/Gerspach 1999, S. 20)
Durch diese "Mängelzentrierung" wird ein Defekt zur zentralen Eigenschaft eines Menschen. Alle anderen Eigenschaften, die einen Menschen ausmachen, werden ausgeblendet und treten in den Hintergrund. Behinderung wird als statischer, unveränderbarer Zustand gefasst. Wie ebenfalls aus dem obengenannten Zitat, das Mattner und Gerspach anführen, hervorgeht, werden in diesem Konzept Entwicklungsprozesse negiert. In diesem Menschenbild werden die Entwicklungschancen eines Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung als von vornherein beschränkt und durch den hirnorganischen Mangel determiniert gesehen.
Theunissen (1982, S. 150, zit. nach Hähner 1999b) spricht im Zusammenhang mit der Unterbringung von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung in Psychiatrien, wie sie noch bis in die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts verbreitet war, von einem "biologistisch-nihilistischem" Menschenbild. ‚Nihilistisch' bezieht sich in diesem Fall auf die eben angesprochene Verneinung von Entwicklungsprozessen: Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung wird so die Fähigkeit zu lernen, sich zu bilden und "ein normales menschliches Leben zu durchlaufen und sich selbst zu verwirklichen" (Hähner 1999b, S. 26), abgesprochen. Aufgrund dieser Prämisse wurden die PatientInnen, zu denen sie durch die Diagnose der Schädigung wurden, ihr ganzes Leben lang in Anstalten ‚verwahrt' und pflegerisch behandelt.
Wie Schönwiese (2002, S. 186f) konstatiert, wird in neueren Veröffentlichungen vermehrt versucht, die medizinische Sichtweise auf Menschen mit Behinderung zu erweitern. Dabei meint ‚Heilpädagogik' nicht mehr das Heilen einer Krankheit, sondern vielmehr eine Verganzheitlichung des bis dahin als unvollständig betrachteten Lebens von Menschen mit Behinderung (vgl. Kobi 1993, S.127). In diesem Sinne wird Behinderung zwar nicht mehr nur als organischer Defekt gesehen, bleibt aber immer noch ein individuelles Problem, das durch Expertenwissen und dementsprechende Behandlung in den Griff zu bekommen sei. Menschen mit Behinderung brauchen Hilfe von außen zu ihrer Vervollkommnung. Norm und Abweichung bleiben bestimmende Kategorien.
Eine weitere scheinbare Fortentwicklung des medizinischen Modells von Behinderung wird von Elbert (1986, S. im Internet) diskutiert. Er zieht den Ansatz Thalhammers (1974, nach Elbert 1986) zur Erklärung von so genannter geistiger Behinderung heran, der den Anspruch erhebt, eine Pädagogik zu entwerfen, die Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung gerecht werde. Die Ursache für die Behinderung liegt bei Thalhammer in einer organischen Schädigung, die zu kommunikativen Defiziten führt. Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung wird hier eine Andersartigkeit in ihrem Wesen unterstellt, die sie in lebenslange Abhängigkeit von Hilfe bringt (vgl. Elbert 1986, im Internet).
Eine Perspektive, die davon ausgeht, dass gewisse Menschen in ihrer Natur anders beschaffen seien, legitimiert Sonderbehandlungen, Aussonderung und Ausgrenzung. Deshalb kann hier nicht von einer Pädagogik die Rede sein, die den Menschen gerecht wird. Menschen werden nach wie vor, auch unter einem heilpädagogischen Paradigma, als Mängelwesen betrachtet, denen von Professionellen geholfen werden muss. Die ExpertInnen sind in diesem Fall jedoch nicht mehr Ärzte und Ärztinnen, sondern Heil- und Sonderpädagogen und -pädgoginnen, die über das ‚Wesen' von Menschen mit Behinderung Bescheid wissen.
Von einigen AutorInnen wird an dieser Stelle ein Paradigmenwechsel in der Betrachtung von Behinderung gesehen. Hähner (1999b, S. 30) geht von einem Wandel im Menschenbild ab den 1970ern aus. Er spricht von einer Ablösung des ‚biologistisch-nihilistischen' Menschenbildes durch ein ‚pädagogisch-optimistisches'. Verwahrung als handlungsleitendes Prinzip in der Behindertenhilfe wird vom Anspruch nach Förderung verdrängt. Das Primat der Medizin weicht einer Vorherrschaft der Pädagogik (vgl. Hähner 1999b, S. 30). Hohmeier (2004, S. 132) spricht von zwei Paradigmenwechseln in der Behindertenarbeit in den letzten 50 Jahren. Dem ‚kustodialen' Paradigma, das dem oben erläuterten medizinischen Modell entspricht, folgt ein ‚therapeutisch-rehabilitatives' Paradigma:
"Das dem neuen Paradigma zugrunde liegende Bild vom Menschen hat sich geändert: Im Blick sind zugleich die mit der Behinderung gegebenen individuellen Einschränkungen und der entsprechend auf die behinderungsbedingten Beeinträchtigungen und ‚handicaps' bezogene vielfältige Bedarf an therapeutischen und pädagogischen Hilfen." (Hohmeier 2004, S. 133)
Auch hier lässt sich der Fokus auf die Defizite und deren Behandlung erkennen. Außerdem wird eine besondere Angewiesenheit von Menschen mit Behinderung, ähnlich wie bei Thalhammer, angenommen. Deshalb kann hier in meinen Augen nicht von einem grundlegenden Umdenken im Bild von Behinderung ausgegangen werden, da es sich aus dieser Perspektive immer noch um ‚unvollkommene', von der gewünschten Normalität abweichende Wesen handelt. Bosse (2006, S. 50) spricht ebenso von einem neuen Leitbild in der Behindertenhilfe, das sich Normalisierung und Förderung zum Ziel setzt. Einer Verschiebung des Fokus von bloßer Verwahrung hin zu gezielter Förderung wird hier durchaus auch Positives abgewonnen, nämlich ein Blick auf die individuellen Probleme von Menschen mit Behinderung, wie er im alten Paradigma der ‚Versorgung und Fürsorglichkeit', wie Bosse es nennt, keinen Platz hatte. Deshalb sieht er diese Entwicklung, auch wenn die Orientierung am Defekt nach wie vor stark im Zentrum steht, als neues Paradigma der ‚Normalisierung und Förderung' (vgl. ebd., S. 50ff).
Feuser (1996, im Internet) spricht von der Heil- und Sonderpädagogik als Herrschaftspädagogik, weil sie Nichtbehinderten ein Zuschreibungsrecht einräumt, das sie dazu befugt, zu klassifizieren und auszusondern und diese Praktiken anschließend als "behinderungsspezifische Maßnahmen" (ebd.) bezeichnet. Im heilpädagogischen Paradigma bleiben Menschen mit Behinderung Objekte von Klassifikation und Segregation, die wenig Spielraum haben, sich den Zuschreibungsmächten zu entziehen.
In diesem Sinne kann ein Umdenken in Richtung einer Heil- und Sonderpädagogik, das den Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung zwar einräumt nicht krank zu sein und deshalb nicht ins Krankenhaus zu gehören, aber ein Leben in Spezialeinrichtungen fern ab vom gesellschaftlichen Leben für angebracht hält, nur bedingt für eine Verbesserung der Situation von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung sorgen. Das Medizinische Modell wird unter einem heilpädagogischen Paradigma zwar erweitert und adaptiert, aber nicht gänzlich verworfen oder überwunden.
Dem weiteren Paradigmenwechsel, der laut Hohmeier in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts stattfand, wird hier deshalb mehr Bedeutung beigemessen. Das neue, inklusive Paradigma, wird dabei als auf folgendem Menschenbild basierend beschrieben:
"Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen werden nicht mehr als Objekte von Maßnahmen aufgefasst, sondern als die eigenen Bedürfnisse aktiv formulierende Subjekte, die ihren Lebensraum trotz und mit Behinderung selbst gestalten und ihre eigenen Perspektiven in die Interaktion mit der Umwelt einbringen." (Hohmeier 2004, S. 136)
Ein wichtiges Moment in einem neuen Denken über Menschen mit Behinderung wird hier bereits deutlich. Vom Objekt von Behandlungen und Therapie werden Menschen mit Behinderung zu aktiven Gestaltenden. Dieser Wandel zu einem neuen Bild von Menschen mit Behinderung wurde besonders von Selbstvertretungsgruppen forciert. ‚Krüppelbewegungen' von Menschen mit körperlichen Behinderungen sowie die ‚People-First-Bewegung' von Menschen mit so genannter geistiger Behinderung fordern ab den 80ern eine neue Sichtweise hin zu Selbstbestimmung, Emanzipation und Gleichberechtigung (vgl. Schönwiese 2009, im Internet; Bosse 2006, S. 53). Erstmals sind die AkteurInnen einer Veränderung im Diskurs um Behinderung die Betroffenen selbst.
Eggert (2000, S. 57ff) macht den Paradigmenwechsel im Bild von Behinderung an drei Momenten fest. Als wichtigsten strukturellen Übergang beschreibt er einen Wandel von der Konstanz- zur Veränderungsannahme. Damit meint er "die Überwindung der Vorstellung, dass geistige Behinderung ein letztlich unveränderbarer Defekt sei, der die Lebenschancen eines Individuums festlegt." (Eggert 2000, S. 57) Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung wird so die Fähigkeit zugesprochen, sich zu entwickeln und das ohne eine spezifische vorhersagbare Beschränkung durch ihre Behinderung. Eine Prognose für Entwicklungschancen auf Basis der Schädigung ist vor diesem Hintergrund nicht mehr möglich (vgl. ebd., S. 58). Als weiteren wichtigen Übergang beschreibt Eggert eine Veränderung von der Segregation hin zur Integration. Die Deinstitutionalisierung - die Auflösung von Großanstalten - und die Entstehung neuer Wohnformen für Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung als ein großer Schritt in Richtung Normalisierung gilt hier ebenso als Meilenstein wie der gemeinsame Unterricht aller Kinder (vgl. ebd., S. 59f). Ein Wechsel von der Typologie und Klassifikation zur Individualisierung wird von Eggert in der ‚neuen Behindertenpädagogik' ebenfalls ausgemacht. Eine Abkehr von einer Diagnostik, die Persönlichkeitsmerkmale, Intelligenz usw. testet und an einem gesellschaftlichen Durchschnittswert misst, ermöglicht eine Sicht auf die individuellen Fähigkeiten eines Menschen (vgl. ebd.). In diesem Zusammenhang bringt Hähner eine weitere Dimension des Übergangs ein. Auf Basis eines humanistischen Menschenbildes wird Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung nun ein Recht auf Autonomie anstatt lebenslanger Abhängigkeit zugestanden (vgl. Hähner 1999a, S. 122). Dadurch werden Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung dazu befähigt, eigene Entscheidungen zu treffen und als ExpertInnen in eigener Sache zu fungieren.
Die Konsequenz aus diesen Veränderungen wird bei Eggert wie folgt beschrieben:
"Bei diesen Überlegungen werden zunehmend Denkmodelle des klassischen Medizinischen Modells verlassen wie etwa: - der Krankheitsbegriff als Ursache einer Behinderung (Gleichsetzung von Schädigung und Behinderung), - der Gedanke des hohen Stellenwerts von Diagnose und Therapie in einem kausalen Gebäude (Ursache-Wirkungsdenken) und das Bedürfnis zur Klassifikation." (Eggert 2000, S. 62)
Relikte eines medizinischen und heilpädagogischen Modells von Behinderung lassen sich in der Behindertenhilfe noch zahlreich ausmachen. Sieht man sich die Strukturen von Einrichtungen für Menschen von Behinderung an, scheint ein Paradigmenwechsel, wie er hier beschrieben wird, noch längst nicht vollständig vollzogen. Inwiefern diese alten Denkschemata im Kontext der Gerichtsverfahren zum Heimaufenthaltsgesetz noch wirksam sind, wird zu zeigen sein.
In sozialen Modellen von Behinderung, die in den letzten 20 Jahren immer mehr Verbreitung im wissenschaftlichen Diskurs fanden und als Basis der Disability Studies fungieren, wird eine Abkehr von der Vorstellung von Behinderung als einer rein individuellen Kategorie gefordert. Sehr plakativ kann die Leitidee hier mit "Behindert ist man nicht, behindert wird man" (Dannenbeck 2007, S.105) zusammengefasst werden. Hier wird bereits deutlich, dass Behinderung nun nicht mehr als statischer Zustand eines Menschen betrachtet wird. Vielmehr steht nun ein Prozess des Behindert-Werdens im Vordergrund. Die Abkehr von der Betrachtung von Behinderung als individuelle Kategorie mündet schließlich in Feusers provokantem Leitspruch "Geistigbehinderte gibt es nicht" (Feuser 1996, im Internet).
Schillmeier gibt folgende Erklärung für das soziale Modell von Behinderung, in dem er es vom medizinischen Modell abgrenzt:
"Das soziale Modell hingegen stellt Behinderung weniger als Effekt individueller, körperlicher Schädigung dar, sondern als ein gesellschaftlich hergestelltes Phänomen. Behinderung wird als soziales Konstrukt, als soziokulturelle Praxis und Konsequenz gesellschaftlicher Unterdrückungs- und Machtverhältnisse beschrieben." (Schillmeier 2007, S. 79)
Behinderung wird nun also nicht mehr nur als von einem Menschen abhängig, sondern als soziales Ereignis gesehen. Thomas beispielsweise definiert Behinderung "als eine Form sozialer Unterdrückung" (Thomas 2004, S. 35). In diesem Sinne geht es um eine Benachteiligung und eine Beschneidung von Aktivität als eine Folge von sozialen Beziehungen und nicht als direkte Konsequenz eines Defekts (vgl. ebd.).
Die Herstellung von Behinderung im sozialen Leben wird von Cloerkes beschrieben. In der Tradition des Symbolischen Interaktionismus, dessen Prämisse besagt, dass alle Dinge mit Bedeutungen belegt sind, die in sozialen Interaktionen entstehen, und Menschen aufgrund dieser Bedeutungen handeln, (vgl. Huinink 2005, S. 187f) behandelt er Behinderung als ein relatives Merkmal. Die soziale Reaktion auf einen Menschen, der eine Bewertung zugrunde liegt, ist entscheidend, ob jemand als ‚behindert' gilt oder nicht (vgl. Cloerkes 2007, S. 8). Kultur- und kontextspezifische Unterschiede in der Bewertung von Behinderung machen eine objektive oder globale Definition von Behinderung unmöglich.
"Der Status des Behindert-Seins nach Cloerkes ist also nur eine mögliche Folge einer Behinderung, und zwar eine negative Folge, welche die Entwicklungs- und Partizipationschancen eines Menschen mit einer Behinderung einschränkt." (Felkendorff 2003, S.44)
Felkendorff macht hier ebenfalls darauf aufmerksam, dass eine Kausalität zwischen Schädigung und sozialer Benachteiligung nicht besteht, sehr wohl aber eine zwischen der sozialen Interaktion und beschränkten Möglichkeiten der Teilhabe.
Schönwiese (2005) geht ebenfalls auf die Entstehung des heutigen Verständnisses von Behinderung ein. Er beschreibt diese Prozesse als individuelle und gesellschaftliche Konstruktionen und Rekonstruktionen.
"Träger und Vermittler dieser Re-Konstruktionen sind
-
historisch entstandene Bilder
-
durch Wissenschaft geschaffene systematische Bilder
-
in der individuellen Sozialisation vermittelte Bilder und
-
über die Medien produzierte beziehungsweise verstärkte Bilder von Behinderung." (Schönwiese 2005, im Internet)
Die Grundlage dieser Analyse der alltäglichen Konstruktion von Behinderung wurde von Gstettner (1982, im Internet) erarbeitet. Er geht davon aus, dass ein Alltagswissen von Behinderung die Einstellungen und das Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderung bestimmt. In der folgenden schematischen Darstellung werden die Einflussgrößen auf dieses Alltagsbewusstsein offen gelegt.
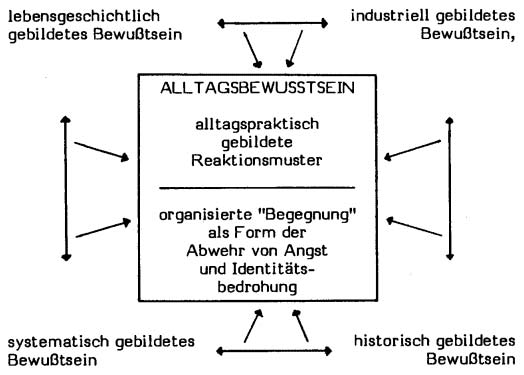
Abbildung 1: Einflussgrößen auf das Alltagsbewusstsein von Behinderung nach Gstettner (1982, im Internet)
Das Zentrum dieses Schemas bilden die ‚alltagspraktisch gebildeten Reaktionsmuster', die das Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderung strukturieren. Diese ritualisierten Verhaltensformen dienen als Schutz der eigenen Identität und vor Unsicherheit und Angst. Das ‚lebensgeschichtlich gebildete Bewusstsein' bezieht sich auf die Erfahrungen, die Menschen im Lauf ihres Lebens machen. In ihrer Sozialisation wird das Gewissen entwickelt, das in weiterer Folge für einen oft von Schuldgefühlen belasteten Kontakt mit Menschen mit Behinderung verantwortlich ist. Gstettner hofft auf eine positive Veränderung in diesem lebensgeschichtlichen Bewusstsein durch vermehrte Integration von Menschen mit Behinderung und dadurch andere Erfahrungen, die dieses Bewusstsein bilden. Im ‚industriell gebildeten Bewusstsein' wird der Einfluss der Massenmedien wirksam. Durch die Verbreitung von Klischees und der Verstärkung von Vorurteilen wird so ein undifferenziertes Bild von Behinderung transportiert, das wiederum an unser Gewissen appelliert und Schuldgefühle produziert. Basis des ‚systematisch gebildeten Bewusstseins' sind die Wissenschaften, die sich mit Behinderung und Menschen mit Behinderung befassen. Das systematisch in den verschiedenen Disziplinen geschaffene Wissen über Norm und Abweichung legitimiert wiederum die Aufrechterhaltung separierender Institutionen. Das ‚historisch gebildete Bewusstsein' verweist auf die gängigen Vorstellungen darüber, wie unsere Gesellschaft und Wirtschaft funktioniert. Ein demokratisches Ideal von Freiheit und Gleichheit aller Menschen trifft mit den Gesetzen der freien Marktwirtschaft aufeinander. Dies ist die Basis für einen Konflikt zwischen der Betrachtung von Menschen mit Behinderung aus wirtschaftlicher Perspektive (z.B. Arbeitskraft) und einer humanistischen, die für Gleichberechtigung steht (vgl. ebd.).
Auch die sozialpsychologische und soziologische Einstellungsforschung beschäftigt sich mit den Einflüssen auf Einstellungen und Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderung. Die herangezogenen Arbeiten und empirischen Studien kommen im Allgemeinen auf ähnliche Befunde wie Gstettner in seiner Analyse (siehe Abschnitt 4.4.1).
Einen anderen Zugang zur Entstehung von Bildern von Behinderung bietet eine psychoanalytisch orientierte Herangehensweise. Psychische Vorgänge von Verdrängung, Übertragung und Gegenübertragung werden zur Erklärung von Behinderung herangezogen. Als zentrales Element ist hier Angstabwehr zu nennen. Menschliche Ängste und Leiden werden abgewehrt und auf Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung projiziert, gleichzeitig entsteht wieder Angst vor diesen Projektionen (vgl. Schönwiese 2002, S.190). Diese Leidensprojektionen formieren sich nach Niedecken in gesellschaftlichen Phantasmen, die eine Institution des "Geistigbehindertseins" (Niedecken 1998) stützen:
"Die Phantasmen sind das Konglomerat gesellschaftlicher Einstellungen zum "Geistigbehindertsein", die, vornehmlich vermittelt über die Mutter, die Entwicklung des Kindes bestimmen" (Niedecken 1998, S. 30).
In den Phantasmen, wie Niedecken diese Konstruktionen von Behinderung nennt, werden gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen im Unterbewusstsein der einzelnen Individuen wirksam. Die gesellschaftlichen Herrschaftssysteme, die in den Phantasmen abgesichert werden, erscheinen so als zeitlos, unabänderlich und natürlich und sind in Institutionen organisiert (vgl. ebd. S. 103). Eltern, die mit ihren Ängsten, Schuldgefühlen usw. ihrem Kind mit einer so genannten geistigen Behinderung gegenüber konfrontiert sind, können auf diese vorgefertigten Konstrukte zurückgreifen (vgl. Niedecken 1997, im Internet). Dadurch wirken diese von vornherein als konstituierender Teil des Lebens von Menschen mit Behinderung. Durch diese phantasmatischen Konstrukte werden Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung vorstrukturiert. Außerdem prägen sie das Selbstbild von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung dahingehend, dass sie gezwungen sind ihr Leben daran anzupassen (vgl. Niedecken 1997, im Internet).
Auch bei Sinason (2000) ist von einer Anpassung von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung zu lesen. Hier wird explizit eine Unterscheidung in primäre und sekundäre Behinderung gemacht:
"Wenn der tatsächliche Unterschied, sofern er nicht vorteilhaft ist, als primär angesehen wird, dann stellt die Art und Weise, wie nicht damit umgegangen wird, die sekundäre Behinderung dar." (Sinason 2000, S.27)
Das Nicht-Umgehen bezieht sich hier auf unbewusste Verdrängungsprozesse, die zu einer Ausbildung von Symptomen führen. Diese können von ständigem Lächeln, durch einen vermehrten Wunsch den Vorstellungen derjenigen zu entsprechen, von denen man abhängig ist, bis zu aggressivem Verhalten als Möglichkeit mit der eigenen Lebenssituation umzugehen, reichen. Als dritte Art sekundärer Behinderung nennt Sinason die Abwehr eines Traumas, die zu Verhaltensweisen führt, die dann als geistige Behinderung definiert werden (vgl. ebd.).
So genannte geistige Behinderung konstituiert sich also nach Sinason aus einem Widerstand gegen die äußere Umwelt, der sich in "Dummheit", Aggression oder anderem "Fehlverhalten" äußert. Elbert (1982, im Internet) spricht ebenso von so genannter geistiger Behinderung als Akte sinnvoller Gegenwehr gegen eine behindernde und gestörte Interaktionswelt. Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung wehren sich durch die Verhaltensweisen, die als Symptome von Behinderung betrachtet werden, gegen behindernde Entwicklungsverhältnisse (vgl. Elbert 1982, im Internet). Die Produktion eines ‚geistigbehinderten Selbst', wie Elbert die Formierungsprozesse von Behinderung beschreibt, wurde bereits an anderer Stelle ausgeführt (siehe Punkt 3.1.1).
Gemeinsam ist diesen psychoanalytischen Erklärungsansätzen die Herangehensweise an ein Phänomen Behinderung als Ergebnis von innerpsychischen Prozessen, in denen sich gesellschaftlichen Wertvorstellungen manifestieren. Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung reagieren auf ihre Art auf die ihnen entgegengebrachten bewussten und unbewussten Gefühle.
Eine Radikalisierung der Annahme, Behinderung sei eine Konstruktion, findet sich bei Feyerer (2003, im Internet). Für ihn stellt Separation und Selektion an sich die Behinderung dar. Wird davon ausgegangen, dass Menschen sich durch Interaktion und Kommunikation entwickeln, wird durch mangelnde Integration der Erfahrungsraum von Menschen mit Behinderung empfindlich verkleinert und sie werden dadurch vielfacher Lern- und Kommunikationsmöglichkeiten beraubt. In dieser ökosystemischen Sichtweise stehen die (oft behinderten) Beziehungen zwischen Menschen mit Behinderung und ihrer Umwelt im Vordergrund (vgl. ebd.).
In diesem Sinne ist die Integration von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung in Schule, Arbeit und jeglichen anderen sozialen Kontexten eine Praxis, die einer Behinderung von Entwicklung den Boden entzieht. Markowetz (2000) beschreibt Integration als Mittel gegen eine Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung: die Identitätsentwicklung von Menschen mit Behinderungen wird in integrativen Kontexten positiv beeinflusst. Dadurch wird es möglich, dass "Integration (...) die alten Bilder von Menschen mit Behinderungen zu Gunsten der Etablierung von egalisierenden Menschenbildern" (Markowetz 2000, im Internet) auflöst. Allerdings wird von Markowetz darauf verwiesen, dass es nicht möglich sein wird, durch Integration alle Vorurteile und Stigmatisierungen aus der Welt zu schaffen. Dennoch erwartet er längerfristig eine größere Toleranz gegenüber Menschen mit Behinderung (vgl. ebd.). Hier sei auf Abschnitt 4.4.3.3 dieser Arbeit verwiesen, der sich mit Veränderungen in den Einstellungen auseinandersetzt. Markowetz' Analyse stimmt in diesem Punkt mit den Befunden der Einstellungsforschung überein.
Während aber Integration eine Eingliederung von Menschen mit Behinderung in eine bestehende Gruppe bedeutet, verlangt das Prinzip der Inklusion eine Veränderung der Strukturen und Auffassungen, um ein gleichberechtigtes Leben für alle zu ermöglichen (vgl. Hohmeier 2004, S. 136). "Demnach müssen sich nicht die Menschen ändern, sondern die Bedingungen, die behindern" (Bosse 2006, S. 55). Durch die Veränderung der äußeren Bedingungen können alle BürgerInnen am gesellschaftlichen Leben gleichermaßen teilhaben, unabhängig von ihren körperlichen, psychischen oder kognitiven Beeinträchtigungen, diese verlieren hier ihre Relevanz.
Diese Perspektive der Teilhabe findet auch Eingang in die Neufassung der Behinderungsdefinition der WHO aus dem Jahr 2001. In der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) wird eine biopsychosoziale Betrachtung von Behinderung durchgesetzt. Neben personenbezogenen Faktoren finden hier auch Kontextfaktoren ihren Eingang. Eine ganzheitliche Perspektive auf den Menschen wird so ermöglicht. Die defizitäre Einteilung in Schädigung (impairment), Funktionseinschränkung (disability) und soziale Beeinträchtigung (handicap), behandelt unter Punkt 3.1.1, wird überwunden in Richtung einer an den Kompetenzen orientierten Sichtweise von Behinderung.
"Die Negativbeschreibung der Bereiche, aus denen ein Mensch aufgrund persönlicher Merkmale ausgeschlossen ist, wurde also durch eine Beschreibung seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten ersetzt." (Lindemann/Vossler 1999, S. 139)
Mit den Begriffen Aktivität und Partizipation werden positive Kategorien geschaffen, die eine Orientierung an den Kompetenzen und Stärken erlauben (vgl. ebd.). Allerdings ist die ICF, wie schon vorher die ICIDH, ein Klassifikationssystem, das versucht Menschen zu beschreiben und an der Norm von Menschen ohne Behinderung zu messen (vgl. Puschke 2005, im Internet).
In einem Paradigma der Selbstbestimmung geht es um die Kompetenz das eigene Leben zu gestalten. Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung sind fähig, für sich selbst zu sprechen und selbst über ihr Leben zu entscheiden, auch wenn sie in manchen Bereichen Unterstützung brauchen. Die Orientierung an den Kompetenzen setzt sich auch in der konkreten Ausübung von Selbstbestimmung fort: mithilfe von Empowerment-Strategien sollen Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung dazu befähigt werden ihre Rolle als BürgerInnen und DienstleistungsempfängerInnen (im Gegensatz zu Objekten von Förderung und Therapie) wahrzunehmen:
"Gekennzeichnet ist diese Haltung durch die generelle Auffassung, dass auch der (erwachsene) Mensch mit einer geistigen Behinderung Experte seiner selbst ist. Er kennt seine Bedürfnisse und Wünsche, er weiß um seine Grenzen und spürt seine Abhängigkeiten, er ist in der Lage, Art und Umfang notwendiger Hilfen zur eigenen Lebensgestaltung selbst zu bestimmen." (Hähner 1999a, S.130)
Unter einem Paradigma der Selbstbestimmung wird ein Menschenbild, das sich an den Kompetenzen eines Menschen orientiert, realisiert. Eine Besinnung auf die individuellen Stärken macht ein Leben gemäß dem Normalisierungsprinzip möglich.
Das Verständnis von Behinderung hat sich im wissenschaftlichen Diskurs in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Inwiefern sich dieses Umdenken in den gesellschaftlichen Einstellungen und im Verhalten manifestieren konnte, bleibt hier noch weitgehend ungeklärt. Dieser Frage soll mithilfe der Anwendung des sozialpsychologischen Einstellungskonstruktes auf das Phänomen Behinderung nachgegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
Im vorangegangenen Abschnitt stand eine Auseinandersetzung mit Bildern von Behinderung und Paradigmen und Modellen der Betrachtung von Behinderung. Um diese Bilder, die auch bei RichterInnen vorhanden sind, empirisch zugänglich zu machen, wird in der vorliegenden Arbeit das Konzept der Einstellung herangezogen. Mit dessen Hilfe sollen Phänomene wie Vorurteile oder soziale Diskriminierung fassbar werden. Um die Einstellungen, die gegenüber Menschen mit Behinderung relevant sind, zu erfassen, wird in einem ersten Schritt eine Auseinandersetzung mit dem Einstellungsbegriff in der Sozialpsychologie, der wissenschaftlichen Disziplin, die sich in erster Linie mit diesem Phänomen beschäftigt, stehen.
‚Einstellung' oder ‚Soziale Einstellung' nimmt in der Sozialpsychologie eine zentrale Stellung ein. Bierhoff beispielsweise geht davon aus, dass dieser Begriff einen der meist verwendeten in der Sozialpsychologie darstellt. Die Ursache dafür ortet er "darin, dass ein Verständnis der subjektiven Repräsentation sozialer Wirklichkeit durch Erfassung der individuellen Orientierungsstrukturen der Schlüssel zum Verständnis menschlicher Verhaltensplanung und menschlicher Spontaneität ist." (Bierhoff 2000, S. 265) Es soll also darum gehen, über Einstellungen die Beweggründe für Handlungen offen zu legen.
Der Begriff der Einstellung ist viel diskutiert und auf verschiedenste Weise definiert. Güttler (2003, S. 98) vergleicht die unterschiedlichen Umschreibungen mit der biblischen Sprachenverwirrung beim Turmbau zu Babel, wo niemand mehr versteht, was die anderen sagen. So werden 1935 von Allport (nach Güttler, ebd.) 17 verschiedene Definitionen verwendet, während es 1977 bei Elefoe (nach Güttler, ebd.) bereits ca. 120 sind. Heute lässt sich die Zahl der möglichen Bedeutungen vermutlich nicht mehr so genau benennen.
Bei Aiken (2002, S. 2) ist zu lesen, dass der englische Begriff "attitude" in der westlichen Literatur ab dem 18. Jahrhundert verbreitet ist, seinen Einzug in die Psychologie allerdings erst in den 1860ern fand. Ab den 1930ern wurde der Einstellungsbegriff in der Sozialpsychologie vermehrt diskutiert. Eine viel zitierte und gleichzeitig eine der einflussreichsten Definitionen aus dieser Zeit stammt von Allport 1935:
"An attitude is a mental and neural state of readiness. Organized through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the individual's response to all objects and situations with which it is related." (Allport zit. nach Benninghaus 1976, S. 22)
Allport fasst den Einstellungsbegriff hier sehr weit: Diese Zustände der Bereitschaft zu reagieren können "von einem momentanen, mentalen oder motorischen Zustand (wie wenn ein Läufer den Startschuss erwartet) bis zu umfassenden und stabilen Dispositionen (gleichbedeutend mit Wertsystem oder Lebensphilosophie)" (Ostrom 1980, S. 41) reichen.
Güttler beschreibt in seiner Analyse verschiedener Definitionen Einstellungen als
"hypothetische Konstrukte, die einer direkten Beobachtung nicht zugänglich sind und nur indirekt erschlossen werden können. Als Denkmodell i.S. eines hypothetischen Konstruktes erklären Einstellungen, warum sich Menschen gegenüber Einstellungsobjekten interindividuell verschieden, aber relativ konstant verhalten. Das beobachtete Verhalten lässt dann Rückschlüsse auf die Einstellungen zu." (Güttler 2003, S. 101)
Hier wird einerseits die Verbindung zwischen Einstellung und Verhalten und andererseits die Objektbezogenheit von Einstellungen deutlich. Ein weiteres wichtiges Moment ist die Entstehung von Einstellungen, die beispielsweise bei Roth (nach Güttler 2003, S. 100) behandelt wird: Einstellungen werden im Rahmen der Sozialisation erworben und gelernt. In der sozialpsychologischen Literatur werden zur Erklärung des Erwerbs von Einstellungen die großen Lerntheorien (klassische und operante Konditionierung und Modelllernen) herangezogen (vgl. z.B. Gollwitzer/Schmitt 2006, S. 154ff; Güttler 2003, S. 106). Darauf soll hier allerdings nicht näher eingegangen werden.
Einstellungen können auch als Schemata der Beurteilung von Situationen und Objekten gesehen werden. Diese relativ stabilen Bezugsrahmen bieten Menschen eine Orientierung in ihren Bewertungen (vgl. Güttler 2003, S. 102).
In der Sozialpsychologie kann prinzipiell zwischen ein- oder mehrdimensionalen Konzepten zu Einstellung unterschieden werden. Das folgende Modell ist in zweitere Gruppe einzuordnen (vgl. Gollwitzer/Schmitt 2006, S. 150). Viele AutorInnen beschreiben die Struktur von Einstellungen als aus drei Komponenten bestehend (z.B. Rosenberg/Hovland 1960 nach Güttler 2003; McGuire 1985 nach Aiken 2002). Jede Einstellung sei demnach in eine kognitive, eine affektive und eine konative Komponente gliederbar. Diese Aufteilung wurzelt nach Klapproth in einer philosophischen Tradition, die die menschliche Psyche in Sphären des Denkens, Fühlens und Handelns einteilt (vgl. Klapproth 1985, S. 1).
Die kognitive Komponente (auch "Wissenskomponente") beinhaltet Wahrnehmungen, Meinungen, Glauben (vgl. Güttler 2003, S. 103). "Sie zeigt sich in den Vorstellungen, Überzeugungen und bewertenden Urteilen des Individuums gegenüber einem Einstellungsobjekt." (Cloerkes 2007, S. 104) Unter die affektive Komponente fallen Gefühle, die mit dem Einstellungsobjekt verbunden sind, ebenso wie "Reaktionen des autonomen Nervensystems" (Güttler 2003, S. 103). Emotionen und Äußerungen über Gefühle gehören dieser Kategorie ebenso an (vgl. Cloerkes 2007, S. 104). Die konative Komponente stellt die Handlungskomponente einer Einstellung dar: "Verhaltenstendenz, -absicht, Bereitschaft zum Handeln" (Güttler 2003, S. 103). In dieser Komponente wird der Bezug zu Verhalten und Handeln hergestellt.
In Abbildung 2 wird das Dreikomponenten-Modell der Einstellung nach Rosenberg/Hovland nochmals schematisch dargestellt.
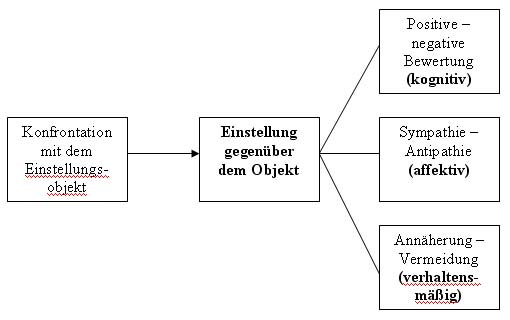
Abbildung 2: Drei-Komponentenmodell der Einstellung nach Rosenberg/Hovland (Gollwitzer/Schmitt 2006, S. 151)
Je nach Gewichtung der einzelnen Komponenten lassen sich Einstellungen kategorisieren. So können affektive Assoziationen, intellektualisierte und handlungsorientierte Einstellungen unterschieden werden (vgl. Bierhoff 2000, S. 268). Sind die drei Komponenten untereinander stimmig, handelt es ich um stabile, homogene oder balancierte Einstellungen. Im Gegensatz dazu stehen ambivalente Einstellungen. In diesem Fall widersprechen sich die einzelnen Komponenten. Die Konsistenz der drei Komponenten ist ausschlaggebend für die Stabilität einer Einstellung (vgl. Güttler 2003, S. 103).
Das Dreikomponentenmodell der Einstellung wird wegen der Schwierigkeit, die drei Dimensionen empirisch zu trennen, kritisiert (vgl. Ganter 1997, im Internet). Dennoch stellt es in meinen Augen eine Möglichkeit dar, das Konstrukt Einstellung analytisch zu erfassen. Deshalb wird genanntes Modell in dieser Arbeit zur Erklärung des Zusammenhangs der Bilder von Behinderung zu Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung herangezogen.
Einstellungen werden in der sozialpsychologischen Literatur auch hinsichtlich ihrer Funktionen beschrieben. In sozialpsychologischen Lehrbüchern (z.B. Bierhoff 2000; Güttler 2003; Gollwitzer/Schmitt 2006) wird eine Einteilung in vier Funktionen getroffen:
-
Wissensfunktion: Die Orientierung in der sozialen Umwelt wird durch die in den Einstellungen implizierten Handlungsanweisungen ermöglicht (vgl. Güttler 2003, S. 105). Dadurch wird es möglich schneller zu reagieren, als wenn jede einzelne Situation in ihrer Komplexität jedes Mal neu beurteilt werden müsste. Aus evolutionstheoretischer Sicht ist es für unser Überleben wichtig, sofort zwischen gut und böse unterscheiden zu können (vgl. Gollwitzer/Schmitt 2006, S. 151).
-
Anpassungsfunktion: Durch Einstellungen können persönlicher Nutzen und Belohnung erreicht werden und negative Konsequenzen vermieden werden. Anpassung der Einstellungen an eine soziale Gruppe und entsprechende Selbstdarstellung sind Strategien, um sozial ‚erfolgreich' zu sein (vgl. Güttler 2003, S. 105).
-
Ichverteidigungsfunktion: Durch psychische Abwehrmechanismen wie Projektion oder Verschiebung, die im Rahmen von Einstellungen bestehen, lassen sich "Ängste abwehren, innerpsychische Konflikte vermeiden, Minderwertigkeitsgefühle kompensieren, Ängste vor sozialem Abstieg unterdrücken, das Selbstbild vor Verlust des Selbstwertgefühles und die Schuld für Probleme auf andere Personen projizieren." (Güttler 2003, S. 105) Dadurch kann sich der oder die Einzelne von diesen negativen Gefühlen distanzieren und den innerpsychischen Konflikt minimieren. Die defensive Funktion von Einstellungen beinhaltet also die Aufwertung der eigenen Person durch Abwertung anderer (vgl. Gollwitzer/Schmitt 2006, S. 152).
-
Expressive Funktion: Einstellungen können auch dazu dienen, eine Identität aufzubauen und zu festigen. Über Einstellungen können sich Menschen definieren. Es besteht die Möglichkeit, sich im sozialen Kontext zu positionieren und seine Einstellung zu verteidigen (vgl. Güttler 2003, S. 105f; Gollwitzer/Schmitt 2006, S. 152f).
Die Analyse von Einstellungen auch hinsichtlich ihrer vielfältigen Funktionen macht deutlich, dass es sich hierbei nicht um isolierte Phänomene handelt. Deshalb muss auch eine Maßnahme zur Veränderung von Einstellungen diesen Kontext mitberücksichtigen. Auch in der Auseinandersetzung mit Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung ist es meines Erachtens sinnvoll, die Funktionen, die Einstellungen für einen Menschen oder eine Gruppe erfüllen, mitzudenken um diese in ihrer Komplexität zu erfassen.
Vorurteile beziehen sich auf Mitglieder von Gruppen und basieren auf vorgefertigten Meinungen über dieselben. Aiken beispielsweise gibt uns für diese Phänomene folgende Definition: "Having preconceived attitudes or opinions, whether favourable or unfavourable, toward members of other groups is known as social prejudice, or simply prejudice." (Aiken 2002, S. 80) Hervorzuheben ist hier, dass Vorurteile sowohl positiv als auch negativ belegt sein können. Ganter (1997, im Internet) weist ebenso darauf hin, dass "auch positiv konnotierte Einstellungen gegenüber Personen aufgrund deren Zugehörigkeit zu einer Gruppe (...) als Vorurteil bezeichnet werden" können. Viele AutorInnen wiederum verwenden den Vorurteilsbegriff nur für negative Einstellungen gegenüber einer Gruppe von Menschen (z.B. Cloerkes 2007, S. 104; Bierhoff 2000, S. 285).
Für die Erklärung von Vorurteilen kann das Einstellungskonzept, wie es unter Punkt 3.1.2 erläutert wird, herangezogen werden. Ganter formuliert diesen Zusammenhang folgendermaßen: "Vorurteile sind demnach als eine spezielle Variante von Einstellungen aufzufassen, die im Wesentlichen dadurch bestimmt ist, dass sie sich auf bestimmte Einstellungsobjekte beziehen, nämlich auf Gruppen, bzw. auf die diesen Gruppen kategorisch zugeordneten Personen." (Ganter 1997, im Internet)
Vorurteile als Spezialformen von Einstellungen zu betrachten, erlaubt auch den Schluss, drei Komponenten analytisch zu differenzieren. Diese Einteilung wird in der sozialpsychologischen Literatur mittels der Konstrukte Vorurteil, Stereotyp und soziale Diskriminierung erreicht:
"Die drei Begriffe Vorurteil, Stereotyp und soziale Diskriminierung können (...) zum Dreikomponenten-Modell der Einstellung in Beziehung gesetzt werden, wobei das Vorurteil vorrangig den affektiven, das Stereotyp den kognitiven Aspekt und die soziale Diskriminierung das konkrete Verhalten pointiert." (Güttler 2003, 118)
Stereotype, die kognitiven Komponenten von Vorurteilen, sind laut Lippmann, der diesen Begriff 1922 prägte, "Bilder in unseren Köpfen" (zit. nach Güttler 2003, S. 113). Eine neuere Definition, wie Ganter sie als zeitgemäß befindet, wäre: "stereotypes are beliefs about the characteristics, attributes and behaviors of members of certain groups" (Hilton/von Hoppel 1996, S. 240, zit. nach Ganter 1997, im Internet) Hier wird noch einmal deutlich gemacht, dass, sofern man bei der Dreiteilung affektiv - kognitiv - konativ bleiben will, es sich bei Stereotypen um den kognitiven Anteil von Einstellungen handeln muss (siehe Punkt 3.1.2). Demgemäß können die Bilder von Behinderung bei RichterInnen, wie sie in späterer Folge behandelt werden, als kognitive Elemente von Einstellungen betrachtet werden. Ob es sich dabei um stereotype Bilder, also generalisierte Annahmen und Meinungen über Mitglieder der imaginären Gruppe der Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung, handelt, oder um eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Menschen, wird zu untersuchen sein.
Die Verhaltenskategorie von Vorurteilen schließlich, die soziale Diskriminierung, verweist auf Benachteiligung aufgrund von Zugehörigkeit zu einer Gruppe (vgl. Bierhoff 2000, S. 285). Der Verhaltenskategorie entsprechen im Kontext dieser Arbeit die Entscheidungen, die von den RichterInnen getroffen werden. Hier stellt sich die Frage, inwiefern diese auch eine soziale Diskriminierung darstellen könnten.
Eine weitere begriffliche Abgrenzung, die an dieser Stelle notwendig ist, betrifft den aus der Soziologie stammenden Terminus des "Stigma".
"Ein ‚Stigma' ist der Sonderfall eines sozialen Vorurteils und meint die Zuschreibung bzw. die negative Definition eines Merkmals oder einer Eigenschaft." (Cloerkes 2007, S. 104)
Erving Goffman bringt diesen Begriff 1967 in die wissenschaftliche Diskussion ein. Eine Eigenschaft einer Person, die zu einer Abwertung derselben führt - also "zutiefst diskreditierend ist" (Goffman 1967, S.11) - wird mit Stigma bezeichnet. Der Ausgangspunkt für die Entstehung von Stigmata bildet mit Goffman eine Diskrepanz zwischen Vorannahmen über die soziale Identität eines Menschen und der tatsächlich erlebten Person, die durch bestimmte Attribute von den Erwartungen abweicht (vgl. Goebel 2002, S. 69f). Die ‚aktuale soziale Identität' stimmt nicht mit der ‚virtualen sozialen Identität', die durch diese normativen Erwartungen gebildet wird, überein.
"Es (das Individuum, Anmerkung der Autorin) hat ein Stigma, das heißt, es ist in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert hatten." (Goffman 1967, S. 13)
Diese Diskrepanz hat eine Abwertung der ganzen Person zur Folge. Das Stigma nimmt einen "Master Status" (Hohmeier 1975, im Internet) ein, der dazu führt, dass dem Menschen noch weitere negative Eigenschaften unterstellt werden. Die Bewertung des Attributs wird generalisiert auf alle potentiellen sozialen Rollen des Menschen, der so als Ganzes diskreditiert wird (vgl. ebd.; Tröster 2008, S.140).
Allerdings ist hier zu beachten, dass eine Eigenschaft an sich noch kein Stigma darstellt: Erst in Zuschreibungsprozessen im Rahmen der Interaktion kann ein Merkmal zu einem diskreditierenden Attribut werden (vgl. Goffman 1967, S. 11, siehe auch Cloerkes 2007, S. 169). Dieser Zusammenhang verweist auf den Symbolischen Interaktionismus, dem Goffman zugerechnet wird (vgl. Boatca/Lamnek 2004, S.167). Während bei Goffman das betreffende Merkmal eine tragende Rolle spielt, sprechen sich andere AutorInnen (z.B. Hohmeier 1975, im Internet) dafür aus, den Fokus auf die Prozesse der Zuschreibung zu legen.
Macht stellt einen wichtigen Faktor in der Durchsetzung eines Stigmas dar. Die Definition eines von der Norm abweichenden Merkmals als diskreditierend kann nur mit Macht einer Instanz über einen Menschen durchgesetzt werden. "Je größer der Machtunterschied, desto leichter können Stigmata durchgesetzt werden" (Boatca / Lamnek 2004, S. 169). Aus diesem Grund können Angehörige einer unteren sozialen Schicht wegen desselben Merkmals eher stigmatisiert werden als Angehörige einer mit mehr gesellschaftlicher Macht ausgestatteten Schicht (vgl. ebd.; Hohmeier 1975, im Internet). Menschen mit Behinderung fehlt vielfach die nötige Macht, sich den stigmatisierenden Zuschreibungen zu widersetzen, was schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen kann. Die Folgen von Stigmatisierungen reichen nach Hohmeier von Diskriminierung und dem Verlust sozialer Rollen und Kontakte über Spannungen und Störungen in den Interaktionen bis hin zu Auswirkungen auf die eigene Identität (vgl. Hohmeier 1975, im Internet). Der letztgenannte Aspekt stellt für Goffman die gravierendste Konsequenz einer Stigmatisierung dar: stigmatisierte Menschen erfahren eine Beschädigung ihrer Identität (vgl. Goffman 1967).
Stigmata erfüllen Funktionen sowohl für die interagierenden Personen als auch für die Gesamtgesellschaft. Die Funktionen von Stigmata für das Individuum decken sich mit jenen, die für Einstellungen im Allgemeinen bereits behandelt wurden (siehe Punkt 4.1.3). Für die Einzelne oder den Einzelnen kann ein Stigma in der Interaktion Unsicherheiten vermindern, indem die Situation vorstrukturiert wird, oder eine Entlastung darstellen, indem Ängste und Aggressionen auf einen "Sündenbock" abgeladen werden können. Durch die Abgrenzung von einer stigmatisierten Person kann auch eine "Wiederherstellung des gefährdeten seelischen Gleichgewichts" (Cloerkes 2007, S.171) erreicht werden. Neben der bereits angedeuteten Herrschaftsfunktion dienen Stigmata der Gesellschaft der Systemstabilisierung und der Forcierung von Normkonformität (vgl. ebd., Nickel 1999, im Internet).
Wie eingangs erwähnt, wird Stigma als Spezialform eines Vorurteils gehandelt. Die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Konstrukten benennt Cloerkes folgendermaßen: "Immer negativ, komplexer Inhalt, affektive Geladenheit, historische und interkulturelle Variabilität, Tendenz zur Generalisierung des Merkmals auf die ganze Person." (Cloerkes 2007, S. 169) Allerdings bezeichnen diese beiden Termini nicht das gleiche Phänomen. Während sich Vorurteile, wie im vorherigen Abschnitt gezeigt wurde, in erster Linie auf Gruppen und deren Mitglieder beziehen, betrifft ein Stigma Merkmale von Personen (vgl. ebd.). Eine weitere begriffliche Abgrenzung wird zwischen Stigma und Stigmatisierung getroffen. ‚Stigma' wird der Einstellungsebene zugerechnet, während es sich bei Stigmatisierung um "verbales oder non-verbales Verhalten, das aufgrund eines zueigen gemachten Stigmas jemandem entgegengebracht wird" (Hohmeier 1975, im Internet), handelt. Das Dreikomponenten-Modell der Einstellung, wie es in Abschnitt 4.1.2 dargestellt wurde, wird auf Stigmata ebenso angewendet:
"Sie bestehen einmal aus kognitiven Aussagen über Eigenschaften der bezeichneten Person oder Gruppe; sie enthalten zum anderen Bewertungen dieser Eigenschaften; sie geben weiter meist explizit oder implizit an, welches Verhalten dieser Person gegenüber geboten ist. Wie in vielen Fremdstereotypen finden wir auch in Stigmata klischee- und formelhafte Wendungen sowie Symbole von großer Einprägsamkeit und mit hoher Suggestivwirkung" (ebd.).
Hohmeier macht hier die Verschränkung der Konzepte von Einstellung, Vorurteil und Stigma deutlich. Eine genaue Abgrenzung der Begriffe stellt sich dadurch oft etwas schwierig dar. In der Literatur werden Stigma und Vorurteil oftmals auch synonym verwendet. Dennoch finde ich eine differenzierte Betrachtung der Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung wichtig und deshalb auch eine angemessene Terminologie unentbehrlich.
Menschen mit Behinderung machen vielfach Stigmatisierungserfahrungen. Aufgrund ihrer Abweichung von normativen Erwartungen werden Menschen mit Behinderung im Sinne der Stigma - Theorie weitere negative Attribute zugesprochen, sowie deren gesellschaftlicher Status dementsprechend niedrig angesetzt. Diese kurze Auseinandersetzung mit dem Stigma-Konzept soll einen weiteren Baustein in der Betrachtung von Bildern und Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung darstellen, der es uns ermöglichen soll, Mechanismen zu verstehen, die in der Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung wirken. Die hier behandelte Stigma - Theorie bietet einen Erklärungsansatz, der die Ursachen für Interaktionsspannungen und -störungen in einem sozialen Definitionsprozess ortet. Dies entspricht der Argumentation des Sozialen Modells von Behinderung, wie es in Abschnitt 3.1.4 ausgearbeitet wurde. Gleichzeitig wird so die Verbindung zum Einstellungskonzept geschaffen, das es mir in dieser Arbeit ermöglicht, die Bilder von Behinderung bei RichterInnen zu erschließen.
Im vorangegangenen Kapitel wurden Einstellungen, deren Struktur und Funktionen im Allgemeinen behandelt. Im Folgenden wird es um diejenigen Einstellungen gehen, die sich auf Menschen mit Behinderung beziehen. Das oben ausgeführte Strukturmodell der Einstellung gilt auch hier vielfach als Basis der Auseinandersetzung, wobei der affektiven Komponente hier besondere Relevanz beigemessen wird (vgl. Goebel 2002, S 38; Jansen 1972, S.122).
Eine viel zitierte Arbeit zu Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung stammt vom Soziologen Günther Cloerkes. Dieser beschäftigt sich mit der sozialen Reaktion auf Menschen mit Behinderung, die er als "Gesamtheit der Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber behinderten Menschen" (Cloerkes 2007, S 111) beschreibt. Die Interaktion von Menschen mit und ohne Behinderung ist oftmals von Spannungen geprägt. Im Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderung lassen sich mit Cloerkes immer wieder typische Reaktionsformen entdecken, die von Anstarren und Ansprechen, diskriminierenden Aussagen und Witzen oder Aggressivität bis zu scheinbar positiven Mitleidsbekundungen und aufgedrängter Hilfe reichen (vgl. ebd., S. 106f). Durch diese Reaktionsformen entwickeln sich Störungen in der Interaktion, die als unangenehm empfunden werden, und so zu einer Vermeidung solcher Interaktionen führen (vgl. Nüesch 2002, S. 21f). Die Erforschung von Verhaltensformen ist allerdings nicht Gegenstand dieser Arbeit, weshalb auf eine nähere Auseinandersetzung mit dieser Komponente der sozialen Reaktion an dieser Stelle verzichtet wird. Der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten jedoch, der vielfach als problematisch betrachtet wird, wird in diesem Abschnitt noch zu behandeln sein.
Anzumerken wäre hier außerdem, dass es sich bei den behandelten Einstellungen stets um Einstellungen von Nichtbehinderten gegenüber Menschen mit Behinderung handelt. Die Perspektive von Menschen mit Behinderung findet in diesen soziologischen und sozialpsychologischen Studien kaum Platz. Finkelstein (1980, im Internet) kritisiert die einseitige Sichtweise in vielen Untersuchungen, deren Fokus die Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung durch andere Personen ist:
"The predominant focus of attitudes, help, research and so on has, a natural expression of one side of the disability relationship, been towards the disabled person." (ebd.)
In der vorliegenden Arbeit wird es ebenso um die Perspektive von Menschen ohne Behinderung auf Menschen mit Behinderung gehen. Aus diesem Grund kann auch auf Finkelsteins Einwände nicht näher eingegangen werden. Allerdings scheint es mir wichtig zu erwähnen, dass diese nur eine Seite der Medaille darstellt und die zweite Seite des "disability paradox", wie Finkelstein es nennt, die Einstellungen von Menschen mit Behinderung in diesem Kontext ebenso eine wichtige Erkenntnisquelle darstellen.
Einstellungen werden im Laufe der Sozialisation erworben. Auch die Einstellungen, die sich auf Menschen mit Behinderung beziehen, werden nach Cloerkes (2007, S. 113f) durch die Verinnerlichung sozio-kultureller Werte und Normen im Sozialisationsprozess erlernt. Diese Normen und Werte halten eine Gruppe oder Gesellschaft zusammen und eine Abweichung davon wirkt gefährdend auf deren Stabilität. Bereits in frühester Kindheit wird ein Verständnis von Normalität und Abweichung entwickelt. Cloerkes beschreibt folgende Aspekte als besonders relevant für das Erlernen von Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung: Über die Sozialisationsinhalte und -praktiken werden Kindern die gesellschaftlich geforderten sozialen Reaktionen auf Behinderung vermittelt, die dann fortwährend verstärkt werden. Bilder von Schönheit als Verkörperung des Guten und körperlicher Abweichung als Inbegriff des Bösen sind in den Medien allgegenwärtig und werden von Kindern in ihr Wert- und Weltbild aufgenommen (vgl. ebd. S. 114). Cloerkes misst außerdem dem kulturhistorischen Hintergrund eine gewisse Bedeutung in der Entstehung von Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung zu. So sieht er etwa Ursprünge der heutigen Einstellungen in den hebräischen, griechischen, christlichen oder calvinistischen Überzeugungen zu Gesundheit, Krankheit und Behinderung (vgl. ebd. S. 115). Eine weitere Auseinandersetzung mit diesen Wurzeln würde hier zu weit führen. Hier sei auf Gstettners Analyse der alltäglichen Konstruktion von Behinderung verwiesen, wie sie unter Punkt 3.1.4.1 erläutert wird. Dieser macht ebenso auf die Bedeutung eines historisch gewachsenen Wissens über Behinderung aufmerksam, wie auch auf die Bedeutung der Sozialisation, bei Gstettner ‚lebensgeschichtlich gebildetes Bewusstsein' genannt (vgl. Gstettner 1982, im Internet). Finkelstein (1980, im Internet) bringt in die Diskussion um die Entstehung von Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung einen weiteren Aspekt ein: So ortet er in der Erforschung der Einstellungen zu Behinderung selbst einen Beitrag zur Konstruktion von Behinderung. Die Forschenden schaffen durch ihre Auseinandersetzung mit den Einstellungen Nichtbehinderter ein gesellschaftliches Bild von Behinderung, das die Perspektive der Befragten widerspiegelt (vgl. ebd.). Auch diese Argumentation findet sich bei Gstettner wieder: im ‚systematisch gebildeten Bewusstsein'. Diese Position der Einstellungsforschung als konstituierendes Moment von Behinderung ist in einer Untersuchung mit zu bedenken. Allerdings sucht man diese kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Wissenschaft als Produzentin von Vorurteilen und negativen Einstellungen in vielen Studien vergeblich.
Da eine Vielzahl der Forschungen zu Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung aus der Soziologie und Sozialpsychologie kommen, sind auch die Erhebungsmethoden dementsprechend vorwiegend quantitativ. Tröster (1988, S. 19f) ortet vier Gruppen der gebräuchlichsten Verfahren zur Messung von Einstellungen zu Behinderung:
Befragungen: Über Interviews und Fragebögen werden Meinungen und Ansichten über das Einstellungsobjekt, also Menschen mit Behinderung, zu verschiedensten Lebensbereichen abgefragt. Aus den Antworten werden positive oder negative Gefühle, stereotypisierende Zuschreibungen oder beispielsweise Befürwortung oder Ablehnung von Segregation gelesen, die auf positive oder negative Einstellungen schließen lassen (vgl. ebd.; Goebel 2002, S. 47f).
Soziale Distanzskalen messen die Bereitschaft der beforschten Personen, Menschen mit Behinderung als Gegenüber in verschiedenen sozialen Situationen (z.B. als EheparterIn, als ArbeitskollegIn oder NachbarIn) zu akzeptieren. "Jede der vorgegebenen Rollen repräsentiert eine bestimmte Stufe der sozialen Nähe beziehungsweise der sozialen Distanz. Eine hohe Bereitschaft wird als positive Einstellung gewertet, ein geringer Grad an Bereitschaft als negative Einstellung." (ebd., S. 48)
Projektive Verfahren, die laut Tröster nur selten zur Anwendung gebracht werden, arbeiten mit indirektem Stimulusmaterial, zum Beispiel Fotos von Menschen mit Behinderung, auf die die Befragten spontan reagieren sollen. Aus diesen Reaktionen werden dann Rückschlüsse über Einstellungen gezogen. Dadurch soll das Problem der sozialen Erwünschtheit von Antworten umgangen werden (vgl. Tröster 1988, S. 20).
Besonders in den USA sind standardisierte Skalen zur Messung von Einstellungen üblich. Als Ziel wird eine "zuverlässige Quantifizierung der individuellen oder gruppenspezifischen Einstellungen" (Goebel 2002, S. 48) gegenüber Menschen mit Behinderung angestrebt. Auf einer mehrteiligen Skala wird der Grad der Ablehnung oder Zustimmung zu verschiedenen Aussagen angegeben. Durch die Kombination der Ergebnisse wird ein quantifiziertes Maß für Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung ermittelt (vgl. ebd.).
Speziell bei diesen hoch standardisierten und quantifizierenden Verfahren ist zu hinterfragen, ob Einstellungen in ihrer Komplexität so erfassbar sind. Meines Erachtens können Einstellungen nicht auf eine Dichotomie von positiv und negativ reduziert werden. Beim Einsatz von Einstellungsskalen werden Einstellungen der untersuchten Personen auf einem Kontinuum zwischen Ablehnung und Akzeptanz platziert. Einstellungen werden so zu einer eindimensionalen Größe. Goebel verweist darauf, dass die Möglichkeit einer Auswertung hinsichtlich der drei Komponenten von Einstellungen hier nicht gegeben ist. Es werden jedoch zunehmend differenzierte Skalen entwickelt, die sich besonders auf die affektive Komponente konzentrieren, die in diesem Kontext eine große Rolle spielt (vgl. ebd.; Tröster 1988, S. 21).
Die Erhebung von Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung wird von verschiedenen AutorInnen auch als problematisch eingestuft, wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird. Tröster (1988, S. 24f) etwa bringt hier den Einwand, dass die gängigen Forschungsmethoden in erster Linie verbal arbeiten. Die untersuchten Personen reagieren auf verbale Stimuli mit Antworten, aus denen eine Einstellung geschlossen wird. Hier stellt sich die Frage, ob in einer realen Begegnung mit Menschen mit Behinderung die gleichen Vorstellungen wirken wie in der Konfrontation mit dem Etikett "behindert" (vgl. ebd.). Cloerkes (2007, S. 111) ortet in der Einstellungsforschung eine Reihe methodischer Probleme. So bestehe die Gefahr der Verfälschung etwa durch zu kleine Stichproben, durch die verwendeten Messinstrumente oder auch durch Antworten, die in eine neutrale Mitte ausweichen oder durch eine Anpassung an soziale Erwartungen. Außerdem warnt er vor der Überschätzung des Faktors "Wissen" und der persönlichen Relevanz des Themas für die Befragten. "Die meisten Befragten kennen behinderte Menschen aber gar nicht hinreichend und erst recht nicht differenziert nach Art der Behinderung" (ebd.). Diese Problematik lässt sich in einer Untersuchung, die an einem qualitativen Forschungsparadigma orientiert ist, umgehen. Hier wird eine subjektive Deutung durch die Befragten ermöglicht, wodurch die Relevanz des Themas für das eigene Leben erschlossen werden kann. Außerdem ist es in diesem Fall kaum möglich, "neutral" zu antworten.
4.4.2.2.1 Personalisierungseffekt
Einen Mechanismus, der durch die Verwendung von verbalen Stimuli in der Einstellungsforschung wirksam wird, beschreibt Tröster (1988, S. 27ff) als ‚Personalisierungseffekt'. Er bezieht sich dabei auf Untersuchungen, die zeigten, "dass die verbalen Reaktionen auf die Eigenschaft ‚Behinderung' negativer sind als auf eine Person, die diese Eigenschaft besitzt." (ebd.) Außerdem konnte gezeigt werden, dass Einstellungen einer konkreten Person gegenüber tendenziell positiver waren als einer Gruppe gegenüber. Cloerkes stellt hierzu fest:
"Dieser Personalisierungseffekt wird um so ausgeprägter sein, je konkreter, positiver und ‚als Person' der Behinderte wahrgenommen wird." (Cloerkes 2007, S. 112)
Hier wird deutlich, wie sorgsam in einer Untersuchung mit verschiedenen Labels umgegangen werden muss, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. In diesem Sinne sind derartige Erkenntnisse für die Analyse äußert hilfreich.
Dieser Effekt kann auch als Beleg für die Relevanz von Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung gedeutet werden. Die Unterschiede in den Einstellungen je nach dem, ob nach einem konkreten Menschen oder der abstrakten Kategorie "behindert" gefragt wurde, machen klar, dass die Schaffung vielfältiger Begegnungsräume zwischen Menschen mit und ohne Behinderung dazu führen kann, mehr Bilder von konkreten Personen und Persönlichkeiten zur Verfügung zu haben und dadurch weniger auf allgemeine Vorstellungen von Behinderung zurück greifen zu müssen. In dieser Argumentation müsste Integration von Menschen mit Behinderung zu einer positiven Veränderung der Einstellungen führen. Die empirische Überprüfung dieser These wird an anderer Stelle dargestellt (siehe Punkt 4.4.3.1.4).
4.4.2.2.2 Sympathieeffekt
In einigen Untersuchungen (z.B. Schreier et al. nach Tröster 1988, S 29), die sich mit der sozialen Reaktion auf Menschen mit Behinderung beschäftigten, wurden Tendenzen entdeckt, die Leistungen von Menschen mit Behinderung positiver zu bewerten als die von Personen ohne Behinderung. Allerdings ließ sich dieser Effekt nur in Bezug auf Menschen mit Körperbehinderung nachweisen (vgl. Cloerkes 2007, S. 112). Offen bleibt, ob dieser Effekt auch für Einstellungen gegenüber Menschen mit so genannter geistiger Behinderung bedeutsam ist. Der Sympathie-Effekt kann mit dem Phänomen der sozialen Erwünschtheit erklärt werden:
"Demnach sind Nichtbehinderte bestrebt, sich in sozial erwünschter Weise darzustellen und insbesondere eine mit der Abwertung der behinderten Person verbundene offene Verletzung sozialer Normen zu vermeiden." (Goebel 2002, S. 50)
Behinderung konstituiert sich in einem Spannungsfeld von Norm und Abweichung. Dementsprechend haben soziale Normen auch einen enormen Einfluss auf Einstellung und Verhalten. Diese verbieten es, sich negativ über Menschen mit Behinderung zu äußern. Dadurch wird eine Messung von Einstellungen und dementsprechend ein Zugang zu den kognitiven Strukturen der Befragten der erschwert.
4.4.2.2.3 Problem der Einstellungs - Verhaltens - Konsistenz
Die soziale Reaktion auf Menschen mit Behinderung besteht aus den beiden Komponenten Einstellung und Verhalten. Wie Cloerkes konstatiert, liegt vielen sozialpsychologischen Untersuchungen eine "Konsistenz-Konzeption" zugrunde:
"Menschen sind danach bestrebt, die einzelnen Komponenten ihrer Einstellungen in Übereinstimmung zu bringen und einheitlich, konsistent also, auf Einstellungsobjekte zu reagieren." (Cloerkes 2007, S. 112f)
Jedoch ist ein Kausalzusammenhang, der von negativen Einstellungen auf abwertendes Verhalten schließen ließe, nicht gegeben. Zwischen gemessenen Einstellungen und tatsächlichem Verhalten besteht eine gewisse Diskrepanz. Erklärt wird diese durch verschiedene Einflüsse, die auf eine verbale Einstellungsäußerung und konkretes Verhalten wirken. Während sich Äußerungen über eigene Einstellungen tendenziell an "sozialer Erwünschtheit" orientieren, sind für das tatsächliche Verhalten außerdem situationsbezogene Faktoren von Bedeutung (vgl. ebd.; Goebel 2002, S. 40f). Goebel resümiert folgendermaßen:
"Einstellung und Verhalten sind also als zwei Komponenten sozialer Reaktionen aufzufassen, die es jeweils separat zu erfassen gilt. Im Gegensatz zum Verhalten sind Einstellungen keine beobachtbaren Phänomene, sondern gedankliche Konstrukte, weshalb jeweils andere Erhebungsmethoden notwendig werden." (ebd., S. 41)
Tröster weist auf einen weiteren Aspekt der Problematik hin, von geäußerten Einstellungen auf Verhalten zu schließen: Wolle man aufgrund von Einstellungen Verhalten vorhersagen, so müssten in einer Interaktion mit Menschen mit Behinderung "die gleichen oder ähnliche stereotype Vorstellungen vehaltenswirksam werden, wie sie durch das ‚Label' (z.B. ‚Körperbehinderte', ‚Blinde') ausgelöst werden" (1988, S. 25). Wie bereits angesprochen, spielt die Bezeichnung in der Einstellungsforschung eine entscheidende Rolle. Inwiefern die durch die Forscherin oder den Forscher gewählte Benennung mit den stereotypen Bildern der Befragten übereinstimmt, wird für die Ergebnisse von großer Bedeutung sein. Außerdem ist mit Tröster davon auszugehen, dass in realen Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderung andere Mechanismen wirken, als bei einer Konfrontation mit der Kategorie ‚behindert' in einer alltagsfernen Untersuchungssituation (vgl. ebd.).
In einer Studie, die Tröster (ebd., S. 23) hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Einstellung und Verhalten analysiert, wurde das Pflegepersonal einer Klinik hinsichtlich ihrer Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung und deren Auswirkungen auf ihre Arbeit untersucht. Tröster kommt zu keinen übergreifenden Ergebnissen, die Aufschluss über den Zusammenhang zwischen den Einstellungen und effektivem beruflichem Handeln geben könnten. Allerdings wird auf die spezifischen Verhaltenskriterien, die hier zutage traten, hingewiesen. Solche speziellen beruflich bedingten Handlungsanforderungen werden, wie ich annehme, bei den RichterInnen ebenfalls zum Tragen kommen, da ihr Verhalten im beruflichen Kontext stark institutionalisiert und durch ihre Rolle sowie strukturelle Faktoren vorgegeben ist. Eine Diskrepanz zwischen den Einstellungen, die erhoben werden, und der tatsächlichen Handlung, also der Entscheidung, ist demgemäß zu erwarten. Im Rahmen dieser Arbeit wird es jedoch nicht möglich sein, dies an konkreten Fällen zu überprüfen.
Auch wenn verschiedene AutorInnen von tendenziell eher negativen Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung ausgehen (z.B. Tröster 1988, S. 21, Jansen 1972, S. 137), so kann nicht von allgemein beobachtbaren Einstellungen der imaginären Gruppe der "Behinderten" ausgegangen werden. In verschiedenen soziologischen und sozialpsychologischen Untersuchungen wurden einige für diese Einstellungen relevante Faktoren herausgearbeitet. Cloerkes (2007, S.105f) macht in seiner Analyse des derzeitigen Standes der Forschung folgende Determinanten von Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung aus: die Art der Behinderung, sozioökonomische Merkmale, Persönlichkeitsmerkmale und Kontakt. Von anderen AutorInnen wird außerdem ein Wissensfaktor als relevante Determinante genannt (z.B. Nickel 1999, im Internet; Goebel 2002, S. 43).
4.4.3.1.1 Art der Behinderung
Die Art der Behinderung stellt einen wichtigen beeinflussenden Faktor von Einstellungen dar, vor allem eingeschränkte Leistungsmöglichkeiten in gesellschaftlich hoch bewerteten Bereichen. Menschen mit körperlicher Behinderung wird mit weniger negativen Einstellungen begegnet als Menschen mit Lernschwierigkeiten und psychischen Beeinträchtigungen (vgl. Nickel 1999, im Internet; Tröster 1988, S. 21; Robinson et al. 2007, im Internet). Cloerkes spricht in diesem Kontext auch von einer "eventuell angenommenen Bedrohlichkeit für andere" (Cloerkes 2007, S.105). Diese ‚Bedrohlichkeit' könnte als Hinweis auf Angst und Schuldgefühle im Kontakt mit Behinderung und Abweichung gesehen werden. Die Visibilität einer Behinderung wird ebenso als Faktor beschrieben, der eine soziale Reaktion bedingt. Nur eine Behinderung, die als solche erkannt wird, kann dementsprechende Reaktionen hervorrufen (vgl. Goebel 2002, S. 47).
Die "Schwere" der Behinderung wird zusätzlich angeführt, jedoch für weniger bedeutend befunden (vgl. Cloerkes 2007, S. 105). Eine Kategorie "Schwere der Behinderung" verweist auf ein defektologisches Modell von Behinderung. Die Terminologie von leichter und schwerer Krankheit wird hier analog auf Behinderung übertragen: Menschen mit Behinderung werden so zu leicht oder schwer Kranken oder Behinderten. In diesem Sinne ist "Schwere von Behinderung" als Kategorie in derartigen Untersuchungen abzulehnen. Eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit einem medizinischen Modell von Behinderung, auf dessen Basis Untersuchungskategorien wie "Schweregrad der Behinderung" entwickelt werden, erfolgte in Abschnitt 3.1.1.
4.4.3.1.2 Sozioökonomische und demographische Faktoren
Zwischen Einstellungen zu Behinderung und Faktoren wie etwa Bildung, Schichtzugehörigkeit, Herkunft usw. konnten keine nennenswerten Zusammenhänge ausgemacht werden. Lediglich bezogen auf die Merkmale Alter und Geschlecht können signifikante Ergebnisse formuliert werden (siehe auch Aiken 2002, S. 120).
"Frauen scheinen Behinderte danach eher zu akzeptieren als Männer (...). Ältere Personen sind etwas negativer eingestellt als jüngere Personen, die Beziehung ist jedoch nicht linear, sondern hat ihren Höhepunkt bereits um die 50." (Cloerkes 2007, S. 105)
Als mögliche Erklärung für positivere Einstellungen von Frauen wird das Phänomen der sozialen Erwünschtheit im Antwortverhalten herangezogen: Demnach seien Frauen eher dazu geneigt, ihre Antworten an soziale Erwartungen anzupassen als Männer (vgl. Nickel 1999, im Internet; Jansen 1972, S. 33). Für den positiven Gipfel der Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung bei einem Alter von 50 Jahren wird weder von Cloerkes noch von den anderen AutorInnen (z.B. Goebel 2002, Nickel 1999), die sich mit dessen Arbeit auseinandersetzten, ein Erklärungsansatz geboten. In einer Studie jedoch, die sich mit den im Rahmen des British Social Attitude survey 2005 erhobenen Einstellungen und Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung befasst, werden mit zunehmendem Alter generell eher negativere Einstellungen geortet (vgl. Robinson et al. 2007, im Internet).
4.4.3.1.3 Persönlichkeitsmerkmale der EinstellungsträgerInnen
Die Persönlichkeit der EinstellungträgerInnen wird in den verschiedenen Studien ebenfalls hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Einstellung untersucht. Ein Ansatz, der hier herangezogen wird, ist der der Autoritären Persönlichkeit nach Adorno. Demnach neigen Menschen mit einer autoritären Persönlichkeitsstruktur dazu, Menschen mit Behinderung negative Einstellungen und Vorurteile entgegenzubringen. Aber auch andere Persönlichkeitsfaktoren, wie Ich-Schwäche, Angst, Ambiguitätstoleranz und Dogmatismus spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle (vgl. Nickel 1999, im Internet; Güttler 2003, S.119ff). Allerdings stellt eine individualistische Sichtweise auf den Zusammenhang zwischen Einstellungen und Persönlichkeitsmerkmalen eine unzulässige Verkürzung da. Wie Nickel argumentiert, lassen sich auch diese persönlichen Faktoren nur in einem sozialen Kontext erklären:
"Persönlichkeiten wie Persönlichkeitsmerkmale sind Produkte von Sozialisationsprozessen. Mithin spiegeln sich gesellschaftliche Intentionen, Werte und Normen in Persönlichkeitsstrukturen wider, dies jedoch auf unterschiedlichste Weise. Autorität u.a. Persönlichkeitsstrukturen müssen somit als Produkte menschlicher Entwicklung in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext verstanden werden." (ebd.)
4.4.3.1.4 Kontakt
Der direkte Kontakt mit Menschen mit Behinderung wird von zahlreichen AutorInnen als wichtigste Determinante für Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung gesehen. Eine Vielzahl der von Cloerkes analysierten Untersuchungen basiert auf der These, dass Kontakte mit Menschen mit Behinderung die Einstellungen positiv beeinflussen. Je häufiger dieser Kontakt, desto positiver müssen dementsprechend die Einstellungen sein. Diese beiden Annahmen fasst Cloerkes zur "Kontakthypothese" zusammen. Er geht weiters davon aus, dass "in dieser einfachsten Form (...) die Kontakthypothese den allermeisten Arbeiten aus der Behindertenforschung zugrunde" (Cloerkes 2007, S. 146) liege. Jansen (1972, S. 29) beispielsweise geht von einer großen Relevanz des persönlichen Kontakts für die Einstellungen aus. Auch Robinson et al. finden in ihrer Studie diese Hypothese in Bezug auf Menschen mit psychischen Problemen bestätigt:
"Again we could draw some conclusions between a familiarity with mental health conditions and an increase in understanding and knowledge of mental health conditions." (Robinson et al. 2007, im Internet)
Allerdings kann der genannten Kontakthypothese nicht bedingungslos zugestimmt werden. Häufige, oberflächliche Kontakte führen eher zu einer Verstärkung von Vorurteilen als zu deren Abbau. Nicht die Häufigkeit von Begegnungen bestimmt die Qualität von Einstellungen, sondern deren Intensität. Je intensiver die Beziehung zu Menschen mit Behinderung ist, desto positiver gestalten sich demnach die Einstellungen. Außerdem beeinflusst eine gefühlsmäßige Bindung und die Freiwilligkeit des Kontaktes die Einstellungen positiv. Berufliche Kontakte sind aufgrund dieser mangelnden Freiwilligkeit positiven Einstellungen nicht zwangsläufig zuträglich (vgl. Cloerkes 2007, S. 147).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Kontakte mit Menschen mit Behinderung die Einstellungen zum Positiven hin verändern können, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Allerdings wird auch auf die Möglichkeit hingewiesen, dass sich Einstellungen in die entgegen gesetzte Richtung entwickeln:
"Eine ursprüngliche Einstellung tendiert dazu, sich bei Kontakt mit dem Einstellungsobjekt zum Extrem hin zu verstärken. Eine primär negative Einstellung kann durch Kontakt noch unterstrichen werden. Eine primär positive Einstellung wird hingegen durch Kontakterfahrungen weiter bestärkt." (ebd.)
Ein Zusammenhang zwischen Begegnungen mit Menschen mit Behinderung und den Einstellungen gilt als nachgewiesen. Wie gezeigt wurde, können diese nicht als Indiz für positive Einstellungen gewertet werden. Für diese Arbeit wird die Einschätzung der RichterInnen hinsichtlich der Bedeutung der Kontakte mit Menschen mit Behinderung auf ihre Bilder von Behinderung interessant sein.
4.4.3.1.5 Wissen
Auch dem Faktor Wissen kann keine eindeutig positive Auswirkung auf Einstellungen nachgewiesen werden. So führt ein Mehr an faktischem Wissen über Behinderungen nicht zwingend zu positiveren Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung. Professionelle in der Behindertenhilfe, die ein breites Wissen über die Situation von Menschen mit Behinderung haben sollten, sind ebenfalls nicht frei von Vorurteilen und stereotypen Meinungen (vgl. Nickel 1999, im Internet; Goebel 2002, S 43).
Die VerfasserInnen der Deklaration von Madrid hingegen gehen davon aus, dass sich negative gesellschaftliche Einstellungen durch Wissensvermittlung verändern lassen:
"Öffentliche Bildung ist daher für die Unterstützung der Gesetzgebungsmaßnahmen und für ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse und Rechte von behinderten Menschen in der Gesellschaft und um Vorurteile und Stigmatisierung zu bekämpfen, die gegenwärtig noch existieren, notwendig." (Europäischer Kongress für Menschen mit Behinderung 2002, im Internet)
Diese Hoffnung der TeilnehmerInnen des Europäischen Kongress für Menschen mit Behinderung wird durch empirische Befunde nicht gestützt. Cloerkes sieht in den Ergebnissen der von ihm analysierten Untersuchungen zu Informationsprogrammen und deren Auswirkungen auf Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung keine Beweise für eine Nützlichkeit derartiger Strategien, sogar "gegenteilige Effekte" seien möglich (vgl. Cloerkes 2007, S. 145).
Jansen (1972, S. 138f) kommt in seiner Analyse der Tiefeninterviews, die auch hinsichtlich des Zusammenspiels der drei Einstellungskomponenten untersucht wurden, zum Schluss, dass neben der affektiven Komponente, deren Bedeutung von anderen AutorInnen (z.B. Cloerkes 2007) ebenfalls gewürdigt wurde, auch die beiden anderen Faktoren eine große Rolle in den Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung spielen. So wurden Handlungstendenzen in Richtung sozialer Isolierung und Kontaktvermeidung festgestellt. Positive Tendenzen innerhalb der konativen Komponente von Einstellungen wurden hingegen selten gefunden. Der kognitive Anteil der Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung beinhaltet in erster Linie Rationalisierungsmechanismen. Jansen beschreibt diese als "bipolar":
"Entweder werden Beeinträchtigungen durch Körperbehinderung geleugnet, es werden vielmehr den Körperbehinderten noch besondere Begabungen und Fähigkeiten zugeschrieben, oder aber es wird dem Körperbehinderten eine Vielzahl von negativen Persönlichkeitsmerkmalen nachgesagt." (Jansen 1972, S. 138)
Die Zuschreibung besonderer Fähigkeiten könnte mit dem oben ausgeführten Sympathieeffekt in Verbindung gebracht werden (siehe Punkt 4.4.2.2.2). Wie Jansen weiter argumentiert, dienen diese Rationalisierungsmechanismen der Entlastung, die durch die Verunsicherung und die Bedrohung der eigenen Identität in der Begegnung mit Menschen, die von wichtigen gesellschaftlichen Normen abweichen, nötig wird (vgl. ebd.). An dieser Stelle sei auf Abschnitt 3.1.4.2 verwiesen, der sich mit der Bedeutung von Angstabwehr in diesem Zusammenhang auseinandersetzt.
Cloerkes (2007, S. 149) verglich Studien, die sich speziell mit Einstellungen von verschiedenen Berufsgruppen befassen. Dabei finden Untersuchungen, die sich mit Beschäftigten im medizinischen, pädagogischen oder sozialen Bereich auseinandersetzen, Eingang. Für Krankenhauspersonal, das in ihrer Arbeit mit Menschen mit Behinderung in Kontakt kommt, konnten teils positive, teils negative Einstellungen, ähnlich den Ergebnissen in der Durchschnittsbevölkerung, erhoben werden. PädagogInnen in Sonderschulen weisen zwar günstigere Einstellungen als LehrerInnen in anderen Schulen auf, es wurde aber auch eine Reihe negativer Einstellungen und Vorurteile nachgewiesen. Am vergleichsweise positiv eingestellt waren in den verwendeten Untersuchungen "Professionelle Helfer im sozialen Bereich" (ebd.).
Für RichterInnen gibt es (noch) keine Studien dieser Art. In dieser Arbeit wird auch keine allgemeingültige Aussage über Einstellungen dieser Berufsgruppe möglich sein. Die jeweils subjektive Erfahrungswelt der befragten Personen und deren spezielle Rolle im Kontakt mit Menschen mit Behinderung sind hier von Interesse.
Das Verständnis von Behinderung im wissenschaftlichen Diskurs hat sich in den letzten Dekaden nachhaltig verändert. Wurde vor einigen Jahrzehnten noch flächendeckend von einem medizinischen Modell ausgegangen, so hat sich in den Wissenschaften, die sich mit Menschen mit Behinderung beschäftigen, in den letzten zwei Jahrzehnten ein neues Bild von Behinderung als soziales Phänomen etabliert. Hier stellt sich nun die Frage, inwiefern diese Veränderungen sich auch in den Einstellungen der Menschen manifestieren.
Klauß kommt im Rahmen seiner Untersuchung aus dem Jahr 1996 zu dem Ergebnis, dass es zwar eine Zunahme an Wissen über Behinderung und auch an Toleranz gebe, Verhaltensweisen und Zuschreibungen sich jedoch nicht grundlegend verändert haben (vgl. Klauß nach Nickel 1999, im Internet).
Breitenbach/Ebert (1997, S. 65f), die die Einstellungen von SchülerInnen gegenüber Kindern mit einer so genannten geistigen Behinderung untersuchten, kommen zu dem Schluss, dass sich die Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung zum positiven hin verändern. Diese Veränderung wird hier "mit der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit der freien Träger der Behindertenhilfe und verschiedener staatlicher Stellen, aber auch mit der verstärkten Rezeption des Themas ‚Behinderung' in die Lehrpläne der Schule begründet" (ebd., S. 66). Allerdings orten die Autoren gleichzeitig eine wachsende soziale Distanz zu Menschen mit Behinderung. Dieser Tendenz kann, wie in dieser Studie ebenfalls gezeigt wird, durch vermehrte Integrationsbemühungen und dadurch einer Zunahme an Begegnungsmöglichkeiten entgegen gewirkt werden (vgl. ebd.). Eine Untersuchung, die die Einstellungen von Lehrpersonen Kindern mit Behinderung gegenüber im Wandel der Zeit erforschte, wurde 1995 von Böttcher et al. durchgeführt. Demnach nahmen Vorurteile gegenüber Menschen mit so genannter geistiger Behinderung ab. Diese Tendenz war Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten gegenüber nicht so deutlich bzw. nicht erkennbar (vgl. Böttcher et al. nach Nickel 1999, im Internet).
Finkelstein (1980, im Internet) teilt Einstellungen zu Behinderung in drei Epochen ein. In der ersten Phase sind die Einstellungen vor allem geprägt durch die Vorstellung, die Menschen seien selbst schuld an ihrer Behinderung. "They were cripples because of their sins, wanton behaviour, etc., or because of the sins of their fathers." (ebd.) ‚Behinderung als Gottesstrafe' lautet der Tenor dieser Zeit, während in Phase 2 die dominierenden Einstellungen von Mitleid für die scheinbar leidenden, armen und hilflosen Menschen mit Behinderung geprägt war. In diese Phase fallen die Großinstitutionen für Menschen mit Behinderung, die sich mit einer Vielzahl an ExpertInnen um die Hilfebedürftigen kümmern. Die Phase 3 beginnt für Finkelstein, im Jahr 1980, gerade und ist gekennzeichnet durch eine "neue Generation von Einstellungen" (ebd.), die in der "Eliminierung von Behinderung" (ebd.) gipfeln soll. Allerdings findet Finkelstein in empirischen Studien eine Veränderung der Einstellungen nicht bestätigt. Die herangezogenen Untersuchungen verweisen großteils auf Einstellungen, die hier Phase 2 zuzuordnen wären (vgl. Siller nach Finkelstein, im Internet).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aus den Ergebnissen der sozialpsychologischen Studien eine, wenn auch nicht ganz eindeutige, Tendenz zu positiven Veränderungen der Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung deutlich wird. Allerdings ist diese auf der Verhaltensebene durch diese Studien nicht bestätigt. Die bereits behandelte Diskrepanz zwischen Einstellung und Verhalten bietet hier einen möglichen Erklärungsansatz.
Die Befunde der empirischen Sozialforschung geben einigen Aufschluss über gesellschaftliche Bilder von Behinderung. Inwiefern die dargestellten Ergebnisse in den Aussagen der im Rahmen dieser Arbeit befragten RichterInnen wieder zu finden sind, wird sich zeigen.
Empirischer Teil
Inhaltsverzeichnis
"Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen heraus' aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen." (Flick et al. 2007, S. 14)
Das Ziel qualitativer Sozialforschung ist es, Menschen in ihrer konkreten Situation zu erfassen und einen Einblick darin zu gewinnen. Dies wird mit Hilfe von Forschungsmethoden erreicht, die genau an dieser Stelle ansetzen. Als ein zentrales Merkmal qualitativer Forschung wird daher eine Orientierung am Alltagsgeschehen der untersuchten Menschen gehandelt:
"Humanwissenschaftliche Gegenstände müssen immer möglichst in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld untersucht werden." (Mayring 2002, S. 22)
Die Aussagen werden in ihrem jeweiligen Kontext und als ein Teil einer ganzen Person gesehen. Die Perspektive dieser Person ist hier von Interesse und die Hypothesen und Vorannahmen der Forschenden treten in den Hintergrund. Ein weiteres zentrales Kriterium qualitativer Forschung stellt die "Gegenstandsangemessenheit der Methoden" (Flick et al. 2007, S.22) dar. Die Methode muss sich am zu untersuchenden Problem orientieren und dementsprechend gewählt werden. Auch die Kombination von Methoden ist, falls die Fragestellung dies nahe legt, in qualitativer Forschung durchaus legitim (vgl. ebd.). Diese Angemessenheit der Methoden gründet sich auf einem Prinzip der Offenheit, das in der qualitativen Forschung gefordert wird:
"Der Forschungsprozess muss so offen dem Gegenstand gegenüber gehalten werden, dass Neufassungen, Ergänzungen und Revisionen sowohl der theoretischen Strukturierungen und Hypothesen als auch der Methoden möglich sind, wenn der Gegenstand dies erfordert." (Mayring 2002, S. 28)
Diese Offenheit geht mit einer Flexibilität in der Durchführung der Untersuchung einher. Der Gefahr der Willkür, die dadurch entstehen kann, wird durch strenge Methodenkontrolle entgegengewirkt. Das Verfahren wird durch begründete Regeln geleitet. Alle Schritte im Forschungsprozess müssen expliziert und dokumentiert werden, damit diese transparent und nachvollziehbar werden (vgl. ebd. S. 29; Lamnek 2005, S. 350).
"Forschung wird als Interaktionsprozess aufgefasst, in dem sich Forscher und Gegenstand verändern." (Mayring 2002, S. 32)
Gegenstände qualitativer Forschung können nur in der Kommunikation mit Menschen zugänglich gemacht werden. Der oder die Forscherin muss sich dazu in eine Interaktionssituation begeben, um zu den Bedeutungsstrukturen Zugang zu bekommen. Dabei sind sowohl der oder die Forscherin als auch die zu untersuchende Person an der Konstitution der Situation beteiligt. Somit werden auch ForscherInnen zu Teilen des Forschungsprozesses und auch der Ergebnisse (vgl. Lamnek 2005, S. 350). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, als WissenschaftlerIn die eigene Position im Forschungsprozess sowie die Vorannahmen über den Gegenstand zu reflektieren und zu explizieren (vgl. Flick et al. 2007, S. 23). Qualitative Forschung orientiert sich am Einzelfall und will diesen in seiner Komplexität erfassen (vgl. ebd.). Von diesen Erkenntnissen aus Einzelfallanalysen kann in weiterer Folge, unter kontrollierten Bedingungen, mit induktiven Verfahren zu Verallgemeinerungen gefunden werden (vgl. Mayring 2002, S. 36).
In dieser Arbeit sollen die Einstellungen von RichterInnen gegenüber Menschen mit Behinderung sowie deren Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung im Kontext der Gerichtsverfahren zum Heimaufenthaltsgesetz erforscht werden. Wie im vorangegangen Kapitel gezeigt wurde, werden Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung vorwiegend mit quantitativen Erhebungs- und Auswertungsmethoden durchgeführt. Dabei sind die Bedingungen bei der Befragung im Idealfall bei allen teilnehmenden Personen gleich. Der Vorteil dieser Standardisierung zeigt sich in der Vergleichbarkeit der Ergebnisse durch die Minimierung verzerrender Einflüsse, etwa durch die Forscherin oder den Forscher (vgl. Flick et al. 2007, S.24f). Diese Einflüsse werden jedoch in einem qualitativen Forschungsparadigma nicht als störend, sondern als Erkenntnisquelle gesehen, wenn sie ausreichend reflektiert werden.
Die subjektiven Wertungen und Deutungen, die im Rahmen dieser Arbeit erforscht werden, lassen sich meiner Meinung nach mit Forschungsmethoden, die einem quantitativen Paradigma zuordenbar sind, nur unzureichend erschließen. In quantitativen Untersuchungen wird durch das hohe Maß der Standardisierung eine intersubjektive Vergleichbarkeit und Repräsentativität der Ergebnisse angestrebt. Allerdings sind durch diese Standardisierung sowohl in der Datenerhebung als auch in der (statistischen) Analyse die Besonderheiten des Einzelfalles nicht zu erschließen (vgl. Flick et al. 2007, S.24f). Die Studien, die im vorangegangenen Teil behandelt wurden, geben Aufschluss über allgemeine Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung. In dieser Arbeit jedoch sollen die Einstellungen der RichterInnen im Kontext des Heimaufenthaltsgesetzes im Mittelpunkt stehen. Um die Besonderheiten der einzelnen Personen mit ihren subjektiven Wahrnehmungen und Deutungsstrukturen erfassen zu können, wird hier deshalb eine qualitative Herangehensweise gewählt.
Jansen forschte in seiner Studie zur "Einstellung der Gesellschaft zu Körperbehinderten" (1972) vorwiegend quantitativ. Allerdings ergänzte er seine Untersuchung mit qualitativen Tiefeninterviews. Er begründet in Auseinandersetzung mit der Kritik am Einsatz qualitativer Interviews zur Erhebung von Einstellungen die Kombination qualitativer und quantitativer Methoden folgendermaßen:
"Wir glauben vielmehr, dass die Tiefeninterviews sehr wohl dazu geeignet sind, Hintergründe und Wechselwirkungen bestimmter Einstellungen, wie sie in standardisierten Verfahren ermittelt worden sind, zu erfassen." (ebd., S. 112)
In Analogie dazu fungieren die im vorigen Abschnitt dargestellten Ergebnisse quantitativer Einstellungsforschung als Anknüpfungspunkte für eine vertiefte Auseinandersetzung mit den jeweils eigenen Deutungen der befragten Personen.
Für diese Arbeit wurden qualitative Interviews mit fünf RichterInnen geführt. Die Methode hat sich, wie oben ausgeführt, am Forschungsgegenstand zu orientieren. Das Problemzentrierte Interview wurde gewählt, weil es für die hier zu behandelnde Fragestellung besonders angemessen erscheint. Die Gründe dafür werden im Folgenden erläutert.
Der Begriff wurde von Witzel (1982 nach Mayring 2002, S. 67) geprägt und meint halbstandardisierte, teilweise offene Formen der Befragung. Charakteristisch für Problemzentrierte Interviews ist die vorangegangene theoretische Auseinandersetzung der Forschenden mit der Problemstellung, auf deren Basis bestimmte Aspekte herausgefiltert werden und zu einem Interviewleitfaden zusammengestellt werden, der das Gespräch strukturiert (vgl. ebd.). Neben der genannten "Problemzentrierung" werden von Witzel zwei weitere Prinzipien dieser Methode benannt: "Gegenstandsorientierung" und "Prozessorientierung". Bei ersterem geht es um die Gestaltung der Erhebungsinstrumente, die sich auf den Gegenstand beziehen und an ihm entwickelt werden müssen. "Prozessorientierung" verweist auf den Forschungsprozess, der sich flexibel mit dem Problemfeld auseinandersetzt um nach und nach unter ständiger Reflexion der Methode die Zusammenhänge offen zu legen (vgl. Friebertshäuser 2003, S. 379).
Einem weiteren Prinzip qualitativer Forschung, das oben bereits behandelt wurde, wird hier große Bedeutung zugemessen: der Offenheit. Die Fragen dienen der thematischen Eingrenzung, werden aber offen formuliert und lassen so Raum für die subjektiven Deutungen der Befragten. Das theoretische Konzept der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers tritt in den Hintergrund und macht der "Bedeutungsstrukturierung der sozialen Wirklichkeit" (Lamnek 2005, S. 364) durch den oder die Befragten Platz. Diese soll durch einen Erzählanreiz, den die Fragen bieten, stimuliert werden (vgl. ebd.). Friebertshäuser macht außerdem darauf aufmerksam, dass im Umgang mit dem Interviewleitfaden eine gewisse Flexibilität gefordert ist. Er dient als Orientierungshilfe, in dem alle wichtigen Aspekte systematisch organisiert sind, darf jedoch nicht zu akribisch verfolgt werden:
"Allerdings soll dieser ‚leitende Faden' den Befragten nicht aufoktroyiert werden, sondern er dient vor allem der Unterstützung und Ausdifferenzierung von Erzählsequenzen des Befragten." (Friebertshäuser 2003, S. 380)
Der Leitfaden stellt nur ein Instrument des Problemzentrierten Interviews dar, das neben anderen zur Erfassung von Daten zum Einsatz kommt. Es besteht außerdem die Möglichkeit, dem Interview einen Kurzfragebogen vorzuschalten, um beispielsweise demographische Daten zu erhalten, die bei der Interpretation dann hilfreich sein könnten. Weitere Hilfsmittel sind Postskripte, die unmittelbar nach jedem Interview vom Forscher oder der Forscherin angefertigt werden, und all das festhalten, was nicht auf dem Tonband zu hören ist und trotzdem von Relevanz sein könnte: nonverbale Reaktionen, Rahmenbedingungen, Gespräche vor oder nach der Tonaufzeichnung, aber auch Erwartungen, Vermutungen oder Ahnungen der Forscherin oder des Forschers (vgl. ebd., S. 381; Lamnek 2005, S.367). Dies ermöglicht eine Reflexion der Rolle der WissenschaftlerInnen an der Konstruktion der Situation und des Ergebnisses.
Ein Problemzentriertes Interview läuft in verschiedenen Phasen ab, die durch jeweils spezifische Kommunikationsstrategien geprägt sind. Lamnek (2005, S. 365f) benennt in diesem Zusammenhang vier Phasen
-
Einleitung: Am Beginn des Gesprächs steht die Festlegung des Themas für das Interview und die Gestaltung einer "erzählenden Gesprächskultur" (ebd.).
-
Allgemeine Sondierung: Durch ein Erzählbeispiel soll nun die narrative Phase des Interviews eingeleitet werden. Die Befragten werden durch allgemeines Nachfragen dazu angehalten, detaillierte und ausführliche Beschreibungen ihrer Lebenswelt zu geben.
-
Spezifische Sondierung: In diesem Abschnitt des Interviews geht es um die Verständnisgenerierung durch die Forscherin oder den Forscher. Die Darstellungen der Befragten sollen nachvollzogen werden. Zu diesem Zweck bieten sich drei Möglichkeiten: In der Zurückspiegelung wird eine Interpretation des Gesagten angeboten, das durch den oder die Befragten kontrolliert und korrigiert oder modifiziert werden kann. Verständnisfragen bieten eine Möglichkeit beispielsweise ausweichende oder widersprüchliche Aussagen zu thematisieren. Die dritte Technik, die allerdings mit viel Sorgfalt eingesetzt werden will, ist die Konfrontation. Der oder die Interviewerin kann die Befragten direkt mit Widersprüchen in ihren Äußerungen konfrontieren (vgl. ebd.). Allerdings besteht hier die Gefahr, die vertrauens- und respektvolle Beziehung, die für ein gelingendes Interview nötig ist, zu zerstören (vgl. Nüesch 2002, S. 47).
-
Direkte Fragen: Hier bietet sich die Chance, eventuell noch nicht zur Sprache gebrachte, wichtige Aspekte direkt anzusprechen. Diese ‚Ad-Hoc-Fragen' werden durch die Interviewerin oder den Interviewer spontan eingebracht (siehe auch Mayring 2002, S. 70).
Resümierend lässt sich sagen, dass das Problemzentrierte Interview sich besonders für theoriegeleitete Untersuchungen eignet, wo spezifischere Fragestellungen auf Basis von bereits Bekanntem entwickelt wurden. Die teilweise Standardisierung durch den Leitfaden bietet einen weiteren Vorteil dieser Methode. Dadurch werden die Interviews leichter vergleichbar, ohne dabei die Darlegung der subjektiven Sicht der Befragten zu beschneiden (vgl. ebd.).
Aus diesen Gründen wurde das Problemzentrierte Interview in dieser Arbeit als Methode zur Gewinnung von Daten gewählt. Nach der theoretischen Auseinadersetzung mit der Thematik kristallisierten sich für mich die in der Untersuchung zu behandelnden Punkte heraus. Diese wurden zu Fragen konkretisiert und systematisch zu einem Leitfaden verbunden. Durch die starke Gegenstandsorientierung dieser Methode kann dieser speziell auf die Fragestellung dieser Arbeit zugeschnitten werden, und ermöglicht so eine gezielte Gesprächsführung mit den RichterInnen.
Der folgende Interviewletifaden wurde für diese Untersuchung entwickelt:
1. Erfahrungen mit Fällen zum HeimAufG allgemein
Welche Erfahrungen haben Sie mit den Fällen zum HeimAufG gemacht?
Welches sind die Besonderheiten dieser Fälle?
2. Erleben der Stellung von Menschen mit Behinderung in den Verfahren
Wie erlebten Sie die Menschen mit Behinderung in diesen Verfahren?
Welche Position haben Menschen mit Behinderung im Verfahren?
Wie erlebten Sie den Umgang der anderen AkteurInnen mit Menschen mit Behinderung?
Wie erlebten Sie die Menschen mit Behinderung in den Einrichtungen?
3. Entscheidung
Wie kamen Sie in den Fällen zum HeimAufG zu einem Beschluss?
Was war ausschlaggebend?
Welche waren Ihre Entscheidungskriterien?
Wie schätzen Sie Ihre eigenen Ansichten im Verhältnis zu denen der GutachterInnen ein?
4. Bedeutung von Behinderung
Was bedeutet Behinderung für Sie?
5. Kontakt
Hatten oder haben Sie außerhalb Ihrer beruflichen Tätigkeit mit Menschen mit Behinderung zu tun?
Welche Unterschiede erleben Sie zwischen beruflichen und privaten Kontakten mit Menschen mit Behinderung?
6. Auseinandersetzung mit Menschen mit Behinderung
Welche Gelegenheit hatten Sie, sich auf den Kontakt mit Menschen mit Behinderung vorzubereiten?
Welche Angebote gab es? Wie schätzen Sie diese ein?
Hätten Sie sich andere/weitere Angebote gewünscht? In welche Richtung?
Die Leitfadeninterviews werden außerdem mit einem vorangestellten Kurzfragebogen, der die Dauer der Tätigkeit als Richter oder Richterin allgemein sowie an diesem Gericht und die Zahl der behandelten Fälle zum HeimAufG abfragte, und Postskripts ergänzt.
Die Auswahl der zu befragenden Personen ergibt sich in dieser Untersuchung logisch aus der Fragestellung. RichterInnen, die in ihrer Funktion an Bezirksgerichten Fälle zum Heimaufenthaltsgesetz zu behandeln hatten, stellen die interessierende Gruppe dar. Allerdings gab es erst sehr wenige derartige Gerichtsverfahren in Westösterreich, was die Suche nach geeigneten InterviewpartnerInnen erschwerte, da an manchen Bezirksgerichten bis dato noch gar keine solchen Fälle angefallen waren. Um den Kontakt zu den betreffenden RichterInnen herzustellen, vermittelte die Bewohnervertretung. Weitere RichterInnen, die sich zu einer Teilnahme an dieser Untersuchung bereit erklärten, wurden durch telefonisches Anfragen an den Bezirksgerichten ausfindig gemacht.
Insgesamt wurden fünf Interviews geführt, drei mit männlichen und zwei mit weiblichen InterviewpartnerInnen. Die RichterInnen werden im Folgenden mit R1, R2 usw. abgekürzt.
Die Interviews wurden in den Räumlichkeiten der jeweiligen Bezirksgerichte durchgeführt. Um die Alltagsnähe der Interviewsituation zu gewährleisten fanden die Gespräche in der gewohnten Umgebung der RichterInnen statt.
Die Interviews dauerten alle zwischen 30 und 45 Minuten und wurden mit Hilfe eines digitalen Aufnahmegeräts aufgezeichnet.
Die Analyse der aus den Interview gewonnen Daten wird mit Lamnek, der eine "allgemeine Handlungsanweisung für die Auswertung" (Lamnek 2005, S. 402) anbietet, in vier Phasen unterteilt.
Dieser Schritt stellt die Basis für die weitere Analyse des Materials dar. Um die Daten verwenden zu können, muss das auf Tonband aufgezeichnete Gesprochene verschriftlicht werden. Die Sprache der RichterInnen war größtenteils sehr nahe an der Schriftsprache. Um die Transkripte lesbarer und verständlicher zu machen, wurden die einzelnen Dialektwörter, die vorkamen, ins Hochdeutsche übersetzt, da diese sprachlichen Besonderheiten hinsichtlich der Fragestellung wenig Relevanz haben. Bezüglich Satzbau und Formulierungen allerdings wurden Unvollständigkeiten beibehalten, um möglichst nah am Gesprochenen zu bleiben. Pausenfüller wie "Ähm", "Hm" und so weiter wurden, um die Lesbarkeit zu erhöhen, wie Pausen behandelt.
Nonverbale Elemente des Gesprächs finden ebenfalls Eingang in die Verschriftlichung, um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten. Dabei wurden folgende Transkriptionsregeln befolgt:
Tabelle 1: Transkriptionsregeln (vgl. Froschauer/Lueger 2003, S. 223f)
|
Pausen |
... (ein Punkt pro Sekunde) |
|
Nichtverbale Äußerungen |
(lacht) |
|
Auffällige Betonung |
betont |
|
Unverständliches |
(. . .) |
|
Vermuteter Wortlaut |
(etwa so) |
|
Situationsspezifische Geräusche |
>Telefon läutet< |
Anschließend wurden alle Informationen die Personen betreffend anonymisiert, bevor die Transkripte nochmals mit den Aufnahmen verglichen und korrigiert wurden.
In der zweiten Phase der Analyse nach Lamnek wendet man sich den einzelnen Interviews zu. Als erstes "werden Nebensächlichkeiten aus den einzelnen Abschriften entfernt, die zentralen Passagen dagegen hervorgehoben." (Lamnek 2005, S. 403) Nun werden die wichtigsten Teile des Transkripts entnommen und zu einem komprimierten Text zusammengefügt. Dieser wird nun unter Beachtung des Kontexts und des gesamten Interviews kommentiert und bewertet. Die Besonderheiten jedes einzelnen Interviews werden so extrahiert. Das Ergebnis der Einzelanalyse stellt eine Charakteristik der einzelnen Interviews dar, in der wörtliche Passagen der Befragung oder deren Zusammenfassung mit der Interpretation der Forscherin verbunden wird (vgl. ebd.).
"In Phase 3 der Auswertung blickt man über das einzelne Interview hinaus, um zu allgemeineren (theoretischen) Erkenntnissen zu gelangen." (ebd., S. 404)
In erster Linie wird nach Gemeinsamkeiten in allen oder auch einigen der Gesprächen gesucht, um zu generalisierenden Aussagen zu gelangen. Die Differenzen zwischen den einzelnen Interviews spielen aber in dieser Phase eine ebenso große Rolle und werden deshalb gesondert herausgestellt. Durch eine Kombination von Gemeinsamkeiten und Unterschieden soll eine Identifizierung von Grundtendenzen oder Syndromen möglich sein. Zur Darstellung und Interpretation der verschiedenen "Typen von Befragten, Aussagen, Informationen etc." (ebd.) werden erneut die Einzelfälle herangezogen.
Da es sich bei dieser Auswertungsstrategie um eine sukzessive Reduzierung des Materials handelt, besteht die Gefahr von Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund schlägt Lamnek vor, hier eine Kontrollphase einzuschalten. Im Idealfall wird diese in einem ForscherInnenteam durchgeführt, was im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist. Zur Kontrolle werden nochmals die originalen, vollständigen Transkriptionen herangezogen und die Interpretation daran auf ihre Stimmigkeit überprüft (vgl. ebd.).
Die dargestellte Auswertungsstrategie, die von Lamnek als "interpretativ-reduktive Form" (ebd., S. 402) bezeichnet wird, wurde hier gewählt, weil sie in meinen Augen eine logische Strukturierung des Auswertungsprozesses anbietet, die zu nachvollziehbaren Ergebnissen führt. Gerade in der Analyse von teilweise offenen Interviews ist ein methodisch korrektes Vorgehen nötig, um Willkür zu vermeiden und zu wissenschaftlich wertvollen Ergebnissen zu gelangen.
Besonders die Konzentration auf die einzelnen Fälle, die die zweite Phase in dieser Strategie darstellt, wird in dieser Arbeit von Relevanz sein. Ich finde es wichtig, der subjektiven Welt der einzelnen Persönlichkeiten, die hier befragt wurden, für sich einen Platz in der Analyse zu geben, bevor es zu einer Generalisierung und Abstrahierung kommt. Die Aussagen der RichterInnen sind geprägt von den je eigenen Erfahrungen mit den Fällen zum Heimaufenthaltsgesetz, deshalb findet dieser Kontext in der Darstellung der einzelnen Interviews seinen Eingang.
Inhaltsverzeichnis
In der empirischen Untersuchung wurden, wie bereits erwähnt, fünf Interviews mit RichterInnen durchgeführt. Diese werden mithilfe der vorher ausgeführten Auswertungsstrategie analysiert. Nach der Einzel- und Generalisierenden Analyse werden die Ergebnisse in Hinblick auf den theoretischen Bezugsrahmen, wie er im ersten Teil dieser Arbeit behandelt wurde, diskutiert.
Im Folgenden werden die Interviews einzeln analysiert und auf ihre charakteristischen Besonderheiten hin untersucht. Jedes Interview wird so in aller Kürze anhand ausgewählter Zitate und einer ersten Deutung durch die Forscherin dargestellt. Die Zitate aus den transkribierten Interviews werden kursiv dargestellt.
R1 ist seit 29 Jahren am selben Bezirksgericht tätig und hat sechs Fälle zum Heimaufenthaltsgesetz behandelt. Er beschreibt diese als äußerst komplex durch die vielen verschiedenen Beteiligten mit unterschiedlichen Interessenslagen. Die Position der Menschen mit Behinderung in diesen Verfahren bezeichnet R1 als "weit entrückt", weil es sich um Menschen handelt, "die unter Sachwalterschaft zu stellen sind". R1 geht davon aus, dass diese Menschen "mehrfach behindert betroffen sind, dadurch dass sie in einem Heim leben müssen, dass sie nicht mehr im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind, und dass ihnen dann noch auch durch freiheitsbeschränkende Maßnahmen..Eingriffe" widerfahren. Der Aufenthalt im Heim und die Freiheitsbeschränkung stellen also für R1 neben der mentalen Beeinträchtigung Aspekte von Behinderung dar. Außerdem gibt es in der Annahme freiheitsbeschränkender Maßnahmen durch die Menschen mit Behinderung Unterschiede, die in deren Persönlichkeit begründet liegen. Dabei kommt er auf die Problematik zu sprechen, dass er die Person ja nicht kenne und auch zu wenig Zeit hat, sich ein umfassendes Bild vom Menschen machen zu können. "Ist eine Chimäre, wenn man das meint, dass die Betroffenen ausreichend Zeit finden. Ist vielleicht auch gar nicht gewollt." Dass es möglicherweise nicht gewollt sei, ausgiebig auf die Person einzugehen, begründet R1 damit, dass es die Intention des Gesetzgebers sei, eine Freiheitsbeschränkung lediglich auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüfen zu lassen, und nicht mehr. R1 sieht in der Befassung mit dem Menschen selbst nicht den wichtigsten Aspekt seiner Arbeit: "die Betroffenen sind ja nicht das Allerzentralste". Mehr Bedeutung misst er der Feststellung des Sachverhaltes und "ablauftechnischen Dingen" zu, die "quasi anhand einer Checkliste" abgearbeitet werden müssen. Die Person der Bewohnerin oder des Bewohners spielt hier für R1 eine untergeordnete Rolle. Sie wird vom Sachverständigen auf Zurechnungsfähigkeit hin untersucht und beurteilt, die Perspektive des betroffenen Menschen bleibt dabei eine Nebensächlichkeit, was sich in Aussagen wie der folgenden niederschlägt: "dann bleibt noch ein bisschen die Frage offen, wie sieht sie denn selber die Beeinträchtigung".
Die eigene Entscheidungsfindung ist für R1 im Wesentlichen durch die Sachverständigenmeinung, die ihm "eine Brücke" zu Alternativen zur Freiheitsbeschränkung bauen kann, geprägt, die gesetzliche Interpretation und auch der "Eindruck der betroffenen Person" werden hier genannt. Hier wird wiederum deutlich, dass das Gewicht eindeutig auf ExpertInnen und deren Meinung liegt, die "einen wesentlichen Gesichtspunkt" bilden.
Behinderung bedeutet für R1 in seiner Rolle als Richter "die definierte Abweichung von einer Norm", die Frage, was Behinderung für ihn bedeute bezog er in erster Linie auf sein Amt. Die Norm wird durch den Gesetzgeber festgelegt, der jemanden als behindert "adressiert". In Abgrenzung dazu legt er auch seine persönliche Deutung "als Mensch" dar. So sieht er Behinderung als eine Funktionsbeeinträchtigung, "dass er gewisse Dinge nicht mehr so machen kann, wie ein durchschnittlich..körperlich, geistig trainierter Mensch". Hier werden Menschen an einem Leistungsdurchschnitt gemessen und dementsprechend bewertet.
Zum Kontakt mit Menschen mit Behinderung im privaten Bereich meint R1, er habe bis auf Beeinträchtigungen aufgrund von altersbedingter Demenz in seinem Umkreis keine Menschen mit Behinderung. Er kommt daraufhin zu dem Schluss, dass, sollte es doch einen Menschen mit Behinderung in seinem Umfeld geben und er diesen hier nicht benennen könne, das darauf zurück zu führen sei, "dass er mir nicht, nicht dramatisch genug ist, dass mir das einfällt, dass es eine gewisse Normalität ist". Er kann sich also durchaus vorstellen, dass Menschen mit Behinderung in seiner Umgebung ein Leben wie andere auch führen und ihm ihre Behinderung deshalb nicht auf Anhieb bewusst ist.
Auf die Frage nach spezieller Vorbereitung auf die Thematik sagt R1, es gebe sehr wohl Vorträge, allerdings sei für ihn der Umgang mit Menschen mit Behinderung im Kontext dieser Verfahren nicht "so speziell und diffizil bewusst". Aus der Praxis als Rechtspraktikant und der späteren Tätigkeit als Richter bezieht er seine Erfahrungen, aufgrund derer er handelt.
R1 geht die Fälle zum Heimaufenthaltsgesetz, wie aus seiner dargestellten Sicht der Dinge zu erschließen ist, sehr pragmatisch an. Er nimmt sich so viel Zeit für die Auseinandersetzung mit der Person, wie unbedingt nötig, und wendet sein Hauptaugenmerk auf die formelle Abwicklung des Verfahrens. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit Menschen mit Behinderung wird vermieden. R1 fühlt sich scheinbar sicherer, wenn er mit seiner "Checkliste" die formalen Aspekte dieser Verfahren bearbeiten kann. Diese Tendenz wird ebenfalls von Hofinger et al. (2007, im Internet) geortet. Dort wird ein "Rückzug auf ‚Formalia' auf Seiten der Richter" (ebd.) als Strategie, die rechtliche Position im Widerstreit der verschiedenen Interessen zu vertreten, bewertet. Im Fall von R1 würde ich dieses außerdem als Möglichkeit sehen, sich vor einer persönlichen Auseinandersetzung zu drücken. Dies kann als Ausdruck negativer Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung gedeutet werden, der in der Strategie, Begegnungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren, sichtbar wird. Interaktionsvermeidung wird ebenfalls in den oben behandelten Studien der Einstellungsforschung als wichtiges Moment der Handlungskomponente von Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung gehandelt (siehe Punkt 4.4.3.2).
Aus der fehlenden Auseinandersetzung mit der Person ergibt sich auch seine Perspektive auf die Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung, die hier als Objekte im Verfahren betrachtet werden. Wie in Abschnitt 3.1.1 dieser Arbeit ausführlich erläutert wurde, wird in einem medizinischen Modell von Behinderung davon ausgegangen, dass ÄrztInnen die Situation von Menschen mit Behinderung am besten beurteilen und ermessen können, was für die betreffenden Personen ‚das Beste' sei. Eine Orientierung an diesem Modell kann deshalb bei R1 angenommen werden: Die Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung finden als Subjekte in seinen Verfahren wenig Raum und werden als Objekte von ExpertInnen begutachtet.
Die Definition von Behinderung, die R1 hier gibt, ist von der Dichotomie von Norm und Abweichung geprägt. Bemerkenswert ist hier die Erwähnung des Zuschreibungsprozesses, der Menschen zu ‚Behinderten' werden lässt: "ein Normgeber adressiert jemanden als behindert". Diese Aussage könnte einer Einstellung zugeordnet werden, die Behinderung als soziale Kategorie handelt. Behinderung wird hier als "gesellschaftlich hergestelltes Phänomen" (Schillmeier 2007, S. 79), das durch Zuschreibungsprozesse durch eine Autorität erst entsteht, beschrieben. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass dies R1's Bild von Behinderung entspricht: Die oben genannte Beschreibung stellt die für sein Amt als Richter relevante, offizielle Definition von Behinderung dar. Für ihn ganz persönlich bedeutet Behinderung eine Funktionsbeeinträchtigung, eine Abweichung vom leistungsmäßigen Durchschnitt. Dies verweist eindeutig auf ein defektologisches Bild von Behinderung. Wie unter Berücksichtigung des gesamten Interviews angenommen werden kann, entspricht dies eher der handlungsleitenden Maxime in der Arbeit von R1 mit Menschen mit Behinderung.
Seinen privaten Bereich betreffend stellt R1 Überlegungen an, die in Richtung von aktiver Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben weisen. Er kann sich vorstellen, dass in seiner Umgebung Menschen mit Behinderung leben, ihm deren Beeinträchtigungen aber nicht bewusst wird, weil sie im Kontext der Begegnungen nicht von Relevanz sind. Allerdings überträgt er, wie es den Anschein hat, diese Überlegungen nicht auf die Menschen mit so genannter geistiger Behinderung, mit denen er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit zu tun hat. Sie bleiben für ihn Objekte des Verfahrens und werden nur bedingt als aktiv gestaltende Subjekte wahrgenommen.
Ein Problem der Einstellungsforschung, das Cloerkes (2007, S. 111) im Zusammenhang mit der Untersuchung von Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung beschreibt, ist jenes der mangelnden Relevanz der Thematik für die Befragten. Diese lässt sich auch bei R1 erkennen, er behandelt die Fälle zum Heimaufenthaltsgesetz mit einer Selbstverständlichkeit, ohne über die Menschen mit so genannter geistiger Behinderung im speziellen nachgedacht zu haben. Ihm war, wie er sagt nicht bewusst, dass an diesen Fällen etwas "speziell und diffizil" sein sollte. Als abschließenden Satz in dem Interview fügt er hinzu: "ich habe das ganz interessant gefunden, das einmal zu reflektieren zu müssen und zu sollen. In diese Position kommt man eh sehr selten". R1 empfand das Interview also als Chance, diese Thematik für sich selbst zu reflektieren, was als Zeichen in Richtung einer positiven Veränderung der Einstellungen gedeutet werden kann. Reflexion und Auseinandersetzung stellen in meinen Augen die Basis für eine differenzierte Betrachtungsweise des Phänomens Behinderung dar.
R2 ist seit 35 Jahren Richter und war in seiner aktiven Zeit immer am selben Bezirksgericht tätig. An seinem Gericht waren drei Fälle zum Heimaufenthaltsgesetz anhängig. Zu seinen Erfahrungen mit diesen Fällen merkte R2 als erstes an, "was ich positiv finde, ist dass man angehalten ist, rasche Entscheidungen zu treffen". Außerdem findet er, dass das Vorgehen in diesen Fällen sehr klar und einfach geregelt ist und bewertet dies positiv. Die gute Kooperation mit der Bewohnervertretung mache es ihm möglich, sich genug Zeit für die Auseinandersetzung mit den Betroffenen zu nehmen. Diese Fälle zum Heimaufenthaltsgesetz stellen für R2 Angelegenheiten dar, die äußerst ernst genommen und zum Wohl der BewohnerInnen möglichst schnell abgewickelt werden müssen.
Auf die Frage, ob und wie die Perspektive der Menschen mit Behinderung in die Verfahren Eingang findet, gibt R2 an, das sei das erste, was er mache, "wenn ich so eine...Meldung auf den Tisch bekomme, dann fahre ich hin..und dann suche ich den einmal auf, die Person einmal auf." Das persönliche Gespräch mit den betroffenen Menschen mit Behinderung ist für R2 von großer Bedeutung. Außerdem weist er immer wieder darauf hin, wie wichtig er es findet, sich Zeit zu nehmen und sich auf die Person einzulassen: "wenn man sich Zeit nimmt, kann man kommunizieren und das geht schon". Aus diesem Zitat geht ebenfalls hervor, dass R2 durchaus auch Schwierigkeiten in der Kommunikation mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung sieht, wenn er sagt, kommunizieren "geht schon". Außerdem sei R2 bemüht, den Menschen, um den es geht, am gesamten Verfahren teilnehmen zu lassen. Die betroffene Person soll dabei wissen, dass es um sie oder ihn geht. Seiner oder ihrer Stimme soll in dem Verfahren auch Gehör verschafft werden: "der kann ja das sagen, gerade wenn es eine Freiheitsbeschränkung ist, er weiß ja, um was es geht". Die Mitteilung der Entscheidung in einer Art und Weise, dass sie auch verstanden werden kann, ist für R2 eine Herausforderung, bei der er "über seinen eigenen Schatten springen" muss.
Bei genauerem Nachfragen nach Schwierigkeiten in der Kommunikation, meint R2 er habe aufgrund seines eigenen Alters kein Problem mit alten Menschen oder mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung zu reden. Als wichtig empfindet er, sich genügend Zeit zu nehmen für das Gespräch und dafür, "dass sich der an den Gesprächspartner gewöhnt, dass er da Vertrauen schöpft, dass er weiß..der will mir eigentlich helfen". Es ist ihm ein Anliegen, auf einer vertrauensvollen Basis mit den Menschen umzugehen und das Gefühl zu vermitteln, dass er es gut mit ihnen meint.
Einen Sachverständigen brauche man eigentlich dort, so erklärt R2, wo man allein nicht mehr weiter kommt. In diesen Fällen werden Sachverständige aus dem medizinischen oder pflegerischen Bereich herangezogen, die die Lage beurteilen, aber auch Alternativen aufzeigen. R2 beschreibt die Sachverständigen-Meinung als wichtig und etwas, an das er sich zu halten hat. Allerdings gibt er auch zu bedenken, "man darf auf seinen eigenen Hausverstand nicht vergessen". Dieser Hausverstand stellt für R2 ein wichtiges Entscheidungskriterium neben dem Gutachten und "rechtlich formellen Argumenten" in diesen Fällen dar.
Auf die Frage, was Behinderung für ihn bedeute, fand R2 nach einer kurzen Denkpause folgende Antwort: "Behinderung ist..auch eine, eine Art des Lebens, eine Art von Lebensumständen...wo die heutige Gesellschaft durchaus, Gott sei Dank,...vermehrt daran denkt, den Leuten mit Behinderung..auch ein ..akzeptables und lebenswertes Leben zu gestalten". Behinderung als Lebensform zu bezeichnen, lässt auf eine wertschätzende Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung schließen. Die Verantwortung der Gesellschaft für die Beseitigung von behindernden Umständen wird hier ebenfalls genannt. Behinderung stellt für R2 keine rein individuelle Kategorie dar, sondern wird in einem sozialen Kontext gesehen. Er befindet außerdem, dass sich in Richtung einer Verbesserung der Lebensumstände von Menschen mit Behinderung schon "sehr viel getan hat", wenngleich immer noch "sehr viel zu tun ist".
R2 glaubt nicht, dass eine "Chancengleichheit" zwischen Menschen mit und ohne Behinderung bestehe, als Beispiel nennt er die Schwierigkeiten für Menschen mit Behinderung eine Arbeitsstelle zu bekommen. Für R2 stellt also berufliche Integration eine gesellschaftliche Aufgabe dar, die noch ungenügend erfüllt wird. R2 beobachtet eine Veränderung in der Präsentation von Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit: "wenn ich mir die Sportevents anschaue, dass das Selbstwertgefühl von Menschen mit Behinderung doch stark im Ansteigen ist". Er sieht eine Veränderung im Selbstbild von Menschen mit Behinderung, die darauf basiert, "dass Leistungen, die von Menschen mit Behinderung erbracht werden,..hoch eingeschätzt werden". Die steigende Wertschätzung steht allerdings, wie R2 relativiert, in enger Verbindung mit der Leistungsfähigkeit. Menschen, die diesem Anspruch nicht entsprechen, zum Beispiel durch "die Behinderung im Alter", wenn "man wirklich..schwer, schwer behindert ist, dement und mit allen, mit allen Handicaps ausgestattet", findet er in den Familien und Heimen "eigentlich gut aufgehoben". R2 geht also davon aus, dass für Menschen mit schweren Behinderungen eine Unterbringung in Heimen eine gute Lösung sei.
R2 hat immer wieder auch privat Begegnungen mit Menschen mit Behinderung und engagiert sich bei Wohltätigkeitsveranstaltungen. Außerdem war er einige Jahre im Vorstand einer Organisation der Behindertenhilfe. Daher sagt er von sich: "Ja, ich habe schon in dem Bereich auch ...zu tun und habe da keine Berührungsängste. Das ist ein Vorteil." Durch seine vielfältigen Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung und auch seiner Beschäftigung mit deren Lebenssituationen in anderen Kontexten fällt ihm der Umgang mit Menschen mit Behinderung leicht. Er besucht die BewohnerInnen auch nach Abschluss der Verfahren noch in den Einrichtungen, wenn er dort in anderer Sache etwas zu erledigen hat.
Aus dem Interview mit R2 geht hervor, dass er ein echtes Interesse am Leben von Menschen mit Behinderung hat. Er nimmt sich in seiner Arbeit ausreichend Zeit, um die Menschen kennen zu lernen und sich auf sie einzulassen. Seine Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung kann als sehr positiv beschrieben werden. Hier kann eine Verbindung zu Cloerkes Analyse der Bedeutung von Kontakt mit Menschen mit Behinderung für die Einstellungen hergestellt werden (siehe Punkt 4.4.3.1.4). So treffen für R2 die Bedingungen für einen positiven Einfluss von Kontakt mit Menschen mit Behinderung auf die Einstellungen, nämlich Intensität und Freiwilligkeit des Kontakts (vgl. Cloerkes 2007, S. 147), zu. Durch sein ehrenamtliches Engagement begibt er sich auch außerhalb seiner beruflichen Tätigkeit in verschiedene Begegnungssituationen mit Menschen mit Behinderung, was, wie gezeigt wurde, zum Abbau von Vorurteilen und zu einer differenzierteren Betrachtung des Phänomens Behinderung führen kann. Im Falle von R2 würde ich dies auf jeden Fall als bestätigt ansehen. Er nimmt die BewohnerInnen als Personen wahr, mit denen er sich intensiv auseinander zu setzen hat und deren Sichtweise einen wichtigen Aspekt in der Beurteilung der Sachlage darstellen. Der oder die BewohnerIn wird von R2 als "Experte seiner selbst" (Hähner 1999a, S. 130) gesehen, der oder die auch in der Lage ist, sich zur Freiheitsbeschränkung zu äußern. In diesem Sinne kann dies als Versuch gesehen werden, den Menschen mit so genannter geistiger Behinderung mit den Möglichkeiten, die ihm im Rahmen seines Amtes zur Verfügung stehen, zu einem Stück Selbstbestimmung zu verhelfen.
Wie bereits angedeutet, wird Behinderung von R2 nicht als rein individuelle Kategorie begriffen, er setzt sie in einen sozialen Kontext, indem er von einer "Art des Lebens" spricht. Seine Forderung nach Chancengleichheit und Integration von Menschen mit Behinderung weist der Gesellschaft die Aufgabe zu, die "Bedingungen, die behindern" (Bosse 2006, S. 55) zu beseitigen. Dies kommt dem Inklusionsprinzip, das eine Änderung der Strukturen zugunsten einer Gesellschaft, in der für Menschen mit und ohne Behinderung ein gleichberechtigtes Leben möglich wird, impliziert, schon sehr nahe (siehe Punkt 3.1.4.3).
R2 schätzt außerdem Verhaltensweisen der BewohnerInnen, die als ‚behindert' bezeichnet werden, als Reaktionen auf behindernde Umstände ein. Wie gezeigt wurde, werden in einem medizinisch-heilpädagogischen Paradigma alle "abweichenden" Handlungen von Menschen mit so genannter geistiger Behinderung auf den Defekt zurückgeführt. Für R2 liegen die Gründe dafür oft in strukturellen Gegebenheiten, was an folgendem Beispiel veranschaulicht werden soll: "der ist aufgestanden in der Nacht und hat alle aufgeweckt...das war halt, mein Gott...das ist halt schwierig dann...(...)ist schwierig, ist schwierig, ja..aber man hat dann auch eine Möglichkeit gefunden, man hat heraus gefunden, der fürchtet sich einfach, wenn er da..wenn er sich eingesperrt fühlt". Hier wird sein Bild von Behinderung als soziales Phänomen im Gegensatz zu einer Bewertung als individuelles Problem erneut ersichtlich.
R3 ist eine junge Richterin, die seit ca. 5 Jahren in diesem Beruf tätig ist und bis jetzt mit einem Fall zum Heimaufenthaltsgesetz befasst war. Ihre Aussagen im Rahmen des Interviews sind von großer Unsicherheit im Umgang mit diesem Gesetz aber auch mit den Menschen mit Behinderung geprägt. Immer wieder beantwortet sie eine Frage mit einer Gegenfrage oder erkundigt sich am Ende ihrer Ausführungen noch danach, ob sie richtig geantwortet habe. Diese Verunsicherung kann einerseits auf ihre mangelnde Routine zurückgeführt werden, andererseits spielt hier, wie angenommen werden kann, das Problem der sozialen Erwünschtheit im Antwortverhalten, wie es von verschiedenen AutorInnen (z.B. Cloerkes 2007; Goebels 2002; Tröster 1988) diagnostiziert wurde, eine bedeutende Rolle. R3 versucht den Erwartungen der Forscherin zu entsprechen und passt ihre Antworten daran an.
Eine Besonderheit dieser Fälle stellt für R3 die totale Angewiesenheit auf dieSachverständigen dar. Der oder die Sachverständige ist dafür zuständig, den jeweiligen Menschen mit Behinderung zu beurteilen und so der Richterin oder dem Richter eine Basis für ihre oder seine Entscheidung zu liefern. R3 beschreibt die Problematik, über einen Menschen entscheiden zu müssen, ohne ihn oder sie wirklich zu kennen: "das habe ich also irgendwie schwierig empfunden, weil ich eigentlich Sachen entscheiden muss, wo ich sage, ich habe fast ein bisschen zu wenig Einblick in die Sache..also ich muss mich komplett auf die Sachverständigen verlassen".
Um sich selbst ein Bild von dem betroffenen Menschen zu machen, findet nur ein Gespräch statt, da es R3 für "oft gar nicht besonders sinnvoll, so ein Gespräch" befindet; mehr über die Situation erfahre sie durch ein Gespräch mit dem Pflegepersonal. Dieses wisse Bescheid über die Menschen und deren Situation. Im konkreten Fall zum Heimaufenthaltsgesetz, den R3 behandelte, war die Betroffene komplett aus dem Verfahren ausgeschlossen. Die Richterin begründet diesen Ausschluss mit einem Gutachten, außerdem verweist sie auf ihre Annahme, es sei "meistens so, dass die Personen das nicht mehr richtig mitkriegen..und eigentlich das besser ist, wenn sie nicht dabei sind." Auch weitere stereotype Bilder werden im Interview von R3 ausgesprochen, zum Beispiel: "demente Menschen leben meistens in einer eigenen Welt".
R3 erlebt die Entscheidungsfindung in diesen Fällen als schwierig und beschreibt "Bauchgefühl" als ein Element, das in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist. Außerdem ist sie sich nicht sicher, ob es "ganz eine hundert Prozent richtige Entscheidung" überhaupt geben kann in so einem Fall. In ihrer Rolle als Richterin und den damit verknüpften Aufgaben erlebt sich R3 hier ebenso als nicht sehr souverän: "Ich sehe das eigentlich auch schwierig, was meine Aufgabe ist zum Teil".
Auf die Frage, was für sie Behinderung bedeute, antwortete R3, wie so oft in diesem Gespräch, mit einer Gegenfrage. Im Anschluss trifft sie die Unterscheidung in körperliche und geistige Behinderung. Bei Menschen mit körperlicher Behinderung handle es sich um jemanden, "dem also irgendetwas fehlt, körperlich" zum Beispiel "wenn er beinamputiert ist und der Mensch mit Prothese gehen muss". Bei so genannter geistiger Behinderung greift R3 auf die gesetzliche Definition aus dem Sachwalterschaftsrecht zurück, "ob jemand in der Lage ist, seine Angelegenheiten nach Gefahr eines Nachteils für sich selber erledigen zu können oder nicht".
Ein Schwerpunkt im Interviewleitfaden bezog sich auf die Vorbereitung der RichterInnen auf die Fälle zum Heimaufenthaltsgesetz. R3 vermisst eine Vorbereitung in der Ausbildung auf die Herausforderungen in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Ihr fällt der Umgang mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung schwer, "weil ich nicht gewusst habe..wie ich mit den Menschen umgehen soll, was kann ich reden mit ihnen, wie fange ich ein Gespräch an". Die Kommunikation mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung erlebt R3 als sehr schwierig. In dieser Richtung hätte sie sich Angebote gewünscht, die darauf vorbereiten. Außerdem denkt R3, dass ein größeres Wissen über verschiedene "Krankheiten" ihr die Arbeit erleichtern würde. Aus diesen Aussagen lässt sich ein defektologisches Verständnis von Behinderung heraus lesen.
Die Situation von Menschen mit Behinderung in den Heimen beschreibt R3 als durchaus zufrieden stellend, sie findet die Bewohner dort "gut betreut". Dem Personal spricht sie die Kompetenz zu, zu wissen, wie mit Menschen mit Behinderung umzugehen sei: "gerade beim Betreuungspersonal merkt man halt immer, dass die genau wissen..also wenn sie einen Menschen kennen, dass sie schon wissen, wie sie, was sie ansprechen, was sie nicht ansprechen..was sie dem Menschen zutrauen können oder nicht". Das Betreuungs- und Pflegepersonal verfügt über Expertenwissen zum Umgang mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung.
Die eingangs erwähnte Verunsicherung R3's bezieht sich nicht nur auf ihr Verhalten in der Interviewsituation oder die Umsetzung des Heimaufenthaltsgesetzes. In ihren Ausführungen wird immer wieder deutlich, wie schwer ihr die Auseinandersetzung mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung fällt. Angst vor dem ‚Anderen' und ‚Fremden' scheint die Einstellung von R3 gegenüber Menschen mit Behinderung zu prägen. Mit Goffman gesprochen, erlebt diese Richterin die BewohnerInnen als "in unerwünschter Weise anders" (Goffman 1967, S. 13). Negative Einstellungen und stereotype Bilder von Behinderung, wie sie bereits aufgezeigt wurden, lassen sich als Folge dieser Ängste und Verunsicherung interpretieren.
In der sozialpsychologischen Literatur wird die Verteidigung der eigenen Identität als eine grundlegende Funktion von Einstellungen beschrieben (siehe Punkt 4.1.3). Insbesondere durch negative Einstellungen anderen Menschen gegenüber "lassen sich Ängste abwehren, innerpsychische Konflikte vermeiden, Minderwertigkeitsgefühle kompensieren" (Güttler 2003, S. 105).Im Falle von R3 kann davon ausgegangen werden, dass ihr Vorurteile und generalisierende Urteile über Menschen mit Behinderung helfen, mit ihrer eigenen Verunsicherung umzugehen. Das Gesetz und auch ihre internalisierte Rolle als Richterin geben ihr in den Fällen zum Heimaufenthaltsgesetz nicht genug Rückhalt, weshalb sie diese Verfahren auch als große Belastung erlebt.
Versucht man nun, die Aussagen R3's einem der Paradigmen in der Betrachtung von Behinderung, wie sie im theoretischen Teil dieser Arbeit behandelt werden, zuzuordnen, so findet sich einiges, das einem medizinischen Modell von Behinderung entspricht. In ihrer Definition von Behinderung beispielsweise steht der körperliche Defekt ganz klar im Mittelpunkt. Auf eine Darlegung ihrer persönlicher Meinung, was so genannte geistige Behinderung bedeute, verzichtet sie ganz und gibt stattdessen die gesetzliche Definition, die für sie und ihre Arbeit relevant ist. Daraus kann geschlossen werden, dass es auf Seiten dieser Richterin noch keine eingehende Reflexion der Problematik rund um Menschen mit so genannter geistiger Behinderung gab. Hier kann wiederum mit Cloerkes (vgl. 2007, S. 111) die Frage nach der persönlichen Relevanz der Thematik für die Befragte aufgeworfen werden.
R3 spricht in dem Interview außerdem von ihrem fehlenden Wissen über die "Krankheiten", das ihr den Umgang mit Menschen mit Behinderung erschwere. Diese Analogie von Krankheit und Behinderung passt zu einem medizinischen Modell von Behinderung ebenso wie die Annahme, dass mehr Wissen über die ‚Symptome' und Erscheinungsformen dieser ‚Krankheiten' für eine gelingende Kommunikation mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung nötig sei. Medizinische "Fakten" werden von R3 als relevant für die Gestaltung der Kommunikation erachtet. Eine angenommene Determinierung der Kommunikationsmöglichkeiten durch das "Krankheitsbild" spricht dem jeweiligen Menschen mit so genannter geistiger Behinderung seine oder ihre individuelle Kompetenz zu kommunizieren ab.
Auch die Konzentration auf das ExpertInnenwissen des Heimpersonals in der Beweisaufnahme, das im Gegensatz zur Perspektive der betreffenden BewohnerInnen großes Gewicht hat, kann als Indiz für eine Orientierung am medizinischen Modell von Behinderung gedeutet werden. R3 erachtet Gespräche mit den Menschen mit so genannter geistiger Behinderung als "oft gar nicht besonders sinnvoll", während ihr das Personal Auskunft über deren Situation geben kann. Menschen mit so genannter geistiger Behinderung werden hier, wie deutlich wird, als Objekte der Behandlung und Betreuung betrachtet, denen wenig eigener Gestaltungsraum zugestanden wird.
R4, ebenfalls eine sehr junge Richterin und seit fünf Jahren in diesem Beruf tätig, hatte mit einem Fall zum Heimaufenthaltsgesetz zu tun, die Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung, die zur Sprache gebracht werden, stammen großteils aus Sachwalterschaftsangelegenheiten. Sie erinnert sich an das eine Verfahren zum Heimaufenthaltsgesetz als sehr "langwierig" und "mühsam", allerdings weniger weil es rechtlich so schwierig gewesen wäre sondern weil "sich die beiden Sachverständigen total widersprochen haben". Für R4 war das Gutachten des medizinischen Sachverständigen, der sich für die Aufrechterhaltung der Freiheitsbeschränkung aussprach, "sehr gut und schlüssig begründet", während die Herangehensweise der "Sachverständigen aus dem Fachgebiet..Behinderten..betreuung", an die genaue Bezeichnung konnte sie sich nicht mehr erinnern, für sie nicht einleuchtend war. Eine klare Orientierung an einem medizinischen Paradigma wird hier deutlich: R4 hatte zwei Gutachten vorliegen, die sich klar widersprachen und folgte im Zweifelsfall dem medizinischen.
R4 fehlte eine Vorbereitung auf den Umgang mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung in ihrer Ausbildung, es gebe zwar Vorträge zu gesetzlichen Neuerungen, aber "wie man zwischenmenschlich auf solche Leute zugeht" müsse man im Job lernen. Die Befragung von Menschen mit so genannter geistiger Behinderung erfordere einen anderen Zugang, den R4 folgendermaßen beschreibt: "auf einer ganz einfachen Ebene, freundlich, dass er überhaupt etwas sagt, dass er sich nicht fürchtet". Die Kommunikation empfindet sie als schwierig, weil R4 oft nicht genau weiß, "was kann man sagen, wie kann man es erklären" und sie sich außerdem nicht sicher ist "was er nicht alles versteht", auch wenn sich der Bewohner oder die Bewohnerin nicht verbal artikulieren kann. Im Vorfeld werden stets Informationen über die Person beim Pflegepersonal eingeholt, R4 geht davon aus, dass die professionellen HelferInnen darüber Bescheid wissen, wie sie mit dem Menschen umzugehen hat. Um den Menschen mit Behinderung, mit dem sie von Amts wegen zu tun hat, zu schonen, vermeidet sie Wörter, die ihrer Meinung nach zu Verunsicherung führen könnten ("weil dann erwähne ich das Wort Gericht einfach nicht") , oder sie versucht "noch ein bisschen zu beschwichtigen, entweder nicht zu viel zu sagen oder dann doch das Ganze zu relativieren". Diese Strategie, die BewohnerInnen nicht gänzlich darüber aufzuklären, worum es geht, ist in Hinblick auf deren Rechte kritisch zu betrachten und kann als Infantilisierung von Menschen mit so genannter geistiger Behinderung gesehen werden.
Zur Position von Menschen mit Behinderung in den Verfahren gab R4 an, in ihrem Fall sei die betreffende Bewohnerin "teilhabend" gewesen, sie hätte "sich das von Anfang bis zum Schluss angehört". Allerdings denkt R4, dass es sich dabei um einen Ausnahmefall handle, da es den Betroffenen oft nicht zumutbar sei, am Verfahren teilzunehmen.
Behinderung"ist ein Schicksal", das man annehmen muss. Für R4 sind die Menschen mit Behinderung nicht die in erster Linie von Behinderung betroffenen. Die Angehörigen und das Umfeld seien die "Leidtragenden" einer Behinderung und die Betroffenen selbst "scheinen oft sehr zufrieden zu sein". Die Auseinandersetzung mit einer Beeinträchtigung schreibt sie also der Umwelt zu und nimmt in gewisser Weise eine Verantwortung von der Person. Außerdem sieht sie in unserer Gesellschaft eine Verdrängung von Menschen mit Behinderung aus der Öffentlichkeit: "Es ist auch leider..ein bisschen eine Tendenz, dass man sie versteckt, man sieht so wenig Behinderte, es gibt, glaube ich genug..die werden halt dann in eigene Schulen, Lebenshilfe.." geschickt. R4 bedauert die fehlende Integration von Menschen mit Behinderung im Alltagsleben, dieselbe Tendenz sieht sie auch bei alten Menschen: "man sperrt die Leute irgendwie weg". R4 hat in ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis keine Menschen mit Behinderung. Sie geht davon aus, dass, wäre dies der Fall, sie sich "öfter in solchen Einrichtungen" aufhalten würde und so auch mehr mit Menschen mit Behinderung konfrontiert wäre.
R4 macht immer wieder die Erfahrung, dass ihr diese "Schicksale" sehr nahe gehen und sie längere Zeit beschäftigen. Außerdem hat sie "manchmal das Gefühl, man muss, man soll ein bisschen zuhören". In manchen Fällen investiert R4 dann mehr Zeit als sie eigentlich müsste, um dem Menschen zu helfen. Dort lässt sich ein Bedürfnis sehen, für die Menschen noch etwas mehr zu tun, als nur ihre bloße Pflicht als Richterin zu erfüllen
Durch ihre emotionale Betroffenheit nimmt sich R4 Zeit, um den Menschen zuzuhören. Allerdings entsteht durch ihre Schilderungen der Eindruck, dass sie dies nicht unbedingt mit einer großen Wertschätzung der Menschen mit so genannter geistiger Behinderung zusammenhängt. Sie ist zwar bemüht, Gespräche mit den BewohnerInnen zu führen, allerdings mit bestimmten Vorbehalten. So versucht sie diese möglichst mit der Wahrheit zu verschonen beziehungsweise diese zu beschönigen, um sie nicht zu beunruhigen. So werden Menschen mit so genannter geistiger Behinderung nicht wie gleichberechtigte Erwachsene behandelt, sondern zu Wesen, die nicht alles ganz verstehen können, herabgewürdigt. Die Aussagen R4's scheinen von Mitleid mit den Menschen mit so genannter geistiger Behinderung geprägt zu sein, was einer Begegnung auf Augenhöhe im Weg steht, wie ich behaupten möchte. Ihre Einstellungen Menschen mit so genannter geistiger Behinderung sind, betrachtet man ihre Aussagen genauer, nur auf den ersten Blick positiv. Hinter ihrem Bemühen, die BewohnerInnen zu schonen, steckt, wie angenommen werden kann, die Haltung, sie würden nicht im Stande sein, die Wahrheit auszuhalten, was als Vorurteil, wie es in Punkt 4.2 dieser Arbeit definiert wurde, entlarvt werden kann.
In der geschilderten Auseinandersetzung mit den beiden sich widersprechenden Sachverständigen zeigt sich R4 nicht bereit, sich auf eine Perspektive einzulassen, die sich auf eine andere als die medizinische Ebene der Freiheitsbeschränkung bezieht. Für Fragen, die Menschen mit Behinderung betreffen, scheinen medizinische Argumentationen schlüssig und ausreichend, andere Faktoren, wie sie möglicherweise das zweite Gutachten liefern hätte können, waren für R4 weniger relevant. Behinderung und auch die Freiheitsbeschränkungen können für R4 mithilfe der Medizin beschrieben und beurteilt werden. Hier sei erneut auf das medizinische Behinderungsmodell verwiesen (siehe 3.1.1), das sich in diesen Ausführungen ihre Arbeit mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung betreffend, wiederfinden lässt. Gleichzeitig bedauert R4 jedoch die Unterbringung von Menschen mit Behinderung in Sondereinrichtungen und deren Absenz in der Öffentlichkeit. Die Verdrängung von alten Menschen und Menschen mit Behinderung aus dem öffentlichen Leben führt sie auf die Tendenz der Gesellschaft zurück, nicht mit Unangenehmen konfrontiert werden zu wollen. Diese Überlegungen, die R4 anstellt, könnten einem anderen Verständnis von Behinderung, das eine soziale Komponente beinhaltet, zugerechnet werden, wie es etwa in den Kapiteln 3.1.3 und 3.1.4 ausführlich behandelt wurde. In den Äußerungen der Richterin, die Menschen mit Behinderung im Kontext des Heimaufenthaltsgesetzes betreffend, bleibt jedoch das medizinische Modell das vorherrschende. Dort wo es konkrete Entscheidungen zu treffen gilt, ist eine Sichtweise, die auf medizinischen "Fakten", Diagnose und Prognose beruht, für R4 die attraktivere Alternative als eine Auseinandersetzung mit anderen Aspekten der Thematik.
R5 ist seit über 20 Jahren mit Außerstreit- und Familienrechtsfällen betraut. Zum Heimaufenthaltsgesetz hatte er bis jetzt "drei oder vier Fälle". Zu seinen Erfahrungen mit diesen Fällen sagt er, für einen Richter seien sie "belastend", weil so kurze Fristen einzuhalten sind. Weil er sobald ein Antrag kommt, "alles liegen und stehen lassen muss" empfindet er diese Fälle als "unangenehm". Grundsätzlich findet er eine Überprüfung von Freiheitsbeschränkungen wichtig, um missbräuchlichen Einsatz dieser Maßnahmen, zum Beispiel um Ruhe im Heim zu haben, zu verhindern. Er sieht auch eine gewisse präventive Wirkung des Heimaufenthaltsgesetzes. R5 beobachtet, "dass das Heim auch vorsichtig ist" um Gerichtsverhandlungen zu vermeiden.
Als schwierig erlebte R5 die Fälle zum Heimaufenthaltsgesetz dort, wo es um medikamentöse Freiheitsbeschränkungen ging. In diesen Fällen holt er sich einen Sachverständigen aus dem medizinischen Bereich zu Hilfe, im Gegensatz dazu "wenn es jetzt um Beeinträchtigungen geht in der Pflege, dann kann ich das..so wie es beim Bett ist, zum Beispiel..selber beurteilen". Sachverständige aus diesem Bereich sieht er nicht als unbedingt notwendig, sie "zeigen halt oft Alternativen auf". R5 verweist explizit darauf, dass er "aber nicht an einen Sachverständigen gebunden" sei, sondern eine eigene Entscheidung fällt.
Auf die Frage nach der Position der Menschen mit Behinderung in den Verfahren, erklärte R5: "Sie müssen da natürlich berücksichtigen, der ist in meinem Falle, in meinen gehabten Fällen geistig behindert". Näher geht er auf diese Frage nicht ein, er beschreibt allerdings weiter, wie er die Menschen mit Behinderung in den Heimen erlebte: "der erste hat einmal nur unverständliche Worte gesprochen und ist im Rollstuhl gesessen (...) Die andere hat nur gelacht und geschrieen, der andere ist halt im Bett gesessen und hat sich gefreut, dass ich die Hand geschüttelt habe". Dies erweckt den Eindruck, dass R5 sich nicht besonders intensiv mit der Situation dieser Menschen beschäftigt und ihnen nicht mit Wertschätzung entgegentritt. Dieser Eindruck erhärtet sich, nimmt man seine weiteren Äußerungen zu Menschen mit so genannter geistiger Behinderung dazu. So finden sich Stereotype wie "die Behinderten können ja furchtbar sich aufführen" oder "das kommt nämlich oft vor, dass die Geistigbehinderten einen Wandertrieb haben". Als Alternative für Freiheitsbeschränkung schlägt R5 etwas sarkastisch vor, mehr Betreuungspersonal für Menschen mit so genannter geistiger Behinderung zu Verfügung zu stellen: "wenn ich eine Person habe, nur für den..ich könnte sagen, der hält ihm die Hand, der lenkt ihn ab, der zeigt ihm irgendetwas zum Spielen", dann könnten auf Freiheitsbeschränkungen verzichtet werden. Hier kann eine infantilisierende Vorstellung von Behinderung ausgemacht werden, die R5 durch diese Aussagen zum Ausdruck bringt.
R5 wurde ebenfalls danach gefragt, wie er die Kommunikation mit den Bewohnern und Bewohnerinnen erlebte. Seine Antwort lautete, ein Gespräch mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung sei "zwecklos", da es "in den meisten Fällen" so sei, "dass die Betroffene, die im Heim ist, die geistig Behinderte oder der Behinderte die Sache ja gar nicht mitkriegen". R5 geht also davon aus, dass es nichts bringen würde mit den Betroffenen selbst zu sprechen, eine Auseinandersetzung mit der Person erachtet er als nicht notwendig. Worauf er allerdings dann doch Wert legt, ist, nicht zu unterschätzen, dass die Menschen manchmal mehr verstehen, als er dachte. Deshalb "muss man immer entsprechend höflich, also auch diesen Behinderten entsprechend höflich behandeln". Diese "höfliche Behandlung" macht er auch an einem Beispiel deutlich: "wenn einer ein bisschen behindert ist, wird er gleich..der Sachwalter mit Sie angeredet, der Behinderte mit Du und wenn der nicht viel behindert ist, dann sollte man den genauso höflich behandeln wie einen anderen". Interessant ist hier die Formulierung, dass mit Menschen, die "ein bisschen behindert" sind, ein höflicher Umgang gepflegt werden soll. Menschen, die er als ‚schwer behindert' klassifizieren würde, werden hier, so könnte dies gedeutet werden, ausgenommen.
Seine Definition von Behinderung wurde durch eine Unterscheidung in körperliche und geistige Behinderung eingeleitet, wobei R5 der Meinung ist, dass das Heimaufenthaltsgesetz von "Behinderung an sich" spreche. So genannte geistige Behinderung empfindet er als "bedauerlich", seine Ausführungen beziehen sich hauptsächlich auf die Suche nach den biologischen Ursachen "Geburtsfehler, Sauerstoffmangel, dann Genfehler, so wie da die Mongoloiden", außerdem differenziert er nach ‚Schweregraden' der Behinderung: "da gibt es starke, schwache Behinderte, also sehr und weniger sehr behindert". Er geht davon aus, dass Behinderung einen medizinisch feststellbaren und unveränderlichen Zustand darstellt: "ich weiß ja bei vielen, das ist ja medizinisch unmöglich, dass sich etwas ändert".
R5 gibt an, an Fortbildungsangeboten zum Thema Heimaufenthaltsgesetz kein Interesse zu haben. Seine eigene Beschäftigung mit dem Gesetz reicht ihm als Grundlage für seine Entscheidung, auch die Empfehlungen für die Auslegung des Gesetzes lässt er beiseite.
Wie bereits angedeutet, zeigt sich dieses Interview voll Vorurteilen. R5 lässt sich, wie aus den zahlreichen Aussagen über "die Behinderten" hervor geht, von generalisierten Annahmen über die imaginäre Gruppe der Menschen mit so genannter geistiger Behinderung leiten. So spricht er Menschen mit geistiger Behinderung eine gewisse Triebhaftigkeit sowie eine Analogie zum Verhalten von Kleinkindern zu. Individuelle Kompetenzen bleiben völlig unberücksichtigt, da für R5 nur die Behinderung und alle negativen Eigenschaften, die er damit verknüpft, im Zentrum des Interesses stehen. Hier sei auf die Stigmatheorie verwiesen, wie sie in Punkt 4.3 behandelt wurde. Für diesen Richter stellt die Behinderung, wie anhand seiner Aussagen geschlossen werden kann, das zentrale Merkmal eines Menschen dar, das alle anderen überschattet. (vgl. Hohmeier 1975, im Internet). Durch die negative Bewertung des Attributs findet eine Abwertung der ganzen Person statt. Ebendiese Abwertung ist bei R5 deutlich zu erkennen. Einen wichtigen Faktor in der Durchsetzung von Stigmata stellt Macht dar, welche auch in diesem Fall eine große Rolle zu spielen scheint. R5 fühlt sich den Menschen mit so genannter geistiger Behinderung sehr überlegen und äußert sich dementsprechend abfällig über diese Personen. Seine Schilderungen des eigenen Umgangs mit den BewohnerInnen gleichen einer Machtdemonstration, wie ich behaupten möchte. Stigmata erfüllen, wie Einstellungen im Allgemeinen, die Funktion, Ängste und Unsicherheiten zu vermindern und die eigene Identität durch Abgrenzung von stigmatisierten Personen zu schützen (siehe 4.3). Diese Tendenz lässt sich, meiner Einschätzung zufolge, bei R5 erkennen. In diesem Lichte ist möglicherweise auch sein Desinteresse an einer Auseinandersetzung mit den Menschen mit Behinderung zu sehen. Er erachtet es nicht für nötig, sich auf ein echtes Gespräch mit den BewohnerInnen einzulassen. So wird den Menschen mit so genannter geistiger Behinderung jedes Mitspracherecht abgesprochen, sie werden lediglich als Objekte betrachtet, über die es eine Entscheidung zu fällen gilt, und nicht als Personen wahrgenommen.
R5 sieht Behinderung als medizinisches Faktum, das diagnostiziert wird, dessen biologische Ursachen bekannt sind und als Grundlagen für Prognosen fungieren. Dies entspricht exakt Elberts "vier Operationsschritte des behinderten Selbst" (Elbert 1982, im Internet), wie sie die Genese von Behinderung in der psychiatrischen Tradition beschreiben. Behinderung wird auch bei R5 als pathologischer Zustand begriffen, der unveränderbar ist. Außerdem ist für R5 eine Klassifizierung nach der "Schwere" der Behinderung für den Umgang mit den Menschen mit so genannter geistiger Behinderung relevant. Anhand dieser und weiterer Schilderungen in diesem Interview liegt eine Zuordnung zu einem medizinischen Paradigma auf der Hand.
Im Rahmen der generalisierenden Analyse sollen nun Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen den einzelnen Interviews offen gelegt werden und so zu allgemeinen Erkenntnissen aus dieser Untersuchung verbunden werden. Die Kategorien, anhand derer dieser Analyseschritt durchgeführt wurde, entsprechen jenen im Interviewleitfaden. Gesondert behandelt werden im Anschluss die Zuordnung der Interviews zu den Paradigmen in der Betrachtung von Behinderung und eine Analyse hinsichtlich vorhandener Vorurteile und Stereotype gegenüber Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung.
In Bezug auf die Erfahrungen mit den Fällen zum Heimaufenthaltsgesetz sind die Meinungen der RichterInnen geteilt. Sowohl R1 als auch R2 spielen auf die Schwierigkeit an, die vielen verschiedenen Beteiligten unter einen Hut zu bringen. Während R1 von "sehr unterschiedlichen Interessenslagen zwischen Angehörigen, dem Bewohnervertreter, der dieses Gesetz zu vertreten hat, den Behinderten, den Betroffenen...dem..Heim" spricht, die zu einer "vielschichtigen Gemengelage" führen, sieht R2 eine "Diskrepanz" zwischen der Bewohnervertretung, die ihre Aufgabe sehr ernst nimmt, auf der einen Seite und dem Pflegepersonal und der Heimleitung, die der Meinung sind, "wir haben eh alles gemacht", auf der anderen Seite. Die Schwierigkeit besteht für ihn darin, "das Ganze auf eine sachliche Ebene zu führen". Dies entspricht den Aussagen der RichterInnen, die in der Implementierungsstudie zum Heimaufenthaltsgesetz befragt wurden. Dort wurde das Handhaben der oft aufgeheizten Stimmung und die Vermittlung zwischen den einzelnen Positionen ebenfalls als besondere Herausforderung dieser Fälle beschrieben (vgl. Hofinger et al. 2007, im Internet).
Vier der fünf befragten RichterInnen empfinden die Abwicklung der Fälle zum Heimaufenthaltsgesetz als nicht besonders schwierig. R2 spricht von einem klar und einsichtig geregelten Ablauf, wie auch R4, die diese Fälle "rechtlich nicht schwierig" findet, ähnliches ist auch von R1 und R5 zu hören. Eine Ausnahme bildet hier R3, die von einer großen Unsicherheit in der Handhabung des Heimaufenthaltsgesetzes berichtet: "das habe ich also irgendwie schwierig empfunden, weil ich eigentlich Sachen entscheiden muss, wo ich sage, da habe ich fast ein bisschen zu wenig Einblick". Die Gründe für diese Verunsicherung bei R3, die bei den anderen RichterInnen nicht deutlich wurde, können möglicherweise in ihrer Persönlichkeit oder auch der fehlenden Routine als Richterin gesehen werden. Allerdings treten bei tiefer gehender Analyse der Interviews auch in den anderen Interviews Momente der Verunsicherung zu Tage, insbesondere wenn es im Konkreten um den Umgang mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung geht. Dies wird jedoch an anderer Stelle noch gesondert dargestellt werden. Festzuhalten bleibt hier: Die Fälle stellen für vier der fünf RichterInnen, nach ihren Erfahrungen zum Heimaufenthaltsgesetz allgemein befragt, keine besondere Schwierigkeit dar, diese wird erst in den weiteren Schilderungen erkennbar.
Die im Heimaufenthaltsgesetz festgelegte schnelle Abwicklung der Verfahren wird unterschiedlich bewertet. Während sich R2 darüber sehr positiv äußert, findet R5 diese Dringlichkeit "unangenehm" und "belastend". Auch R4 spricht von einem "Terminstress", der durch die Dringlichkeit dieser Verfahren entsteht. R1 und R3 erwähnen die zeitlichen Bedingungen nicht, was darauf schließen lässt, dass diese für sie weniger Bedeutung haben. Die schnellen Entscheidungen sind für die Betroffenen sehr wichtig, da es um ihre Lebenssituation geht. Aus dieser Perspektive werden die kurzen Fristen auch von R2 begrüßt. R5 hingegen gibt seiner eigenen Befindlichkeit, nämlich der Wahrnehmung von erhöhtem Zeitdruck und Stress, Ausdruck.
Alle befragten RichterInnen begrüßen dieses neue Gesetz und betonen dessen Notwendigkeit. R5 spricht von einer "präventiven Wirkung" des Gesetzes auf die Heime, da diese durch drohende gerichtliche Überprüfungen mit Freiheitsbeschränkungen "vorsichtiger" seien. Auch R2 sieht eine Entwicklung in diese Richtung: "Die geringe Zahl der Fälle hat auch damit zu tun, dass sich die Heime daran gewöhnt haben...die Dokumentation ist viel besser geworden". Alle fünf RichterInnen sprechen sich für den Schutz der Menschen mit Behinderung durch dieses neue Gesetz aus, die Intention des Gesetzgebers, die Beschränkung der Freiheit zu überprüfen und so Missbrauch zu verhindern, halten alle Befragten für wichtig. Die große Zustimmung, die das Heimaufenthaltsgesetz bei den befragten RichterInnen findet, deutet auf ein Interesse an der Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderung hin. Diese Aussagen sollten allerdings, im Sinne der Problematik der sozialen Erwünschtheit, kritisch betrachtet werden. Unter Berücksichtigung der Interviews als Ganze kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle fünf RichterInnen Menschen mit Behinderung und deren Rechten bedingungslos positiv gegenüberstehen, wie es aus diesen Ausführungen heraus gelesen werden könnte.
Die Position der Menschen mit Behinderung im Verfahren wird von den befragten RichterInnen sehr unterschiedlich wahrgenommen. Bezüglich der Teilnahme der betroffenen Person am Verfahren streuen die Aussagen von "bemüht man sich ja das Verfahren, das ganze Verfahren in Anwesenheit des Patienten abzuwickeln" (R2) bis zu "keinen Sinn, die Person beizuziehen, weil sie es nicht versteht" (R3). R5 geht ebenso davon aus, dass eine Teilnahme am Verfahren nicht sinnvoll sei. R1 verweist darauf, dass andere Aspekte im Verfahren von größerer Bedeutung seien. R4 hält die Anwesenheit der betreffenden BewohnerInnen während des Verfahrens für die Ausnahme.
Hier wird deutlich, dass die eigentliche Hauptperson, der Mensch mit einer so genannten geistigen Behinderung, im Verfahren oftmals keine zentrale Rolle einnimmt. Mit Ausnahme von R2 zeigen die RichterInnen kein besonderes Interesse daran, Bemühungen zu unternehmen, die betroffene Person in die Verhandlung mit einzubeziehen. An dieser Stelle muss noch darauf hingewiesen werden, dass im Gesetz die Möglichkeit verankert ist, Menschen mit Behinderung zu ihrer eigenen Schonung von der Verhandlung fern zu halten (vgl. §14 Abs. 2 HeimAufG). Allerdings sollte dies doch die Ausnahme bilden und nicht die Regel sein. Ziel sollte es doch sein, die Umstände so zu gestalten, dass eine Teilnahme am Verfahren für die BewohnerInnen ermöglicht wird. Ebendies wird von der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung, die auch von Österreich ratifiziert wurde, gefordert: "durch verfahrensbezogene und altersgemäße Vorkehrungen" (UN 2006, im Internet) soll "ihre wirksame und unmittelbare und mittelbare Teilnahme, einschließlich als Zeugen und Zeuginnen, in allen Gerichtsverfahren, auch in der Ermittlungsphase und in anderen Vorverfahrensphasen" (ebd.) gewährleistet werden. Aus den Aussagen der RichterInnen lassen sich jedoch, wie gezeigt wurde, nur wenige Bestrebungen in diese Richtung erkennen. Vielmehr hat es den Anschein, als würden die Menschen mit so genannter geistiger Behinderung außen vor gelassen und über sie statt mit ihnen gesprochen.
Die Entscheidungsfindung basiert für alle RichterInnen auf dem Gutachten durch die Sachverständigen. Inwieweit die Entscheidung dann dieses berücksichtigt, wird jedoch wieder sehr unterschiedlich gesehen. R3 beklagt die totale Angewiesenheit auf die Sachverständigen: "Ja, für mich in meiner Arbeit ist es extrem schwierig..weil ich komplett angewiesen bin auf den Sachverständigen." Für R4 erleichtert genau diese Tatsache die Bearbeitung dieser Fälle: "die inhaltliche Entscheidung an sich, das..ist eine Sachverständigen - Entscheidung. Im Endeffekt braucht man Sachverständige, die da schlüssig Stellung beziehen." Problematisch wird es für R4, sobald sich die Sachverständigen in ihrem Urteil uneinig sind. Auch R1 und R2 messen den Sachverständigen eine große Bedeutung in der Beurteilung der Situation bei. Besonders wenn es um medikamentöse Freiheitsbeschränkungen geht, ist ein medizinisches Gutachten unumgänglich. Aber auch bei pflegerischen Maßnahmen werden Sachverständige hinzugezogen, die mögliche Alternativen aufzeigen können. Für R5 ist nur der oder die medizinische Sachverständige nötig, um die Situation zu klären. Bei Fragen, die die Pflege betreffen, fühlt er sich selbst sicher genug, um das beurteilen zu können. Er zieht deshalb nur in Ausnahmefällen noch weitere Sachverständige hinzu. R5 gibt als einziger der Befragten explizit an, nicht an das Sachverständigen-Urteil gebunden zu sein, sondern die Entscheidung selbst zu treffen.
Formale Aspekte, die Einhaltung von Fristen etc., spielen eine große Rolle und werden von allen RichterInnen erwähnt. Für R1 habe diese "ablauftechnischen" Faktoren sogar eine größere Bedeutung als die Perspektive der betroffenen BewohnerInnen. Auf einen verstärkten "Rückzug auf Formalia", um der Lage Herr zu werden, wurde auch von Hofinger et al. (2007, im Internet) verwiesen. Um sich einen Eindruck von der Situation der Menschen mit Behinderung im Heim zu machen, wenden die Richter sehr unterschiedlich viel Zeit auf. Während R4 und R1 von einem Zeitraum von 10-15 Minuten sprechen, den sie zum persönlichen Gespräch mit der Person verwenden, nimmt sich R2 einen halben Tag Zeit, "dass ich..mit dem Patienten ausreichend rede". Allein aus dieser unterschiedlichen Zeitinvestition kann ein Grad an Bereitschaft zu einer Auseinandersetzung mit den BewohnerInnen gelesen werden, der bei R2 deutlich höher zu sein scheint als bei den anderen RichterInnen (auch R4 und R5 haben nur Zeit für ein einziges Gespräch).
Befragt nach Entscheidungskriterien, die in den behandelten Fällen zum Heimaufenthaltsgesetz eine Rolle spielen, wurden neben der Feststellung des Sachverhalts mit Hilfe von Sachverständigen und des eigenen Eindrucks von der Situation und den "rechtlich formellen Argumenten" (R2) Kriterien wie "Hausverstand" (R2) und "Bauchgefühl" (R3) angewandt. R3 ist sich, wie bereits beschrieben, sehr unsicher in der Auslegung des Gesetzes, weshalb sie auch nicht daran glaubt, dass eine "hundert Prozent richtige Entscheidung" möglich sei. Diese Unsicherheit in der Entscheidungsfindung löst sie mit "Bauchgefühl", also auf einer emotionalen Ebene. R2 hingegen wendet seinen "Hausverstand" an. Inwiefern jedoch dieser Hausverstand möglicherweise eine ähnliche gefühlsmäßige Konnotation aufweist, bleibt reine Spekulation. Festzuhalten ist hier jedenfalls, dass eine persönliche Komponente inmitten all der rechtlich-formalen Kriterien für diese beiden Befragten eine erhebliche Rolle spielt.
Die RichterInnen wurden in den Interviews gefragt, was Behinderung für sie bedeute. Die Antworten der einzelnen auf diese Frage wurden in der Einzelanalyse bereits ausführlich behandelt. Hier möchte ich sie zu Typen zusammenfassen. Einen ersten Typus bilden R3 und R5, die Behinderung als individuelle Kategorie, als Defekt, der einen Menschen betrifft, definieren.
R3 und R5 nehmen anfangs eine Unterscheidung in körperliche und geistige Behinderung vor. Körperliche Behinderung für R3 bedeutet, dass "dem also irgend etwas fehlt". Behinderung wird hier durch ein körperliches Defizit definiert. R5 wendet dies auch auf so genannte geistige Behinderung an, indem er nach biologischen Ursachen für die Beeinträchtigung sucht, wie "Geburtsfehler, Sauerstoffmangel, dann die Genfehler". Hier ist ein klarer Hinweis zu einem medizinischen Modell von Behinderung zu sehen, eine Kausalität von organischer Schädigung zur Behinderung wird hier evident. Behinderung stellt für die beiden eine individuelle Kategorie dar.
R1 geht hier einen Schritt weiter, er spricht von einer "Ablaufsbeeinträchtigung", Menschen mit Behinderung können "Dinge nicht mehr so machen, wie ein durchschnittlich..körperlich, geistig trainierter Mensch", sie haben Funktionseinschränkungen. Für ihn stellt die Behinderung also kein körperliches Defizit dar, sondern eine Beeinträchtigung in den Anforderungen des "tatsächlichen Alltagsgeschehens". Die Behinderung wird also, so kann geschlossen werden, erst relevant in der Interaktion mit der Umwelt. Eine rein individualistische Perspektive, wie bei R3 und R5, lässt sich hier nicht finden. Eine Norm, die sich am Durchschnitt orientiert, bietet den Bezugsrahmen für diesen Behinderungsbegriff. R1 spricht auch die Dichotomie von Norm und Abweichung explizit an: Behinderung sei "die gesetzmäßig definierte Abweichung von einer Norm". Der Gesetzgeber verfügt über eine Zuschreibungsmacht, er "adressiert jemanden als behindert".
Auch R4 bringt einen sozialen Aspekt in ihrer Definition von Behinderung ein, wenn sie sagt, Behinderung sei "in unserer Gesellschaft etwas, womit man sich nicht gerne befasst". Eine Verdrängung von Menschen mit Behinderung aus der Öffentlichkeit und eine Unterbringung in separaten Einrichtungen werden von ihr kritisiert. Hier kann geschlossen werden, dass für R4 Menschen mit Behinderung als Teil der Gesellschaft auch in deren Mitte leben und nicht ausgeschlossen werden sollen. Partizipation und Integration sind Schlagworte, die diese Forderungen beschreiben würden.
R2 beschreibt Behinderung als eine Form des Lebens und führt eine gesellschaftliche Verantwortung für die Ermöglichung eines "akzeptablen und lebenswerten" Lebens für Menschen mit Behinderung an. In weiterer Folge fordert er von den ArbeitgeberInnen ihrer Einstellungspflicht nachzukommen, um eine "Chancengleichheit" herzustellen. Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung wird hier gefordert und als Anspruch an die Gesellschaft gestellt. Behinderung stellt für diesen Richter ein soziales Phänomen dar. Er verweist außerdem auf das Selbstbild von Menschen mit Behinderung, das sich durch vermehrte Präsenz in der Öffentlichkeit in eine positive Richtung entwickelt. R2 betrachtet das Phänomen Behinderung sehr differenziert und aus verschiedenen Perspektiven, was, wie angenommen werden kann, auf die verschiedenen Kontexte, in denen er mit Menschen mit Behinderung zu tun hat, zurück zu führen ist.
Versucht man also, anhand dieser Schilderungen, die Bilder von Behinderung der fünf befragten RichterInnen zu typisieren, ergeben sich drei Gruppen, die in Analogie zu den Behinderungsbegriffen der Paradigmen in der Behindertenhilfe (siehe Kapitel 3) zu lesen sind:
-
Medizinisches Paradigma: R3 und R5
-
Heilpädagogisches Paradigma: R1
-
Inklusives Paradigma: R2 und R4
Hier möchte ich jedoch darauf hinweisen, dass diese Typisierung sich nur auf die Ausführungen der RichterInnen zu ihren jeweiligen Behinderungsbegriffen beziehen. Betrachtet man den gesamten Interviewkontext, wird es freilich schwieriger, solche Klassifizierungen vorzunehmen, da sich die Aussagen der einzelnen RichterInnen nicht immer so homogen darstellen.
Vier von fünf befragten RichterInnen haben privat keinen oder nur sehr oberflächlichen Kontakt mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung. Eine interessante Überlegung stellt hierzu R1 an, der es in Betracht zieht, dass Menschen mit Behinderung in seiner Umgebung leben, und er diese aber nicht als solche wahrnimmt, weil die Behinderung in den Kontexten, in denen sie sich treffen, keine Rolle spielt. Diese Perspektive lässt sich mit dem Normalisierungsgedanken in Verbindung bringen. Die Behinderung des Menschen, der vielleicht in unmittelbarerer Umgebung von R1 lebt, ist nicht relevant, weil die Bedingungen es ermöglichen, dass er oder sie so leben kann, wie jeder andere auch.
Nur R2 pflegt auch außerhalb seiner unmittelbaren beruflichen Tätigkeit Kontakte mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung. Er engagiert sich ehrenamtlich, beispielsweise im Rahmen von Wohltätigkeitsveranstaltungen. Außerdem besucht er die BewohnerInnen, wenn die Verfahren schon längst abgeschlossen sind: "und dann..wenn ich gerade drüben bin, dann schaue ich halt, wie es so den Klienten so geht". R2 ist es wirklich ein Bedürfnis, die Situation dieser Menschen zu verbessern, er hat ein echtes Interesse an den Menschen. Seine Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung in anderen Kontexten als dem gerichtlichen prägen, wie angenommen werden kann, auch seine Arbeit. Er geht, im Vergleich mit den anderen RichterInnen, mehr auf die Personen, mit denen er zu tun hat, ein.
Diese Ergebnisse entsprechen den Ausführungen Cloerkes zur Kontakthypothese. Demnach sei allein beruflicher Kontakt für eine positive Einstellungsänderung nicht genug, die Freiwilligkeit und auch die Intensität der Begegnung spielen ein Rolle (vgl. Cloerkes 2007, S. 147). Diese Kriterien sind bei R2, im Gegensatz zu den anderen RichterInnen, gegeben. Wie noch gezeigt wird, sind R2's Einstellungen Menschen mit Behinderung gegenüber im Vergleich mit den anderen Befragten positiver, differenzierter, weniger von Vorurteilen geprägt. Cloerkes' Kontakthypothese bietet hierfür eine mögliche Erklärung.
Den Umgang mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung beschreiben die befragten Richterinnen als schwierig, während ihre männlichen Kollegen sich selbst als souverän erleben. Sowohl R1 als auch R2 und R5 geben an, in der Praxis gelernt zu haben, wie sie mit Menschen mit Behinderung umzugehen haben. Dementsprechend gestalten sich auch die Einstellungen zu Fortbildungsangeboten. Während die beiden Richterinnen sehr bedauern, dass es weder in der Ausbildung noch nachher in der Praxis Angebote gab, die sie auf die Arbeit am Heimaufenthaltsgesetz und mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung vorbereitet hätten, erachten die männlichen Befragten dies nicht für nötig. Diese waren allesamt deutlich älter und einige Jahre länger als Richter tätig als die beiden Richterinnen. Erfahrung und Routine stellen möglicherweise im Erleben der eigenen Rolle als RichterIn und in der Wahrnehmung der Aufgaben als solche/r wichtige Aspekte dar.
Zur Kommunikation mit den BewohnerInnen zeichnen sich ebenso verschiedene Typen ab. Für R5 sind Gespräche mit den Menschen mit so genannter geistiger Behinderung schlichtweg "zwecklos". Da sie in seinen Augen nicht verstehen, worum es geht, muss er gar nicht mit diesen Menschen sprechen. Eine Abschwächung dieser sicherlich extremen Position findet sich bei R1, R3 und R4. R3 findet Gespräche mit den BewohnerInnen "oft gar nicht besonders sinnvoll", da die Personen nicht verstehen würden, was sie von ihnen wolle. Sie berichtet außerdem von Verständigungsproblemen, die sie dadurch löst, dass sie "einfache Worte" benutzt oder manche Dinge ganz verschweigt. R4 hat sich im Umgang mit Menschen mit Behinderung eine ähnliche Taktik zurechtgelegt. Auch sie versucht beispielsweise mit "Ja-Nein-Fragen" und der Vermeidung von Aussagen, die die BewohnerInnen verunsichern könnte, eine produktive Art der Kommunikation zu schaffen, die sie als "kreativ" und "flexibel" bezeichnet. Allerdings muss hier beanstandet werden, dass das Verschweigen und Nicht-zur-Sprache-Bringen von wichtigen Details, nur um einen Menschen nicht zu beunruhigen, im Sinne einer Gleichberechtigung von Menschen mit so genannter geistiger Behinderung nicht vertretbar ist.
R1 hat aufgrund von Zeitmangel nicht die Möglichkeit, beziehungsweise nimmt sich nicht so viel Zeit, wie nötig wäre, um mit den BewohnerInnen konstruktive Gespräche zu führen. Die Kommunikation mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung besteht für ihn hauptsächlich darin, dass er deren Reaktionen bei der Befragung durch die Sachverständigen beobachtet. Die BewohnerInnen stellen hier also nicht diejenigen dar, die etwas zu sagen haben, sondern sind lediglich die auf Reize Reagierenden.
R2 stellt auch in Hinblick auf die Kommunikation mit den BewohnerInnen den Gegenpol zur Ansicht R5's dar. Für R2 ist es sehr wichtig, sich Zeit zu nehmen um ein vertrauensvolles Gespräch zu führen. Auch wenn er "ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen muss", legt er alles so dar, dass der oder die Betroffene versteht, worum es geht und sich entsprechend dazu äußern kann. R2 will im Gespräch ermitteln, wie die Menschen mit so genannter geistiger Behinderung zu der jeweiligen Freiheitsbeschränkung stehen. Er lässt sich auf die Person ein und versucht in deren Lebenswelt Einblick zu bekommen, um eine adäquate Entscheidung treffen zu können. Diese Herangehensweise lässt auf eine wertschätzende Einstellung gegenüber Menschen mit so genannter geistiger Behinderung schließen.
Auch die Art und Weise, wie von Seiten der RichterInnen die Kommunikation mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung wahrgenommen und beschrieben wird, lässt auf deren Einstellungen schließen. Eine Kommunikationsvermeidung beziehungsweise eine Beschränkung auf das Allernötigste, wie sie sicherlich am stärksten ausgeprägt bei R5, in etwas abgeschwächter Form aber auch bei R1, R3 und R4 aufzufinden ist, weist auf die Einstellung hin, Menschen mit Behinderung seien keine gleichberechtigte GesprächspartnerInnen. Dies kann, meines Erachtens, als eine Form der Diskriminierung gesehen werden. Lediglich R2 ist dazu bereit, sich auf ein wirkliches Gespräch einzulassen, was, wie bereits angedeutet, als Hinweis auf positive Einstellungen gegenüber Menschen mit so genannter geistiger Behinderung gewertet werden kann.
Nach der Analyse der Interviews hinsichtlich der Kategorien aus dem Interviewleitfaden wird der nächste Schritt die Explikation von Vorurteilen und Stereotypen sowie eine Zuordnung der einzelnen Interviews zu den Paradigmen in der Betrachtung von Behinderung darstellen.
In den fünf Interviews kommt mehrmals eine Aussage in Richtung - die Menschen mit so genannter geistiger Behinderung bekämen nicht mit, worum es in den Verfahren geht - vor. R1 beispielsweise stellt in Frage, inwieweit die "Betroffenen im Sinne des Wortes (...) tatsächlich betroffen sind vom Faktischen her". Auch von R3 und R5 werden Einschätzungen dieser Art genannt. Die Annahme, Menschen mit so genannter geistiger Behinderung würden nichts mitkriegen, kann als Vorurteil betrachtet werden, da sie sich auf eine ganze Gruppe von Menschen bezieht, ohne nach individuellen Besonderheiten zu differenzieren (siehe Punkt 4.2). Dementsprechend können auch Aussagen von R3 und R5, die besagen, dass Gespräche mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung wenig sinnvoll seien, als Vorurteile gedeutet werden.
Stereotype Bilder von Behinderung lassen sich besonders bei R4 ausmachen, wenn sie sagt: "das sind Leute, die..sehr offen zugehen auf einen, wenn man sich ein bisschen anpasst, die..auch viel Wert legen auf Berührungen". Aussagen wie Menschen mit so genannter geistiger Behinderung "sind Leute, die"..., beziehen sich ganz undifferenziert auf ganze Gruppen von Menschen und unterstellen ihnen Vorlieben und Verhaltensweisen. Auch bei R3 werden stereotype Bilder angesprochen, beispielsweise: "demente Menschen leben meistens in einer eigenen Welt". Dass Menschen mit Demenz "in einer eigenen Welt" leben würden, stellt ein gängiges Stereotyp dar, das von R3 hier sehr unreflektiert, wie mir scheint, übernommen wird.
Besonders vorurteilsbehaftet stellt sich R5 in seinem Interview dar. Eine Reihe von Aussagen, die er tätigt, lassen auf Einstellungen schließen, die sich auf die Gruppe der Menschen mit so genannter geistiger Behinderung beziehen. Neben der bereits angesprochenen Auffassung, die BewohnerInnen würden nicht wissen, worum es in den Verfahren geht, und Gespräche mit ihnen wären deshalb sinnlos, unterstellt er Menschen mit so genannter geistiger Behinderung eine gewisse Triebhaftigkeit: "das kommt nämlich oft vor, dass die Geistigbehinderten einen Wandertrieb haben". Mit Aussprüchen wie "die Behinderten können ja furchtbar sich aufführen" bringt er zum Ausdruck, dass in seinen Augen Menschen mit Behinderung von ihren Trieben gelenkt werden und sich nicht unter Kontrolle haben.
Ein weiteres Bild von Behinderung, das hier ausgemacht werden kann, ist jenes des Menschen mit geistiger Behinderung als Wesen, das einem Kind ähnelt. Diese Tendenz zur Infantilisierung bringt er in Aussagen, wie der folgenden zum Ausdruck: "wenn ich eine Person habe, nur für den..ich könnte sagen, der hält ihm die Hand, der lenkt ihn ab, der zeigt ihm irgendetwas zum Spielen". Das stereotype Bild das hier gezeichnet wird, würde ich wie folgt beschreiben: Menschen mit so genannter Behinderung sind wie kleine Kinder und brauchen deshalb jemanden, der mit ihnen spielt. R5 lässt also eine äußerst undifferenzierte Sicht auf Menschen mit Behinderung erkennen, die von vielen Vorurteilen durchzogen ist.
R2 bildet auch in Bezug auf Vorurteile und Stereotype einen Ausnahmefall. Im Interview sind keine Hinweise auf Vorurteile oder stereotype Bilder zu finden. Wenn er von Menschen mit so genannter geistiger Behinderung spricht, bezieht er sich auf Einzelfälle. In einem resümierenden Satz, fasst er seine Herangehensweise folgendermaßen zusammen: "Das ist also meine Erfahrung, was ich halt so sehe, was ich nicht sehe, das kann ich nicht beurteilen." R2 bemüht sich also die einzelnen Menschen wahrzunehmen, ohne generalisierte Vorannahmen zu berücksichtigen. Allerdings kann aus einem Gespräch, in dem keine Hinweise auf Vorurteile zu finden sind, nicht darauf geschlossen werden, dass dieser Richter gänzlich frei davon wäre. Möglicherweise spielt hier das Phänomen der sozialen Erwünschtheit (siehe Punkt 4.4.2.2) eine Rolle.
Resümierend kann gesagt werden, dass bei vier der fünf befragten RichterInnen viele gängige Vorurteile und Stereotype in Bezug auf Menschen mit Behinderung auszumachen sind. Möglicherweise ist dies auf eine fehlende Auseinandersetzung mit der Thematik zurück zu führen. Viele der Aussagen deuten darauf hin, dass sich die Befragten nicht sehr intensiv mit dem Leben von Menschen mit so genannter geistiger Behinderung beschäftigen. Dadurch fehlt ein Verständnis für die Bedürfnisse und Probleme der BewohnerInnen, mit denen sie im Rahmen ihrer Arbeit zu tun haben. Dieses Defizit wird dann, wie gedeutet werden darf, durch Vorurteile ausgeglichen. Durch diese Konstrukte werden Situationen vorstrukturiert, was Unsicherheiten und Ängste vermindern kann (siehe Punkt 4.1.3).
Nur R2 hat sehr viele Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung auch in anderen Kontexten. Dadurch hat er weniger Schwierigkeiten, sich auf die einzelnen Personen und Persönlichkeiten einzulassen, ohne auf Vorurteile zur Situationsdefinition angewiesen zu sein.
Versucht man nun, die Ausführungen der RichterInnen den Paradigmen in der Betrachtung von Behinderung, wie sie im theoretischen Teil dieser Arbeit (Abschnitt 3) behandelt wurden, zuzuordnen, lässt sich eine Tendenz zu einer Orientierung am medizinisch-heilpädagogischen Modell von Behinderung erkennen.
Die Menschen mit Behinderung werden von mehreren der Befragten als Objekte wahrgenommen, als ‚Gegenstände' der Verhandlung. Für R1 bedeutet die "Befassung mit der Person" im Rahmen des Verfahrens: "die Person gehört vom Sachverständigen angeschaut". Der Mensch mit Behinderung wird hier nicht als ernst zunehmendes Subjekt betrachtet, sondern eher wie eine Sache, die zu begutachten ist.
Eine starke Orientierung an ExpertInnen, die über das Leben und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung besser Bescheid wissen als diese selbst, ist ebenfalls zu erkennen. Für R4 beispielsweise ist die Einschätzung des Pflegepersonal sehr wichtig: "ich frage immer vorher einen Pfleger oder Pflegedienstleitung, nur ungefähr, ist die Person ansprechbar, seit wann ist sie da, was in etwa kann man denn zumuten". Der Meinung der Professionellen wird mehr Relevanz beigemessen als der des betroffenen Menschen. Bei R3 ist diese Tendenz in ganz ähnlicher Form zu finden, auch sie erfährt mehr "sicher durch das Pflegepersonal, weil die kennen den Menschen, die haben dauernd damit zu tun, die können genau sagen, wie sie reagiert, was sie tut und..wo überhaupt die Schwierigkeiten liegen." Bei diesen beiden RichterInnen wird die Auseinandersetzung mit der Person durch die Befragung des Pflegepersonals fast vollständig ersetzt. Dieser Fokus auf das Personal im Pflegebereich als ExpertInnen für das Leben von Menschen mit Behinderung ist eindeutig einem medizinischen Modell von Behinderung zuzurechnen.
Bei R4 findet sich ein weiterer Beleg für diese Orientierung. Sie beschreibt einen Fall, in dem zwei Sachverständige zum Einsatz kamen, ein Mediziner und eine Gutachterin aus dem Bereich ‚Behindertenbetreuung', an die genaue Bezeichnung konnte sie sich nicht mehr erinnern, was schon als erster Hinweis auf fehlendes Verständnis für diesen Zugang gedeutet werden kann. Während das medizinische Gutachten für R4 schlüssig erschien, war die Perspektive des zweiten Gutachtens nicht nachvollziehbar: "die...medikamentöse Einstellung, und das wurde auch kritisiert von der Sachverständigen, während der Sachverständige, der Mediziner, das sehr schlüssig erklärt hat, warum diese Medikamente halt wichtig sind". Für R4 war eine Herangehensweise, die etwas, das ein Mediziner diagnostizierte, in Frage stellte, nicht verständlich. Die Medizin stellt für sie die Wissenschaft dar, die für diese Fragen herangezogen werden muss und ihr alle wichtigen Informationen, die sie für die Bearbeitung dieses Falles braucht, zur Verfügung stellen kann. R5 geht sogar so weit, dass er sagt, er brauche nur einen Sachverständigen aus dem medizinischen Bereich, alle anderen Fragen könne er selbst beurteilen.
R3 bringt einen weiteren Aspekt ein, der einem medizinischen Paradigma zugeordnet werden kann. Sie beklagt ein Defizit an Wissen "über die einzelnen Krankheiten", das ihr den Umgang mit den Menschen mit Behinderung erschwert. Hier wird so genannte geistige Behinderung als Krankheit gesehen und durch medizinisches Wissen über Symptome etc. der ‚Krankheit' würde die Arbeit, nach Ansicht von R3, mit Menschen mit Behinderung besser funktionieren. Sie müsse vorher wissen, "wo fehlt es bei dem Menschen", um dementsprechend mit ihm oder ihr sprechen zu können. Hier wird eine deutliche Defektorientierung im Umgang mit Menschen mit Behinderung sichtbar.
Bei vier der fünf RichterInnen tauchen immer wieder Aussagen auf, die eindeutig einem medizinisch-heilpädagogischen Paradigma zuordenbar sind. Eine Ausnahme bildet wieder R2: Er ist bereit, mehr Zeit zu investieren, um sich intensiv mit dem betroffenen Menschen mit Behinderung auseinanderzusetzen. Er will die Lebenswelt der Person kennen und verstehen lernen. Das Verhalten betrachtet er in Zusammenhang mit den äußeren Umständen: "der hat eine Panik, weil da das Gitter ist". R2 deutet also die Verhaltensweisen als von den Umweltgegebenheiten provoziert und nicht im Wesen des Menschen oder dessen Behinderung begründet. Hieraus kann auf eine ökosystemische Denkweise geschlossen werden, in der Behinderung nicht als medizinisch feststellbare Tatsache betrachtet wird, sondern im sozialen Kontext gesehen werden muss. R2's Bestreben in seiner Arbeit ist es, die Umstände so zu verändern, dass die Lebenssituation der BewohnerInnen verbessert werden kann.
Bei genauerer Betrachtung lassen sich auch bei weiteren RichterInnen immer wieder Momente finden, die Spuren der Entwicklung in den Einstellungen im Sinne des Paradigmenwandels erkennen lassen. So spricht R1 von Personen, die "mehrfach behindert" sind. "Dadurch dass sie im Heim leben müssen" ebenso wie durch die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen werden diese Menschen behindert. Hier werden Umweltbedingungen angesprochen, durch die ein Mensch behindert wird. Auch dies lässt sich als eine Abkehr von einem rein medizinischen Behinderungsmodell sehen. Auch in Interview 4 können Hinweise in diese Richtung entdeckt werden. R4 findet es "schade", dass so weinige Menschen mit Behinderung im Alltag sichtbar sind. Deren Unterbringung in speziellen Schulen und Wohneinrichtungen interpretiert sie als "Verstecken" der Menschen. Dies kann als Kritik an der Praxis der Segregation von Menschen mit Behinderung gesehen werden. Auch wenn R4 eine Forderung nach Integration nicht explizit ausspricht, so weist eine Kritik an der Unterbringung in Sondereinrichtungen doch in diese Richtung.
Resümierend lässt sich feststellen, dass die Aussagen dieser fünf RichterInnen großteils einem medizinisch-heilpädagogischen Modell von Behinderung zuzuordnen sind. Eine Entwicklung im Sinne des Paradigmenwechsels, wie sie im wissenschaftlichen Diskurs stattfindet, findet sich in den Einstellungen dieser RichterInnen nur zu einem kleinen Teil wieder. Die vorherrschenden Bilder sind geprägt von einer defizitären Sichtweise auf Menschen mit Behinderung, deren Leben in separaten Einrichtungen unhinterfragt angenommen wird. Nur ein Richter bricht mit den Denkmustern der traditionellen Heil- und Sonderpädagogik und überwindet ein Denken in Kategorien von Norm und Abweichung hin zu einem sozialen Modell von Behinderung.
Finkelstein (1980, im Internet), der die Entwicklung der Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung in drei großen Epochen beschreibt, findet in der Analyse empirischer Studien großteils Einstellungen, die er der zweiten Phase in seiner Chronologie zuordnet. Diese Phase geht analog mit den Vorstellungen von Behinderung, wie sie in einem medizinisch-heilpädagogischen Modell beschrieben sind. Für die hier befragten RichterInnen muss ich Finkelstein zustimmen, wenn er feststellt, dass ein Übergang in den Einstellungen zu einer Phase, in der Behinderung als Kategorie relativiert wird, noch nicht vollzogen sei. Die "neue Generation von Einstellungen" (ebd.) scheint hier bei einem einzigen Richter zu greifen. Bedenkt man, dass Finkelsteins Arbeit aus dem Jahr 1980 stammt, stimmt es mich doch nachdenklich, dass er auch nach weiteren fast dreißig Jahren mit seiner Diagnose Recht behält. Die Bilder von Behinderung, wie sie jahrzehntelang die Behindertenhilfe prägten, scheinen im Kontext des Heimaufenthaltsgesetzes zumindest für die hier befragten RichterInnen noch immer großteils wirksam zu sein.
Cloerkes konstatiert in seiner Kontakthypothese einen positiven Einfluss von Kontakten mit Menschen mit Behinderung auf die Einstellungen. Allerdings relativiert er die Relevanz beruflicher Kontakte für eine positive Beeinflussung. So spielt die Intensität sowie die Freiwilligkeit und eine gefühlsmäßige Bindung in der Begegnung eine Rolle (vgl. Cloerkes 2007, S. 147). Für die vorliegende Untersuchung muss, wie bereits angedeutet, Cloerkes hier zugestimmt werden. Der einzige der befragten RichterInnen, der auch außerhalb seiner beruflichen Tätigkeit immer wieder und in verschiedenen Kontexten mit Menschen mit Behinderung in Kontakt ist, nämlich R2, weist in allen Bereichen deutlich positivere Einstellungen auf, als die anderen Befragten. Seine Ausführungen sind frei von generalisierenden oder vorurteilsvollen Aussagen, er lässt eine sehr differenzierte Wahrnehmung auf die Situation und die Probleme von Menschen mit Behinderung erkennen.
Hier kann die große Bedeutung von Integration von Menschen mit Behinderung für ein Umdenken in der Gesellschaft und einen Abbau von Vorurteilen erkannt werden. Durch Begegnungen mit Menschen mit Behinderung können generalisierte Annahmen über diese Menschen über Bord geworfen und durch reale Erfahrungen ersetzt werden. Mit Markowetz (2000, im Internet) sollen durch Integration "die alten Bilder von Menschen mit Behinderung zu Gunsten der Etablierung von egalisierenden Menschenbildern" (ebd.) aufgelöst werden. Für die befragten RichterInnen könnten, wie ich behaupten möchte, Begegnungen mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung in anderen Kontexten als dem des Heims, zu einer positiven Veränderung im Bild von Behinderung führen. Die Begegnungsräume für Menschen mit und ohne Behinderung sind allerdings in unserer Gesellschaft immer noch sehr begrenzt, weshalb diese Entwicklungen nur langsam vonstatten gehen können.
In der sozialpsychologischen Einstellungsforschung wurden Zusammenhänge zwischen Geschlecht und Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung gefunden. Demnach würden Frauen positivere Einstellungen aufweisen als Männer (vgl. Cloerkes 2007, S.105; Aiken 2002, S.120). Für die hier befragten RichterInnen kann dies nicht bestätigt werden: die beiden hier befragten Frauen heben sich in den Einstellungen nicht positiv von ihren männlichen Kollegen ab. An dieser Stelle muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass hier nur fünf Interviews vorliegen, die keine repräsentativen Aussagen über eine Gesamtpopulation zulassen. Es kann nur versucht werden, die Ergebnisse anhand der vorliegenden Studien einzuordnen und zu deuten.
Ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern lässt sich dennoch feststellen: Während die Aussagen der beiden Richterinnen von großer Unsicherheit hinsichtlich ihrer Rolle als Richterinnen und den damit verbundenen Aufgaben geprägt sind, präsentierten sich die männlichen Befragten routiniert und selbstsicher. Inwiefern diese Differenzen jedoch auf das Geschlecht zurückzuführen sind, bleibt in Frage zu stellen. Ich gehe davon aus, dass die Gründe für die größere Verunsicherung in weniger Dienstjahren und fehlender Erfahrung zu sehen sind und geschlechtsspezifische Aspekte hier von geringerer Bedeutung sind. Dies entspricht auch den Ergebnissen, die Hofinger et. al (2007, im Internet) vorlegen. So berichteten einige der dort befragten RichterInnen von einem Verständnis für die im Kontext der Freiheitsbeschränkungen relevanten Probleme, das sie im Lauf der Zeit entwickelten. Dieses Phänomen bestätigt sich auch in der Analyse meiner geführten Interviews. Die älteren, routinierteren Richter legten sich mit ihrer Erfahrung eine Art Strategie zurecht, wie sie mit Fällen dieser Art umgehen, während die beiden jüngeren Richterinnen eher verunsichert wirkten.
Zur ihrer Rolle in den Verfahren wurden in der Studie zur Implementation des Heimaufenthaltsgesetzes (Hofinger et al. 2007, im Internet) bereits RichterInnen befragt. In vielen Punkten stimmen die Ergebnisse mit denen der vorliegenden Untersuchung überein. So erlebten es die fünf hier befragten RichterInnen als schwierig, zwischen den verschiedenen Interessen der vielen Beteiligten zu vermitteln. Auf diese Problematik weisen auch Hofinger et al. hin.
In der Studie zur Implementation des Heimaufenthaltsgesetzes wurde außerdem aufseiten der RichterInnen eine Konzentration auf Formalia festgestellt, um der Lage Herr zu werden, d.h. als neutrale/r Dritte/r zwischen den einzelnen Positionen vermitteln zu können (vgl. ebd.). Diese Tendenz ist auch in den hier durchgeführten Interviews klar zu erkennen. Die befragten RichterInnen sprechen immer wieder die Bedeutung rechtlich-formaler Aspekte in den Verfahren an - und sogar deren Vorrang gegenüber der Perspektive des betroffenen Menschen mit Behinderung.
Die Verfahren zum Heimaufenthaltsgesetz gestalten sich in vielen Fällen als Gutachterprozesse, in denen die inhaltliche Entscheidung mehr oder weniger den Sachverständigen überlassen wird. Die Angewiesenheit der RichterInnen auf die Kompetenz ihrer GutachterInnen wird bei den von mir befragten RichterInnen ebenso als Besonderheit dieser Verfahren genannt wie bei denen der IRKS-Studie. Insbesondere medikamentöse Freiheitsbeschränkungen stellen für die RichterInnen in beiden Studien eine besondere Herausforderung dar, die nur mit Hilfe fachkundiger Sachverständiger adäquat beurteilt werden kann (vgl. ebd.). Diese Angewiesenheit der RichterInnen auf die Sachverständigen bringt auch die Relevanz der Einstellung der Sachverständigen zu den Rechten von Menschen mit Behinderung ins Spiel. Eine weitere Auseinandersetzung mit diesen würde hier freilich zu weit führen. Allerdings entsteht bei der Beschäftigung mit den Schilderungen der RichterInnen der Eindruck, dass ein Übergewicht der medizinischen GutachterInnen besteht. Die große Bedeutung, die der Medizin in diesen Fragen der Freiheitsbeschränkungen beigemessen wird, reproduziert, wie ich behaupten möchte, ein medizinisches Modell von Behinderung. Anderen Perspektiven, wie etwa der menschenrechtlichen, wird, wie mir scheint, weit weniger Beachtung geschenkt.
Wie gezeigt wurde, stehen die BewohnerInnen in den Verfahren zum Heimaufenthaltsgesetz, die hier geschildert wurden, nicht unbedingt immer im Zentrum des Interesses der befragten RichterInnen. Die Teilnahme am Verfahren und eine Befassung mit der Sichtweise der Betroffenen werden von den meisten der befragten RichterInnen nicht als selbstverständlich betrachtet. Damit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung ihre Rechte als BürgerInnen wahrnehmen können, müssen die Bedingungen so gestaltet werden, dass eine Teilnahme am gesamten gerichtlichen Prozess gewährleistet werden kann. Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung schreibt dies in Artikel 13 unmissverständlich fest (UN 2006, im Internet). Allerdings scheinen derartige Abkommen für die konkrete Arbeit der RichterInnen wenig Relevanz zu haben. Praktische Überlegungen, wie etwa der größere Zeitaufwand, wolle man den betroffenen BewohnerInnen genug Raum geben, sich zur Freiheitsbeschränkung zu äußern, spielen anscheinend eine größere Rolle als menschenrechtliche.
Hofinger et al. (2007, im Internet) sprechen von einem "Wunsch nach gezielter Fortbildung" der von einigen der in ihrer Studie befragten RichterInnen geäußert wurde. Auch in den vorliegenden Interviews wird, besonders von den weniger erfahrenen Richterinnen ein Wunsch in diese Richtung artikuliert. Die Fälle zum Heimaufenthaltsgesetz stellen eine besondere Herausforderung für die RichterInnen dar, speziell im Umgang mit Menschen mit Behinderung zeigen sich Verunsicherungen. Alle befragten RichterInnen berichten von Schwierigkeiten in der Kommunikation mit Menschen mit Behinderung. Fortbildungen, die diese RichterInnen für die Situation von Menschen mit Behinderung sensibilisieren, könnten dazu beitragen, Unsicherheit und Berührungsängste zu verringern und letzten Endes die an einem medizinischen Paradigma orientierten Einstellungen gegenüber Menschen mit so genannter geistiger Behinderung aus der Welt zu schaffen.
Auch im Sinne der Gleichberechtigung von Menschen mit so genannter geistiger Behinderung vor der der Justiz, wie sie in der bereits zitierten UN-Konvention gefordert wird, sind Bildungsangebote für RichterInnen zu begrüßen. In Absatz 2 des 13. Artikels heißt es:
"Um zur Gewährleistung des wirksamen Zugangs von Menschen mit Behinderungen zur Justiz beizutragen, fördern die Vertragsstaaten geeignete Schulungen für die im Justizwesen tätigen Personen" (UN 2006, im Internet).
Damit die betreffenden RichterInnen in der Lage sind, Menschen mit Behinderung als kompetente AkteurInnen in den Verfahren zum Heimaufenthaltsgesetz wahrzunehmen, bedarf es möglicherweise noch einer gewissen Aufklärungsarbeit. Dies könnte im Rahmen von Fortbildungs- und Schulungsangeboten geschehen.
Eine weitere Chance wären beispielsweise Reflexionsangebote für die RichterInnen. Für die meisten Berufsgruppen im Sozialbereich schon gang und gäbe, ist Supervision bei RichterInnen noch nicht sehr verbreitet (vgl. Riegler 2005, im Internet). Gerade für RichterInnen in diesem Bereich wäre es möglicherweise sinnvoll, Angebote in diese Richtung zu forcieren. Wie R1 beschreibt, gibt es für ihn als Richter nicht viele Möglichkeiten zur Reflexion:
"ich habe das ganz interessant gefunden, das einmal zu reflektieren zu müssen und zu sollen. In diese Position kommt man eh sehr selten, auch eine so relativ geschützte Position, wo man selber entscheiden kann, was sagt man, was sagt man nicht, ohne dass man da einen Stress dabei hat, das finde ich ganz..angenehm." (R1)
Wie R1 hier angibt, sind Momente der Reflexion in der Arbeit als Richter sehr rar. Gerade für die Arbeit mit Menschen mit so genannter geistiger Behinderung ist es sehr wichtig, seine eigenen Ängste usw. zu reflektieren, um sich auf die Personen unbelastet einlassen zu können. Wie gezeigt wurde, sind Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung oft durch Spannungen und Irritationen belastet. Eine Reflexion der eigenen Position in diesen Interaktionen könnte, wie ich denke, dazu beitragen, Situationen zu entspannen und es den RichterInnen ermöglichen, die BewohnerInnen zumindest ein wenig kennen zu lernen um eine Entscheidung zu treffen, die ihnen auch gerecht wird.
Ich möchte hier zum Schluss jedoch nochmals auf das Interview 2 verweisen. Dieser Richter stellt in meinen Augen ein Paradebeispiel für wertschätzende Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung dar. Seine differenzierte Betrachtung des Phänomens Behinderung deutet darauf hin, dass das defektologische Bild von Behinderung auch außerhalb der wissenschaftlichen Diskussion und des Sozialwesens überwunden werden und einem "egalisierenden Menschenbild" (Markowetz 2000, im Internet) in den Einstellungen der Menschen weichen kann.
Ziel dieser Arbeit war es, die Perspektive der RichterInnen zum Heimaufenthaltsgesetz einzufangen und deren Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung zu deuten. Im Fokus standen dabei die Paradigmen in der Betrachtung von Behinderung, wie sie in der "Scientific Communitiy" ausgiebig diskutiert werden, und deren Widerspiegelung in den Einstellungen der RichterInnen. Dabei zeigte sich, dass der Paradigmenwandel, wie er in der wissenschaftlichen Diskussion konstatiert wird, in den Aussagen der RichterInnen teilweise offenkundig wird, zum größeren Teil jedoch Einstellungen aufzufinden sind, die in einem medizinisch-defektologischen Modell von Behinderung ihre Entsprechung finden. Die bei den meisten der hier befragten RichterInnen vorhandenen Vorurteile verstellen dabei den Blick auf die individuelle Situation der Bewohnerin oder des Bewohners.
Das Heimaufenthaltsgesetz stellt einen wichtigen Meilenstein im Schutz der Rechte von Menschen mit so genannter geistiger Behinderung dar. Allerdings muss, um diesem Anspruch gerecht zu werden, auch bei der gerichtlichen Überprüfung diese Wahrung der Freiheitsrechte aller Menschen im Zentrum stehen. Für die fünf RichterInnen, die hier befragt wurden, so wage ich zu behaupten, kann nur bei einem davon ausgegangen werden, dass er diese Perspektive auch tatsächlich einnimmt. Eine Sichtweise, die Menschen mit Behinderung einräumt, mit den gleichen Rechten ausgestattet zu sein, wie jeder andere auch und deshalb in einem Verfahren, in dem es um ihr Leben geht, ausreichend gehört zu werden, kann bei den anderen vier befragten RichterInnen nicht ausgemacht werden. Sie entspricht nicht ihrem Bild von Behinderung. Damit die Situation von Menschen mit Behinderung nachhaltig verbessert werden kann, muss auch bei den RichterInnen ein Umdenken stattfinden. Wichtige gesetzliche Neuerungen, die die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung forcieren, können, so denke ich, nur richtig greifen, wenn alle an der Umsetzung Beteiligten auch davon überzeugt sind. In diesem Sinne ist es wichtig, die Bewusstseinsbildung für die Rechte von Menschen mit Behinderung auch bei RichterInnen voranzutreiben.
Aiken, Lewis (2002): Attitudes and Related Psychosocial Constructs. Theories, Assessment, and Research. Thousand Oaks u. a.: Sage Publications.
Barth, Peter (2005a): Das Heimaufenthaltsgesetz. Die neuen gesetzlichen Regeln über freiheitsbeschränkende Maßnahmen in Heimen, ähnlichen Pflegeeinrichtungen und Krankenanstalten als neue Herausforderung für alle in der Gesundheits- und Krankenpflege tätigen Personen. In: Österreichische Pflegezeitschrift 03/05. Verfügbar unter: http://www.oegkv.at/fileadmin/docs/OEPZ_ 2005/03/barth.pdf (Stand: 04.01.09)
Barth, Peter (2005b): Freiheitsbeschränkungen in Betreuungseinrichtungen - das neue Heimaufenthaltsgesetz. In: Österreichisches Komitee für Soziale Arbeit (Hrsg.): "Freiheitsbeschränkungen" bei Personen mit einer geistigen Behinderung und/oder einer psychischen Erkrankung. Dokumentation der Fachtagung des österreichischen Komitees für Soziale Arbeit vom 16. Juni 2005 in Salzburg. Verfügbar unter: http://www.oeksa.at/files/publikationen/OEKSA_2005_freiheit.pdf (Stand: 26.11.08)
Benninghaus, Hans (1976): Ergebnisse und Perspektiven der Einstellungs- und Verhaltensforschung. Meisenheim am Glan: Verlag Anton Hain.
BGBl. I 2004/11 Heimaufenthaltsgesetz
Bierhoff, Hans-Werner (2000): Sozialpsychologie. Ein Lehrbuch. Stuttgart: Kohlhammer.
Boatca, Manuela/ Lamnek, Siegfried (2004): Genese und Internalisierung von Stigmatisierungsprozessen. Zum Zusammenspiel von gesellschaftlichen Strukturen und (Selbst-) Definition. In: Forster, S. 158-174.
Bosse, Ingo (2006): Behinderung im Fernsehen. Gleichberechtigte Teilhabe als Leitziel der Berichterstattung. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
Breitenbach, Erwin / Harald Ebert: Verändern Formen schulischer Kooperation die Einstellungen von Schülerinnen und Schülern gegenüber Kindern mit geistiger Behinderung? In: Behindertenpädagogik 1/1997, S. 53-67.
Cloerkes, Günther (2007): Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter GmbH.
Cloerkes, Günther (1985): Einstellung und Verhalten gegenüber Behinderten. Eine kritische Bestandsaufnahme internationaler Forschung. Verfügbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/cloerkes-einstellung.html (Stand: 1.10.08)
Dannenbeck, Clemens (2007): Paradigmenwechsel Disability Studies? Für eine kulturwissenschaftliche Wende im Blick auf die Soziale Arbeit mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen. In: Waldschmidt, Anne/ Schneider, Werner (Hrsg.): Disability Studies, Kultursoziologie und Soziologie der Behinderung. Erkundungen in einem Forschungsfeld. Bielefeld: transript Verlag, S. 103-125.
Eggert, Dietrich (1996): Abschied von der Klassifikation von Menschen mit geistiger Behinderung. Verfügbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/eggert-klassifikation.html (Stand: 04.03.09)
Eggert, Dietrich (2000): Von den Stärken ausgehen... Individuelle Entwicklungspläne (IEP) in der Lernförderungsdiagnostik. Dortmund: Borgmann.
Eiser, Richard/ van der Pligt, J (1993): Attitudes and decisions. London, New York: Routledge.
Elbert, Johannes (1982): Geistige Behinderung - Formierungsprozesse und Akte der Gegenwehr. Verfügbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/elbert-formierungsprozesse.html (Stand: 4.10.08)
Europäischer Kongress für Menschen mit Behinderung (2002): Deklaration von Madrid. Verfügbar unter: http://infomed.mds-ev.de/sindbad.nsf/778bf5d6b54bb45fc1256e9f004097fb/7c32d85942fcf49f80256c06007fea07/$FILE/DeklMadrid2002.pdf (Stand: 12.05.09)
Felkendorff, Kai (2003): Ausweitung der Behinderungszone: neuere Behinderungsbegriffe und ihre Folgen. In: Cloerkes, Günther (Hrsg.): Wie man behindert wird. Texte zur Konstruktion einer sozialen Rolle und zur Lebenssituation betroffener Menschen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, S. 25-52.
Feuser, Georg (1996): Zum Verhältnis von Menschenbild und Integration - "Geistigbehinderte gibt es nicht!" Verfügbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-menschenbild.html (Stand: 03.03.09)
Feyerer, Ewald (2003): Pädagogik und Didaktik integrativer bzw. inklusiver Bildungsprozesse. Herausforderung an Lehre, Forschung und Bildungsinstitutionen. Verfügbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh1-03-feyerer-bildungsprozesse.html (Stand: 03.03.09)
Finkelstein, Victor (1980): Attitudes and Disabled People: Issues for Discussion. Verfügbar unter: http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/finkelstein/attitudes.pdf (Stand: 20.11.08)
Flick, Uwe/Kardoff, Ernst von/ Steinke, Ines (Hrsg.) (2007): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Flick, Uwe/ Kardoff, Ernst von/ Steinke, Ines (2007): Was ist qualitative Forschung? Einleitung und Überblick. In: Flick et al., S.13-29.
Flick, Uwe (2006): An Introduction To Qualitative Research. Third Edition. London/ Thousand Oaks/ New Delhi: Sage.
Forster, Rudolf (Hrsg.) (2004): Soziologie im Kontext von Behinderung. Theoriebildung, Theorieansätze und singuläre Phänomene. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
Friebertshäuser, Barbara/Prengel Annnedore (Hrsg.) (2003): Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim, München: Juventa Verlag.
Friebertshäuser, Barbara (2003): Interviewtechniken - ein Überblick. In: Friebertshäuser/Prengel, S. 371-395.
Froschauer, Ulrike/ Lueger, Manfred (2003): Das qualitative Interview. Zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme. Wien: WUV Universitätsverlag.
Ganter, Stephan (1997): Stereotype und Vorurteile. Konzeptualisierung, Operationalisierung und Messung. Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung. Verfügbar unter: http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/wp3-22.pdf (Stand: 26.11.08)
Goebel, Swantje (2002): Gesellschaft braucht Behinderung. Der behinderte menschliche Körper in Prozessen der sozialen Positionierung. Heidelberg: Winter.
Goffman, Erving (1967): Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Gollwitzer, Mario/Schmitt, Manfred (2006): Sozialpsychologie. Workbook. Weinheim: Beltz Verlag.
Gstettner, Peter (1982): Die nicht stattgefundene "Begegnung" oder: Zur fortgesetzten Abwertung von Abweichenden. Verfügbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/gstettner-begegnung.html (Stand: 4.10.08)
Güttler, Peter (2003): Sozialpsychologie. Soziale Einstellungen, Vorurteile, Einstellungsänderungen. 4. Aufl. München, Wien: R. Oldenburg Verlag.
Hähner, Ulrich (1999a): Überlegungen zur Entwicklung einer Kultur der Begleitung. In: Hähner et al., S. 121-152.
Hähner, Ulrich (1999b): Von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung. Fragmente zur geschichtlichen Entwicklung der Arbeit mit ‚geistig behinderten Menschen' seit 1945. In: Hähner et al., S. 25-52.
Hähner, Ulrich et al. (1999): Vom Betreuer zum Begleiter. Eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbstbestimmung. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
Hermann, Harry (2007): Interviewen als Tätigkeit. In: Flick et al., S. 360-368.
Hofinger, Veronika et al. (2007): Zur Implementation des Heimaufenthaltsgesetzes - Effekte des Rechtsschutzes auf die Kultur der Pflege. Wien. Verfügbar unter: http://www.irks.at/downloads/Zur%20Implementation%20des%20HeimAufG_Endbericht.pdf (Stand: 19.11.08)
Hohmeier, Jürgen (2004): Die Entwicklung der außerschulischen Behindertenarbeit als Paradigmenwechsel - Von der Verwahrung zur Inklusion. In: Forster, Rudolf (Hrsg.): Soziologie im Kontext von Behinderung. Theoriebildung, Theorieansätze und singuläre Phänomene. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, S. 127-141.
Hohmeier, Jürgen (1975): Stigmatisierung als sozialer Definitionsprozess. Verfügbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/hohmeier-stigmatisierung.html (Stand: 18.05.09)
Hollenweger, Judith (2006): Der Beitrag der Weltgesundheitsorganisation zur Klärung konzeptioneller Grundlagen einer inklusiven Pädagogik. In: Dederich, Markus/ Greving, Heinrich/ Mürner, Christian/ Rödler, Peter (Hrsg.): Inklusion statt Integration. Heilpädagogik als Kulturtechnik. Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 45-61.
Hopf, Christel (2007): Qualitative Interviews - ein Überblick. In: Flick et al., S. 349-360.
Huinink, Johannes (2005): BA-Studium Soziologie. Ein Lehrbuch. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
International Classification of Functioning, Disability and Health(ICF). Verfügbar unter: http://www.who.int/classifications/icfbrowser/ (Stand: 26.03.09)
Jansen, Gerd (1972): Die Einstellung der Gesellschaft zu Körperbehinderten. Eine psychologische Analyse zwischenmenschlicher Beziehungen aufgrund empirischer Untersuchungen. Rheinstetten: Schindele-Verlag.
Klapproth, Jürgen (1975): Die Anatomie von Einstellungen. Empirische Ergebnisse zur Feinstruktur einer Einstellung. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag.
Kobi, Emil (1993): Grundfragen der Heilpädagogik. Eine Einführung in heilpädagogisches Denken. 5., bearbeitete und ergänzte Auflage. Bern, Stuttgart, Wien: Verlag Paul Haupt.
Kowal, Sabine/O'Connell, Daniel (2007): Zur Transkription von Gesprächen. In Flick et al., S. 437-447.
Lamnek, Siegfried (2005): Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
Lindemann, Holger/ Vossler, Nicole (1999): Die Behinderung liegt im Auge des Betrachters. Konstruktivistisches Denken für die pädagogische Praxis. Neuwied: Luchterhand.
Maresch, Albert (2007): Sachwalterschaft, Unterbringung, Bewohnerrechte. In: Hofer, Hansjörg (Hrsg.): Alltag mit Behinderung. Ein Wegweiser für alle Lebensbereiche. Wien, Graz: neuer wissenschaftlicher Verlag, S 225-236.
Markowetz, Reinhard (2000): Identität, soziale Integration und Entstigmatisierung. Verfügbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/gl3-00-identitaet.html (Stand: 1.10.08)
Mattner, Dieter/ Gerspach, Manfred (1997): Heilpädagogische Anthropologie. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer.
Mayring, Philipp (2003): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim, Basel: Beltz.
Mayring, Philipp (2002): Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken.. Weinheim/Basel: Beltz.
Moosecker, Jürgen (2004): Der Symbolische Interaktionismus - Reflexionsfeld für die Heil- und Sonderpädagogik in mikro- und makrosozialer Perspektive? In: Forster, S. 103-126.
Nickel, Sven (1999): Gesellschaftliche Einstellungen zu Menschen mit Behinderung und deren Widerspiegelung in der Kinder- und Jugendliteratur. Verfügbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/nickel-einstellungen.html (Stand: 1.10.08)
Niedecken, Dietmut (1997): Namenlos. Eine Zusammenfassung der Inhalte meines Buches. Verfügbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/niedecken-namenlos.html (Stand: 4.10.08)
Niedecken, Dietmut (1998): Namenlos. Geistige Behinderung verstehen. Berlin: Luchterhand.
Niehoff, Ulirch (1999): Das zerstörte Selbstbild von Menschen mit "geistiger Behinderung". Mit Bezug auf Gedanken von Dietmut Niedecken. In: Hähner et al 1999, S. 91-102.
Nüesch, Manuela (2002): Stigmatisierungserleben und Stigma-Management. Eine empirische Untersuchung mit ehemaligen Klienten einer Tagesklinik. Luzern: Edition SZH/SPC.
Ostrom, Th.M. (1980): Wechselseitige Beeinflussung von Einstellungstheorie und Einstellungsmessung. In: Petermann, Franz (Hrsg.): Einstellungsmessung. Einstellungsforschung. Göttingen u.a.: Verlag für Psychologie Dr. C. J.Hogrefe, S. 37-54.
Petersen, Lars-Eric/ Six, Bernd (Hrsg.) (2008): Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung. Theorien, Befunde und Interventionen. Weihnheim, Basel: Beltz.
Puschke, Martina (2005): Die Internationale Klassifikation von Behinderung der Weltgesundheitsorganisation. Verfügbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/wzs-7-05-puschke-klassifikation.html (Stand: 26.03.09)
Reese, Ingeborg (2006): Menschenbilder in der Kinder- und Jugendliteratur. Eine Inhaltanalyse aus psychologisch-sonderpädagogischer Sicht. Hannover: Wilhelm Leibnitz Universität. Verfügbar unter: http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn= 981867790&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=981867790.pdf (Stand: 24.09.08)
Riegler, Franz (2005): Supervision für Richter. Welche Gründe für Inanspruchnahme gibt es? Verfügbar unter: http://www.bildungsmanagement.at/masterthesis/masterthesis_riegler.shtml (Stand: 29.07.09)
Robinson, Chloe/ Martin, Julia/ Thompson, Katarina (2007): Attitudes toward and perceptions of disabled people - Findings from a module included in the 2005 Brithisch Social Attitude Survey. Verfügbar unter: http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/robinson/ NatCenDisabilityModuleAug2007.pdf (Stand: 08.05.09)
Schmidt, Christiane (2007): Analyse von Leitfadeninterviews. In: Flick et al., S. 447-456.
Schillmeier, Michael (2007): Zur Politik des Behindert-Werdens. Behinderung als Erfahrung und Ereignis. In: Waldschmidt, Anne/ Schneider, Werner (Hrsg.): Disability Studies, Kultursoziologie und Soziologie der Behinderung. Erkundungen in einem Forschungsfeld. Bielefeld: transcript Verlag, S.79-99.
Schwinger, Thomas (2007): Einstellung zu geistig Behinderten. In: Arbeitspapiere aus der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt. Nr. 8 April 2007. Verfügbar unter: http://newhp.efhd.de/ download/forschung/Arbeitspapier_Nr_8.pdf (Stand: 1.10.08)
Schönwiese, Volker (2002): Phantom Behinderung? In: Hug, Theo/ Walter, Hans Jörg (Hrsg.): Phantom Wirklichkeit. Pädagogik der Gegenwart. Hohengehren: Schneider Verlag, S. 183-196.
Schönwiese, Volker (2005): Das gesellschaftliche Bild behinderter Menschen. Verfügbar unter: http://www.trafo-research.at/cms/multimedia/387.PDF (Stand: 24.09.08)
Schönwiese, Volker (2007): Vom transformatorischen Blick zur Selbstdarstellung. Über die Schwierigkeit der Entwicklung von Beurteilungskategorien zur Darstellung von behinderten Menschen in Medien. In: Flieger, Petra /Schönwiese, Volker: Das Bildnis eines behinderten Mannes. Bildkultur der Behinderung vom 16. bis ins 21. Jahrhundert. Neu Ulm: AG SPAK Bücher, S. 43-64.
Schönwiese, Volker (2009): Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe. Von der Rehabilitation zu Selbstbestimmung und Chancengleichheit. Verfügbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/schoenwiese-paradigmenwechsel.html (Stand: 15.02.09)
Sinason, Valerie (2000): Geistige Behinderung und die Grundlagen menschlichen Seins. Berlin: Luchterhand.
Thomas, Carol (2004): Theorien der Behinderung. Schlüsselkonzepte, Themen und Personen. In: Weisser, Jan/ Renggli, Cornelia (Hrsg.): Disability Studies. Ein Lesebuch. Luzern: Edition SZH/CSPS, S.33-56.
Theunissen, Georg (1999): Selbstbestimmung und Empowerment handlungspraktisch buchstabiert. Zur Arbeit mit Menschen, die als geistig schwer- und mehrfachbehindert gelten. In: Hähner et al. 1999, S. 153-168.
Tröster, Heinrich (2008): Stigma. In: Petersen/Six, S. 140-148.
Tröster, Heinrich (1988): Interaktionsspannungen zwischen Körperbehinderten und Nichtbehinderten. Verbales und nonverbales Verhalten gegenüber Körperbehinderten. Göttingen: Verlag für Psychologie Dr. C. J. Hogrefe.
UN (United Nations) (2006): Übereinkunft über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmte Übersetzung. Verfügbar unter: http://archiv.uni-saarland.de/mediadb/organisation/beauftragte/behinderte/Texte/Aktuelle-Infos/UNBehKonvention2009.pdf (Stand: 09.07.09)
Verein für Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft & Bewohnervertretung (2005): Heimaufenthaltsgesetz. Information über Bewohnerrechte. Verfügbar unter: http://www.vsp.at/fileadmin/user_upload/ 6_Bewohnervertretung/Heimaufenthaltsgesetz_web2.pdf (Stand: 2.11.08)
Waldschmidt, Anne (2007): Macht - Wissen - Körper. Anschlüsse an Michel Foucault in den Disability Studies. In: Waldschmidt, Anne/ Schneider, Werner (Hrsg.): Disability Studies, Kultursoziologie und Soziologie der Behinderung. Erkundungen in einem Forschungsfeld. Bielefeld: transcript Verlag, S. 55-77.
Ich erkläre hiermit an Eides Statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.
Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.
Innsbruck, August 2009
Katharina Angerer
Persönliche Daten:
Name: Katharina Angerer
Geboren: 1.2.1985 in Brixlegg
Familienstand: ledig
Staatsbürgerschaft: Österreich
Bildungslaufbahn:
1991-1995: Volksschule in Stumm im Zillertal
1995-1999: Hauptschule in Stumm im Zillertal
1999-2003: Bundesoberstufenrealgymnasium in Schwaz; Matura 2003
2004-2009: Studium der Pädagogik an der Universität Innsbruck
seit SS 2007 im Studienzweig Integrative Pädagogik und Psychosoziale Arbeit
seit WS 2007: Studium der Soziologie an der Universität Innsbruck
Berufliche Tätigkeiten:
2003-2004: Absolvierung eines Freiwilligen Sozialen Jahrs in den Crea-Reha-Werkstätten in Innsbruck (Einrichtung für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung)
2004-2009: Kinderbetreuung in der Skischule Optimal, Kaltenbach
2005-2007: Persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderung bei Selbstbestimmt Leben Schwaz
2007: 3-monatiges Praktikum im Haus Wilten der Lebenshilfe Tirol
2008: Betreuerin für Menschen mit Behinderung bei einer Ferienaktion der Caritas Innsbruck
2008-2009: Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung bei Selbstbestimmt Leben Innsbruck
Ferialjobs in Gastgewerbe, Handel und Industrie
Quelle:
Katharina Angerer: Bilder von Behinderung bei RichterInnen. Eine qualitative Studie zum Heimaufenthaltsgesetz
Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Leopold - Franzens - Universität Innsbruck; eingereicht von Katharina Angerer bei a. o. Univ. Prof. Dr. Volker Schönwiese
bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet
Stand: 10.11.2009
