Die internationale Theoriendiskussion von der Integration zur Inklusion und die Praxisentwicklung in Südtirol
Laureatsarbeit in Bildungswissenschaften, Freie Universität Bozen. Berufsbegleitender Laureatsstudiengang Bildungswissenschaften für den Primarbereich. Betreuer: Prof. Dr. Hinz Andreas und Prof. Boban Ines. Akademisches Jahr: 2002-2003
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Danke
- I. Zur Theoriendiskussion der Integration und Inklusion
- 1. Definitorische Annäherung an die Begriffe Integration und Inklusion
- 2. Die Salamanca-Erklärung
- 3. Das Konzept der Inklusion
- II. Konfrontation mit der Praxis
- 1. Die historische Entwicklung in Italien von der Segregation zur Integration und zum heutigen Ansatz der Inklusion
- 2. Rahmenbedingungen für die Integration in Südtirol
- 3 Leben und Lernen für alle Kinder in der Pflichtschule
- 4. Praxiserfahrungen im Widerspruch und Einklang
- III. Die Brennpunkte auf dem Prüfstand (Unterrichtsorganisation, Pädagogische Diagnostik, Bewertung, Teamarbeit) in Bezug auf die Theorie, die Praxis und die Perspektiven
- 1.Die Unterrichtsorganisation
- 2. Teamarbeit
-
3. Die pädagogische Diagnostik
- 3.1. Einleitende Gedanken
- 3.2. Ziele der Beobachtungen
- 3.3. Die Rolle des Lehrers in Bezug auf die Beobachtung
- 3.4. Die Qualität der Beobachtung
- 3.5. Die Angst vor der Diagnostik und Diagnostik mit Spaß
- 3.6. Die systemische Perspektive in der Diagnostik
- 3.7. Inklusive Perspektive - das diagnostische Mosaik
- 3.8. Fazit
- 4. Bewertung und Beurteilung
- IV. Zukunftskonferenzen als Schlüsselelement und Katalysator inklusiver Entwicklungen
- 1. Entwicklung inklusiver Perspektiven - Persönliche Zukunftskonferenz/Unterstützerkreis
- 2. Der persönliche Unterstützerkreis (Circle of friends)
- Nachwort:
- Literatur
Integration gehört zum Schulalltag und ist in Südtirol schon lange keine Besonderheit mehr. Unsere Gesellschaft unterliegt jedoch einem dauerhaften Wandel, der sich auch in unseren Schulklassen widerspiegelt und deshalb auch immer wieder neue Anforderungen an die Schule stellt. Die zunehmende Heterogenität in Lerngruppen und Klassen aufgrund verschiedener Kulturen, Sprachen und Lebensformen, aber auch in Bezug auf die Wahrnehmung individueller Kompetenzen, Interessen und Bedürfnisse erfordert eine veränderte Haltung in Bezug auf die Vielfalt der SchülerInnen. Die Schule der Zukunft heißt alle SchülerInnen in ihrem Sein willkommen und trägt somit zu einem veränderten Menschenbild bei, sie organisiert sich so, dass sie den Entwicklungs- und Lernbedürfnissen aller Kinder und Jugendlichen gerecht wird und nutzt die Vielfalt als Potential. Die Schule der Zukunft wird es allen SchülerInnen ermöglichen, Subjekte ihres Lebens zu sein, in Kooperation mit anderen an gemeinsamen Inhalten zu arbeiten und somit für die Vielfalt des Lebens zu lernen.
Da ich bereits seit 1989 in die verschiedenen Schulstufen im Bereich der Integration Einblick hatte, fand ich es für mich persönlich spannend, mich mit dieser Thematik umfassend auseinander zu setzen. Die Leser möchte ich, sofern es mir gelingt, auf eine neue Spur des Denkens führen, die nicht nur viele neue Möglichkeiten für den Unterricht und die Schule bietet, sondern auch neue Denkweisen anregen soll.
Im ersten Teil der Arbeit werde ich mich mit der Theoriendiskussion der Inklusion und Integration befassen, die eine definitorische Abklärung der beiden Begriffe unabdingbar macht. Auch ist es für mich wichtig auf ein internationales Dokument zurückzugreifen, welches von einer natürlichen Vielfalt ausgeht und das Recht auf Bildung und Erziehung für alle einfordert. Die Rahmenbedingungen für die Integration sollen die derzeitige Situation in Südtirol aufzeigen und Einblick in die verschiedenen Berufsbilder geben. Da der Einsatz der personellen Ressourcen nicht ohne Bürokratie einhergeht, müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden, die in einem weiteren Abschnitt der Arbeit aufgelistet und beschrieben werden. Da die Inklusion als Weiterentwicklung der Integration zu sehen ist und dies ein Prozess ist, der auch heute nicht abgeschlossen ist, finde ich es wichtig auch einen Rückblick in die Geschichte zu wagen. Der geschichtliche Ausflug vermittelt uns Eindrücke über die frühere Zeit und vermittelt Bilder, welche die Begriffe Segregation, Integration und Inklusion näher aufzeigen. Das Bild von der Schule von gestern lässt uns den langen Prozess bis zum heutigen Stand nachvollziehen und ermöglicht auch im praktischen Teil einen Blick in die Zukunft zu wagen. Nach dem Abschluss des theoretischen und geschichtlichen Kapitels, werde ich verschiedene Brennpunkte beleuchten, die für die Schulpraxis erhebliche Wichtigkeit haben. Damit auch in Bezug auf die Unterrichtsorganisation von inklusiver Qualität gesprochen werden kann, soll sowohl der individuellen Vielfalt der SchülerInnen, als auch den sozialen Interaktionen Rechnung getragen werden. Ein weiterer Brennpunkt ist die Teamarbeit, da inklusive Sichtweisen von Einzelpersonen nur sehr schwer getragen werden können. Meiner Meinung nach kann nur eine kooperative Zusammenarbeit im Unterricht die Vielfalt der SchülerInnen in angemessenem Maße berücksichtigen und entsprechend wertschätzen. Im Kapitel der pädagogischen Diagnostik wird es darum gehen, die selektive Funktion der Förderdiagnostik aufzuzeigen, die veränderte Rolle der Lehrperson zu erläutern und Möglichkeiten einer inklusiven, pädagogischen Diagnostik darzulegen, die für alle SchülerInnen geltend gemacht werden sollte. Da die Schule von heute nicht mehr nur ein Ort der Wissensvermittlung ist, sondern bemüht ist, gemeinsames Lernen aller SchülerInnen mit ihrer Vielfalt zu ermöglichen, erfordert dies auch eine veränderte Sichtweise in Bezug auf die Bewertung. Individuelle Entwicklungsfortschritte gilt es zu erkennen, wertzuschätzen und zu betonen, um somit zu Leistungsbeobachtungen zu gelangen, die nicht selektiven, sondern inklusiven Charakter haben.
Durch die Interviews, wobei kurze Auszüge im Text eingebaut werden, möchte ich unterschiedliche Meinungen anführen, aber auch hinderliche und erfreuliche Aspekte zum Ausdruck bringen. Für die Durchführung der Interviews wandte ich mich an die Inhaber der verschiedenen Berufsgruppen im Rahmen der schulischen Integration, um möglichst breit gefächerte Informationen zu erhalten. Dabei stützte ich mich auf das qualitative Interview,
-
da es das Prinzip des Alltagsgesprächs realisiert,
-
da es den Befragten zu Wort kommen lässt und er als Subjekt das Gespräch determiniert und er somit nicht reiner Datenlieferant ist,
-
weil es nicht völlig planbar und deshalb für unerwartete Informationen zugänglich ist,
-
weil ich darin als Forscherin auf die Bedürfnisse der Befragten eingehen kann (Lamnek 1993, S. 64),
-
weil es mir wichtig war, nicht nach einem starr formulierten Leitfaden vorzugehen, um eine möglichst natürliche und spannungsfreie Situation schaffen zu können,
-
weil ich dem Befragten jederzeit die Möglichkeit geben wollte, seine eigenen Erfahrungen, Ideen und Bedürfnisse einzubringen.
Der Befragte wurde lediglich aufgefordert, etwas über das jeweils gestellte Thema zu erzählen. Dadurch konnte eine Vertrauensatmosphäre geschaffen werden, die mir bei diesem Thema sehr wichtig war.
Die auf Tonträger aufgezeichneten Interviews wurden in der Mundart der betreffenden Person gehalten, da dadurch die gewohnte Sprache verwendet werden konnte und die Situation nicht befremdet wurde. Bei den Transkriptionen habe ich den Dialekt durch standardsprachliche Ausdrücke ersetzt, wobei ich die Syntax nicht verändert habe.
Ich hoffe mit meiner vorliegenden Arbeit einen Beitrag zu leisten, um dieses sehr komplexe Thema für den Leser überschaubarer zu machen. Vielleicht kann auch der eine oder andere Leser konkrete Anregungen für die Praxis erhalten.
Ich möchte diese Zeilen jenen Personen widmen, die mich bei der Laureatsarbeit unterstützt haben.
Mein besonderer Dank gilt meinem lieben Mann, der mich jederzeit positiv bestärkt hat und ohne den ich vielleicht das Studium niemals begonnen hätte. Ein weiterer Dank gilt meinen beiden Töchtern, Nora und Lena, die mich immer wieder ermunterten das Studium trotz beruflichen Zeitmangels und Belastung durchzuziehen, obwohl sie vielleicht auch gerne eine "stressfreie" Mami gehabt hätten.
Weiters möchte ich meiner Mutter danken, die keine Mühe scheute, mir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und auch meinen Kindern ein ruhiger Pol war.
Die Laureatsarbeit wurde unter der Betreuung von Frau Prof. Boban und Herrn Prof. Dr. Hinz geschrieben. Ich danke ihnen für den anregenden Austausch, die Unterstützung und Freundlichkeit.
Susanne Abram Nestl, Wiesen, im Sommer 2002
Um das Verständnis der internationalen Theoriendiskussion zu erleichtern und um in einem späteren Zusammenhang die unterschiedlichen Sichtweisen von Integration und Inklusion nachvollziehen zu können, ist es notwendig, dass zunächst eine definitorische Annäherung an die Begriffe Integration und Inklusion erfolgt. Die Abklärung der Begriffe erleichtert nicht nur das Verständnis weiterer Theoriediskussionen, sondern vermeidet auch eine Vermischung der beiden Begriffe.
Inhaltsverzeichnis
In dem weiterführenden Text werden die verschiedenen Sichtweisen der Integration und Inklusion durch wissenschaftlich belegte Aussagen näher erläutert, damit eine eindeutige Trennung der Begriffe ersichtlich wird.
HINZ spricht von zwei zentralen, teilweise synonym und unterschiedlich verwendeten Begriffen, deren Bedeutung mit zunehmender Verbreitung immer verschwommener wird (2002, S. 354-361). Erst durch das Reflektieren der beiden Begriffe kann die Sensibilität geweckt werden für die oft sprachlich auf den ersten Blick kaum erkennbaren Unterschiede.
Das Verb "integrieren" kommt vom lat. Verbum "integrare" (soviel wie "ergänzen"), das Adjektiv "integer" bedeutet so viel wie "unberührt", "ganz", die wiederum zurückgeführt werden können auf die Stammwörter "tangere" (=berühren); "tactus" (=Berührung); "intactus" (=unberührt, ganz).
Die gesellschaftliche Bedeutung erlangte der Integrationsbegriff über die Philosophie des 19. Jahrhunderts und vor allem dann durch die Soziologie, Psychologie und Bildungspolitik der Neuzeit (Eberwein 1997, S.71).
Eine erziehungswissenschaftliche Definition der "Integration" leistet FEUSER. Er bezeichnet als integrativ eine Allgemeine (kindzentrierte und basale) Pädagogik, in der alle Kinder und Schüler in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach Maßgabe ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen, in Orientierung auf die "nächste Zone ihrer Entwicklung" an und mit einem "Gemeinsamen Gegenstand", spielen, lernen und arbeiten. Integration ist somit als eine kooperative Tätigkeit der Subjekte im Kollektiv beschreibbar und somit unteilbar (1995, S. 173).
Auch AUSTERMANN betont, dass sich die Gemeinsamkeiten im Unterricht nicht auf die bloße Nutzung des gleichen Klassenraums beschränken dürfen und deshalb auch "besondere" Bezugspersonen, "besondere" Techniken und Hilfsmittel überdacht werden müssten (zit. in Biewer 2001, S. 223).
Mit Integration wird vielfach die gemeinsame Teilnahme von behinderten und nichtbehinderten Menschen an allen Teilbereichen des öffentlichen Lebens gesehen. Aber bereits die Sichtweise, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die als "nicht-behindert" gilt und es eine andere Gruppe gibt, die als "behindert" bezeichnet wird, verkörpert Diskriminierung und Ausgrenzung.
Da geht es in integrativ angelegten Situationen um "die einen" und um "die anderen", um die "Integration der einen" in den Kreis "der eigentlichen". Bereits durch die Sprache werden Gefühle des Trennenden forciert und gepflegt und dies hat auch schwerwiegende Folgen für die Integration (Boban 2000, S. 240).Auch durch die dargestellte Sichtweise von Integration wird klar, dass es sich um eine Zwei-Gruppen-Theorie handelt, wobei es gilt durch wechselseitiges Zugehen, Barrieren zu durchbrechen, die bereits durch die Sprache betont werden. Dies könnte aber auch die Vermutung zulassen, dass nicht alle Menschen, bzw. Schüler integrationsfähig sind und dass auch die Möglichkeit bestünde, eine Aufnahme derer, die von der Norm abweichen, in Frage zu stellen. Integration darf nicht als Anpassung an die Normen der Gesellschaft gesehen werden, sondern versteht sich als ein wechselseitiges Zugehen von behinderten und nichtbehinderten Menschen! FEUSER spricht in diesem Zusammenhang von "Auch"-Menschen, die auch die Schule besuchen dürfen, aber nach einem besonderen Lehrplan und betont, dass Integration nicht dazu beiträgt, die Segregation und Selektion zu überwinden, sondern diese unter Umständen legitimiert und festigt. "Integration" bleibt im Kern selektierend (1995, S. 134-135).
Integration darf nicht als Anpassung an die Normen der Gesellschaft gesehen werden, sondern versteht sich als ein wechselseitiges Zugehen von behinderten und nichtbehinderten Menschen! Die fehlende Integration wird von den Betroffenen häufig noch gravierender erlebt als die mit der Schädigung verbundene Lebenserschwerung (Hobmair et. al. 1996, S. 360).
In diesem Zusammenhang erscheint es sinnvoll, die Aussage eines querschnittgelähmten Mannes zu zitieren, der über seine persönlichen Empfindungen in Bezug auf seine Behinderung spricht: "Es ist nicht die Behinderung, die lähmt, sondern die Rolle des Outsiders nimmt uns die Möglichkeit der Bewährung: nicht das Mitleid tötet, sondern dass man es als Anmaßung empfindet, so wie die anderen sein zu wollen" (zit. in Klee 1981, S. 360). Die Aussage des querschnittgelähmten Mannes unterstreicht die Notwendigkeit einer Pädagogik, die davon ausgeht, dass menschliche Unterschiede zum Leben, zur Normalität gehören. In Bezug auf die Institution Schule bedeutet das, dass das Lernen an die Schüler angepasst werden muss und nicht umgekehrt, sich das Kind nach vorbestimmten Annahmen über das Tempo und die Art des Lernprozesses richten soll (Hausotter und Oertel 2000, S. 27). Es ist die Aufgabe der Integration die Segregation zu überwinden und dies ist nicht ein Anliegen, das von Einzelpersonen durchgeführt werden kann, sondern muss ein sozial-politisches Anliegen sein.
Integration wird in diesem Zusammenhang als ein Schritt in Richtung Chancengleichheit, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, sowie selbstbestimmtes Leben bewertet (Hausotter und Oertel 2000, S. 27).
Es darf nicht allein unsere Aufgabe sein, die Segregation zu überwinden, da dieser Schritt von mehreren Menschen mitgetragen werden muss. Es sind aber auch viele kleine Schritte der einzelnen Menschen notwendig, damit große Ziele verwirklicht werden können. Mit jedem einzelnen Schritt, den wir auch selber setzen können, gelangen wir dem Ziel etwas näher. Wenn wir uns der Wichtigkeit bewusst werden, mit der auch wir im Kleinen die Wirklichkeit verändern und beeinflussen können, ist unser Tun auch im kleinen Rahmen sinnvoll.
FEUSER spricht aber auch davon, dass unter der Vorgabe der Integration die Segregation und Selektion modernisiert und weiter gefestigt wird. Er sieht Integration nur auf den Terminus beschränkt. Auch HINZ betont, dass nicht "überall dort, wo Integration draufsteht auch Integration drinnen ist." FEUSER sieht die Allgemeine Pädagogik erst dann erfüllt, wenn eine Kooperation am gemeinsamen Gegenstand stattfindet und eine innere Differenzierung durch Individualisierung erfolgt. Erst dann können wir von einer integrativen Pädagogik sprechen und nicht in den Reproduktionszirkel der Segregation und Selektion zurückfallen (1995, S. 172-174). Die Kritik an der Integration, die von FEUSER und HINZ geübt wird, bezieht sich lediglich auf die Praxis der Integration, nicht aber auf die Theorien, die problemlos der Inklusion zugeordnet werden können. Sie betonen mit ihrer Kritik, dass lediglich das "Dabeisein" noch kein Garant dafür ist, dass auch wirkliche Integration stattfindet.
Dies erfordert eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Integration, da nicht zuletzt unter dem Vorwand der Integration Selektion legitimiert wird:
"In der Vision einer integrationsfähigen Schule werden Kinder unterschiedlichster Leistungsfähigkeit als gleichwertige Partner in das Beziehungsnetz der schulischen Bezugsgruppe (Klasse) aufgenommen; es gibt keine Geringschätzung wegen unterdurchschnittlicher Schulleistungsfähigkeit" (Haeberlin 1989, S. 267).
In diesem Zusammenhang wird klar, dass lediglich die strukturellen Voraussetzungen geschaffen wurden, damit eine Schule für alle möglich ist, dass es aber sehr wohl eine Gruppe gibt, die eine andere Gruppe, meist eine quantitativ kleinere, aufnehmen kann oder auch nicht.
Deshalb fordert SCHÖLER für die Zukunft, strukturelle Voraussetzungen mit einer inklusiven Qualität zu versehen (1995, S. 235)!
Fasst man den Begriff der Inklusion näher ins Auge, so wird klar, dass sich die Inklusion als eine "radikale Schulreform in Bezug auf das Curriculum, Leistungsbeurteilung, Pädagogik und Gruppierung von SchülerInnen" in einer Schule versteht, die die "Unterschiedlichkeit willkommen heißt und zelebriert, unabhängig von Geschlechterrollen, Nationalität, Rasse, Herkunftssprache, sozialem Hintergrund, Leistungsmöglichkeiten oder Behinderungen" (Mittler 2000, S. 10). Inklusion bedeutet, dass sich alle Schulen und Schulsysteme strukturell so verändern und allen Kindern offen stehen, um als inklusive Schule alle Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung willkommen zu heißen und ihnen gemeinsames Lernen zu ermöglichen. Ein gemeinsames Lernen meint, sich an den individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen eines Jeden zu orientieren (Hausotter 2000, S. 43). Die Botschaft von FOREST "Inclusion means WITH - not just IN!" (Forest et al. 2000, S. 246) trifft den qualitativen Unterschied zwischen der Integration und Inklusion auf den Punkt. Die Botschaft untermauert, dass der Weg der Inklusion nicht über schulische Separation erfolgt, auch nicht, wenn in einem "Schonraum" für den Schüler mit Beeinträchtigung die Möglichkeiten optimaler Differenzierung des Lehr- und Lerninhaltes geboten werden. Der "Schonraum", oder in vielen Schulen auch "Förderraum" genannt, bietet anstelle der angestrebten Integration, Isolierung und Aussonderung, da die Schüler aus ihrer Klassengemeinschaft herausgerissen werden und gemeinsames Lernen unterbunden wird (Haeberlin et. al. 1992, S. 18).
Inklusion geht mit einem veränderten Menschen- und Weltbild einher. Inklusion geht ab von dem Bild, das den Wert eines Menschen durch dessen Produktivität misst, geht ab von einem Bild, das Individuen aufgrund genormter Leistungskriterien als "defekt" und "defizitär" klassifiziert. Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch:
-
als Mensch vollwertig ist - unabhängig von irgendwelchen Leistungen, die ihn für die Gesellschaft oder für Teile der Gesellschaft wertvoll erscheinen lassen;
-
die Verpflichtung hat, alle anderen Menschen als Gleichberechtigte anzuerkennen;
-
das Recht hat, als Gleichberechtigter anerkannt zu werden;
-
auf die menschliche Gemeinschaft - auf Dialog, Kooperation und Kommunikation - angewiesen ist, um sich als solcher zu entwickeln;
-
als Subjekt seines Lebens und Lernens kompetent handelt;
-
das Recht auf "Mitsein", Teilhabe und Nicht-Aussonderung hat (Bintinger et al. 2002, S. 19).
Inklusive Erziehung respektiert Freiheit, Autonomie und Selbstbestimmung!
Damit der Unterricht den inklusiven Prinzipien gerecht werden kann, muss er dementsprechend vorbereitet und gestaltet werden. FEUSER spricht in diesem Zusammenhang vom Prinzip des "Gemeinsamen Gegenstandes" (1995, S. 179), bei dem die Schüler ein gemeinsames Programm mit unterschiedlichem Aufbau bewältigen. Das bedeutet, die Umgestaltung des Unterrichts für die Aufnahme heterogener Gruppen (Biewer 2001, S. 256). Im inklusiven Unterricht sind soziale Interaktionen zwischen SchülerInnen möglich und er fördert den Aufbau der Solidarität im gemeinsamen Schulalltag und auch darüber hinaus!
Im englischen Sprachraum wird inzwischen aus diesem Grund dem Begriff Inklusion der Vorzug gegeben. Gemeint ist damit das Inbegriffen-Sein und Sich-Inbegriffen-Fühlen, ein Ansatz, der alle Menschen willkommen heißt. Es müssen dann keine speziellen Menschen mehr extra von anderen von draußen hereingeholt, also "integriert" werden, sondern es ist selbstverständlich, dass das "Drinnen" von vornherein auf alle Menschen bzw. Schüler ausgerichtet ist und ein barrierefreier Zugang für alle ermöglicht wird. Denn auch nach HINZ ist das Dabei- oder Drinsein noch nicht alles (2002, S. 354-361)!
Gerade deshalb ist es für Pädagogen unbedingt erforderlich, dass sie den Begriff der Integration, aber auch integrative Situationen kritisch reflektieren und sich einen Traum von Schule imaginieren, die alle willkommen heißt, um der Verwirklichung von Inklusion näher zu kommen und da Qualität zu verbessern, wo es uns möglich ist (Boban 2002, S. 245).
Dafür wird es notwendig sein, die bis dato als sicher geltenden Strukturen in Frage zu stellen, sie zu verlassen, Vertrauen ins Neue zu bekommen und "neue Bilder in unseren Köpfen" entstehen zu lassen. Dass dieser Entwicklungsprozess auch von Unsicherheit und Angst geprägt ist, soll auch in den nächsten Zeilen veranschaulicht werden.
Ängste vor Unbekanntem,
vor der Auseinandersetzung mit Neuem,
davor, dass man bisherige Sicherheiten verlassen muss,
oft auch die Schwierigkeit, sich gemeinsames Lernen von Kindern und Schülern mit so unterschiedlicher Begabung vorzustellen,
sich als Lernende/Lernender unter Lernenden wahrzunehmen (Paggi 2000a, S. 16).

Abb.: Kinderzeichnung
Der Begriff der Integration unterscheidet sich vom Begriff der Inklusion insofern, als dass es bei der Integration von Menschen immer noch darum geht, Unterschiede wahrzunehmen und zuerst Getrenntes wieder zu vereinen. Inklusion hingegen versteht sich in Bezug auf Schule als ein Konzept, das davon ausgeht, dass alle SchülerInnen mit ihrer Vielfalt an Kompetenzen und Niveaus aktiv am Unterricht teilnehmen. Alle SchülerInnen erleben und nehmen Gemeinschaft wahr, in der jeder/jede Einzelne seinen/ihren sicheren Platz hat und somit eine Teilnahme für alle SchülerInnen am Unterricht möglich ist. Die inklusive Sichtweise garantiert für alle SchülerInnen "alles" auf ihre individuelle Art und Weise lernen zu können und ermöglicht darüber hinaus Gemeinsamkeiten.
Gerade um die Segregation von SchülerInnen zu vermeiden, sollten Unterschiede nicht forciert, sondern Gemeinsamkeiten wahrgenommen werden. Aus diesem Grund sollte es kein Nebeneinander geben, bei dem einige SchülerInnen nach eigenen "einschränkenden" Förderplänen unterrichtet werden, welche die Kategorienbildung begünstigen und Aussonderung ermöglichen, sondern es sollte um das Miteinander gehen, wobei die Vielfalt als Ressource genutzt wird. Die Sichtweise einer inklusiven Schule, in der Kategorisierungen und Ausgrenzungen keinen Platz haben, wirkt auch auf die Gesellschaft. Auch ANTOR gibt zur Hoffnung Anlass, dass Schule auf die Gesellschaft wirkt, die zunehmend die "Gemeinsamkeit als Voraussetzung sieht, wo Verschiedenheit und Anderssein, nicht nur des Menschen mit besonderen Bedürfnissen, sondern aller Minderheiten akzeptiert wird" (1988, S. 16).
Inhaltsverzeichnis
Am 7. bis zum 10. Juni 1994 trafen sich Delegierte von 92 Regierungen und 25 Organisationen zur Weltkonferenz über die Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Sie verabschiedeten die nach dem Tagungsort in Spanien benannte "Salamanca-Erklärung über die Prinzipien, Politik und Praxis in der Pädagogik für besondere Bedürfnisse". In der Salamanca-Erklärung wird Integration als Teil einer "sanften" sozialen Revolution, als eine humane Gegenströmung zu einer rationalen, auf den Kriterien der Leistung und Selektion beruhenden Konkurrenzgesellschaft gesehen. Hierbei handelt es sich nicht nur um eine neue Organisation von Unterricht und um neue Inhalte, sondern auch um ein Programm der Akzeptanz und Eingliederung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Das Programm der Akzeptanz und Eingliederung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen soll nicht nur auf die Schule beschränkt geltend gemacht werden, sondern soll auch für die Arbeitswelt und das Alter gültig sein. Kindergarten, Vorschule, Schule, Berufsausbildung und Arbeits-, Wohn- und Freizeitwelt sind genauso aufgerufen, über allfällige Veränderungen im Sinne eines humaneren Zusammenlebens mit "anderen" nachzudenken - und unter "andere" versteht man nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern meint auch die Vielfalt aller Menschen (Hausotter und Oertel 2000, S. 35).
Durch die Erklärung von Salamanca wird das internationale Bedürfnis nach Erziehung und Bildung für alle eindeutig gefordert. In Artikel 2 der Erklärung werden grundlegende Sichtweisen formuliert:
"Wir glauben und proklamieren, dass
-
jedes Kind ein grundlegendes Recht auf Erziehung und Bildung hat, und ihm die Gelegenheit gegeben werden muss einen angemessenen Bildungsstand zu erreichen und beizubehalten,
-
jedes Kind einzigartige Merkmale, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat,
-
Erziehungssysteme so konzipiert und Bildungsprogramme so ausgeführt werden sollen, dass sie der ganzen Verschiedenheit dieser Eigenschaften und Bedürfnisse Rechnung tragen,
-
jene mit speziellem Erziehungs- und Bildungsbedarf Zugang haben sollen zur allgemeinen Schule, die sich ihnen anpassen soll durch eine kindzentrierte Pädagogik, die diesen Bedürfnissen gemäß ist,
-
allgemeine Schulen mit dieser einbeziehenden Orientierung das wirkungsvollste Mittel darstellen um diskriminierende Einstellungen zu bekämpfen, aufnehmende Gemeinden zu schaffen, eine einbeziehende Gesellschaft einzubauen und Erziehung und Bildung für alle zu erreichen; darüber hinaus vermitteln sie den Kindern eine effektive Erziehung und Bildung und verbesserndie Wirksamkeit und schließlich die Kostengerechtheit des gesamten Erziehungs- und Bildungssystems" (Biewer 2001, S. 259, Übersetzung des Autors, die vorgenommene Übersetzung weicht von derjenigen der Österreichischen UNESCO-Kommission (1996) ab, welche nach Meinung des Autors bei einigen entscheidenden fachlichen Termini keine sprachlich und inhaltlich angemessene Auswahl trifft).
Die Salamanca-Erklärung unterstreicht somit das Recht auf Bildung für alle. Jedem Kind soll die Möglichkeit gegeben werden, ein akzeptables Lernniveau zu erreichen und zu erhalten. Schulen sollen alle Kinder einbeziehen, unabhängig von ihren körperlichen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen und sonstigen Voraussetzungen. Diese einbeziehenden Schulen praktizieren eine kindzentrierte Pädagogik. Sie geht aus von einer natürlichen Verschiedenheit der Kinder, der sie gerecht werden möchte. Sie setzt voraus, dass menschliche Verschiedenheiten normal sind und dass das Lernen folglich den Bedürfnissen der Kinder angepasst sein muss, anstatt dass das Kind vorher festgelegten Annahmen bezüglich des Fortgangs und der Natur des Lernprozesses angeglichen wird (Biewer 2001, S. 259-261). Im Aktionsrahmen, der von der Weltkonferenz angenommen wurde, spricht man von einem neuen Denken in der Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Ein grundlegendes Prinzip der integrativen Schule muss sein, dass alle Kinder miteinander lernen, egal welche Schwierigkeiten oder Unterschiede sie haben (Parmentier 1999, S. 124).
Die Salamanca-Erklärung geht von einer natürlichen Verschiedenheit, von einzigartigen Interessen, Eigenschaften, Fähigkeiten und Lernbedürfnissen der SchülerInnen aus. Erziehungssysteme, wie z. B. die Institution Schule können der Vielfalt gerecht werden, indem sie alle notwendigen Voraussetzungen schaffen, damit gemeinsames Leben und Lernen gelingen kann und individuelle Kompetenzen erkannt und zum Tragen kommen können. Nicht der/die SchülerIn müssen bestimmte Bedingungen, Kriterien oder Qualifikationen erfüllen, um in die Schul- und Klassengemeinschaft eingebunden zu werden (individuumszentrierter Ansatz), sondern die Schule hat den Auftrag, der Vielfalt gerecht zu werden (systemischer Ansatz). Somit spiegelt die Salamanca-Erklärung den Gedanken der Inklusion wider.
Inhaltsverzeichnis
Das Konzept der Inklusion versteht sich als eine allgemeine Pädagogik, die es mit einer einzigen, untrennbar heterogenen Gruppe zu tun hat. In ihr sind unterschiedlichste Dimensionen von Heterogenität vorhanden: verschiedene Geschlechterrollen, ethnische, sprachliche und kulturelle Hintergründe, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen, Familienstrukturen, soziale Lagen sowie Fähigkeiten und Einschränkungen kommen in ihnen vor (O'Brien und O'Brien 1997, S. 7). FEUSER bezeichnet die Allgemeine Pädagogik als demokratisch, denn alle Kinder und Schüler dürfen alles lernen. Diese Pädagogik ist human, da alle erforderlichen personellen und materiellen Hilfen jedem Kind oder Schüler möglicher Art und Weise und ohne sozialem Ausschluss zur Verfügung gestellt werden (1995, S. 173).
Die inklusive Klasse kennzeichnet sich dadurch, dass sie heterogen ist, aus diversen Mehr- und Minderheiten besteht und aus diesem Grund auch keine Integration für bestimmte SchülerInnen vorgesehen und benötigt wird. Inklusive Bildung darf nicht auf einzelne Klassen beschränkt werden, braucht keine Förderpläne für einzelne Schüler, sondern Strategien und Handlungskompetenzen der Lehrpersonen für die ganze Klasse mit all ihren Individualitäten. SANDER betont, dass durch eine individualisierte Förderung alle Kinder Fortschritte machen würden und jedes Kind in einer inklusiven Klasse zieldifferent lernen darf (Sander 2003, S. 128 - 129).
Homogenität und Heterogenität bezeichnen das Ausmaß von Unterschieden bezogen auf ein bestimmtes Merkmal. Das Alter des Schülers, die Familiensituation, das Geschlecht, die Religion, die Kultur, aber auch unterschiedliche Fähigkeiten, Stärken, Interessen und Einschränkungen stellen solche Merkmale dar. In der schulischen Praxis werden Kinder und Jugendliche gemäß ihres Alters in Jahrgangsklassen unterrichtet. Man geht davon aus, dass diese Gruppe an Schülern in sich homogen wären und somit auch gleiche Inhalte und Ziele erarbeiten und erreichen könnten.
Die Praxis zeigt sehr deutlich, dass diese Annahme ein Trugschluss ist, denn auch Schüler einer Jahrgangsklasse bringen sehr unterschiedliche Voraussetzungen mit, nehmen Informationen auf unterschiedlichste Art und Weise auf und verarbeiten Informationen auch sehr individuell. Zusätzlich ist anzumerken, dass schulische Inhalte nicht für alle Schüler in einer Schule die gleiche Bedeutung haben. Daraus kann man schließen, dass auch die unterschiedliche Motivation zusätzlich eine bedeutende Rolle spielt. Lerninhalte haben individuelle Bedeutung und Wichtigkeit in Bezug auf das Leben in der Schule, aber auch für das spätere Leben. Eine Jahrgangsklasse kann deshalb nur organisatorisch als homogene Gruppe verstanden werden.
Integrationsklassen sind an sich nicht heterogener als andere Klassen auch, trotzdem setzen Integrationsklassen die Heterogenität voraus. Die Inklusion sieht Heterogenität als Potential, als Ressource, die genutzt werden sollte. Gerade in Integrationsklassen ist es von großer Wichtigkeit, die Heterogenität der einzelnen SchülerInnen zu wahren und mit der Unterschiedlichkeit so umzugehen, dass trotz der gelebten Heterogenität positive Beziehungen zwischen allen Schülern entstehen können. Es müssen deshalb alle methodischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen werden, damit SchülerInnen ihre Individualität leben dürfen und der Unterricht als gemeinsamer Unterricht aller SchülerInnen erlebt werden kann. Der gemeinsame Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen ist ein Stück unserer Lebensrealität und erhebt den Anspruch auf Anerkennung. Laut BOBAN sind die Schüler einer Jahrgangsklasse sehr heterogen, aber weisen auch viele Ähnlichkeiten auf. In vielem verschieden und in vielem gleich: Gemeinsamkeit und Vielfalt (1998, S. 193). Gemeinsamkeit und Vielfalt, Gleichheit und Differenz bedeutet, dass es darum geht, Gemeinsames zu schaffen und Unterschiede, Trennendes zu benennen, zuzulassen und zu akzeptieren (Demmer-Dieckmann und Struck 2001, S. 13).
Wenn Heterogenität ernst genommen wird, so darf es nicht um Anpassung und "Gleichmacherei" gehen, sondern es muss darum gehen, Gemeinsames zu schaffen, Unterschiede und Trennendes zu benennen, zuzulassen und zu akzeptieren. Im gemeinsamen Schulalltag erhalten alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit Gemeinsamkeiten und Vielfalt zu erkennen. "Die Schüler haben die Gelegenheit zu lernen, dass normal ist, nicht ganz normal zu sein, sondern in vielem verschieden und in vielem gleich zu sein" (Boban 1998, S. 193).
FOREST spricht in diesem Zusammenhang von "Celebrate Diversity!" und unterstreicht die Bedeutung der Unterschiedlichkeit und fordert auch auf, diese zu zelebrieren (Forest et al. 2000, S. 238).
Inklusion heißt, dass der Fokus nicht auf die Homogenität gerichtet wird, sondern dass alle Kinder, alle Menschen ihre Vielfalt beibehalten, viel mehr noch, ausleben dürfen! Dass der einzelne Schüler sich von allen anderen Schülern in einer Klasse unterscheidet, ist die Realität in unseren Schulen. So individuell die Schülerinnen und Schüler in unseren Schulen sind, so ähnliche Wünsche besitzen sie! Es gibt Gemeinsamkeiten, die das Menschsein an für sich umfassen und diese dürfen nicht am Rande liegen bleiben. Es sind Wesenselemente wie z. B. die Unvollkommenheit, die Hilfsbedürftigkeit, das Streben nach Akzeptanz, die als Kennzeichen jedes Menschen gelten. Daraus folgt, dass alle Menschen eine gemeinsame Lebensgrundlage haben, auf der es gilt aufzubauen (Schor und Eberhardt 1994, S. 9). Es geht darum, Gemeinsamkeiten und Individuelles zu erkennen, erst dann wird ein Zusammenleben möglich sein, bei dem alle Menschen ihren Platz finden.
Auch HINZ betont die "Normalität" der Heterogenität. Eine Schulklasse kann deshalb als eine einzig, untrennbar heterogene Gruppe verstanden werden, wobei sich der Fokus nicht auf jene Kinder mit besonderen Bedürfnissen richtet, sondern Unterschiedlichkeiten in Bezug der Geschlechter, der sozialen Lage, ethnischer, sprachlicher und kultureller Hintergründe, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen, Familienstrukturen, unterschiedliche Fähigkeiten und Einschränkungen umfasst (2002, S. 354-361).
Inklusion legt Wert auf eine untrennbare Gruppe und widerspricht damit Institutionen, wie Behindertenzentren, aber auch individuellen Fördermaßnahmen, die in dafür vorgesehenen, individuellen Räumen ausgeführt werden. Aber auch Schulen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Heterogenität einer Klasse durch gleiche Inhalte und Zielsetzungen anzugleichen, stehen im Kreuzfeuer der Kritik. Durch gleiche Lehrpläne werden SchülerInnen im Laufe eines Schuljahres zu einer "scheinhomogenen" Gruppe heranwachsen, an den selben Inhalten arbeiten, die sie mit denselben Methoden vermittelt bekommen. Sie werden sogar an den selben Tagen Schularbeiten schreiben, möglichst die gleichen Fragen beantworten und zur gleichen Zeit ihre Arbeit abgeben.
Zum Schluss eines Schuljahres bekommen jene Schülerinnen und Schüler, die der Homogenität nicht gewachsen waren, die Chance in einer anderen Klasse ihre Homogenität zu beweisen!
Dies ist eine überspitzte Darstellung der bestehenden Schulsituation, die veranschaulichen soll, in welchem Maß die Vielfalt ausgelebt werden darf.

Abb. 1: In - Out (Pedrazzoli)
Die Praxis der Inklusion sieht Heterogenität als Normalität. Der Fokus wird nicht auf das Trennende gerichtet, also nicht mehr das, was uns von anderen unterscheidet, erhält die Aufmerksamkeit, sondern die Unterschiedlichkeit bekommt jene positive Wertschätzung, die dafür genutzt wird, miteinander - damit versteht man alle Beteiligten einer Klasse, auch Lehrpersonen - ein Stück des Weges im gemeinsamen Lernprozess zu gehen.
Das Zitat von FOREST "Inclusion means WITH - not just IN!" bestätigt,dass es sich nicht um eine rein organisatorische Aufnahme der Schüler mit besonderen Bedürfnissen handeln darf, sondern dass viel mehr dazu gehört. Mit wenigen Worten ist es Marsha Forest gelungen, die Qualität der Inklusion deutlich zu machen.
Es sind nicht die Äußerlichkeiten, die uns von anderen Menschen unterscheiden, die uns voneinander trennen, sehr wohl aber unterscheiden wir uns in unseren Denkweisen über Andersartigkeit, Unterschiedlichkeit, Vielfalt usw. Nicht der Mensch, der anders ist, muss verändert werden, sondern an den Einstellungen der Menschen muss gearbeitet werden! BOBAN betont, dass mit einem derartigen "Schubladendenken", bei dem Menschen mit Behinderung zu Objekten werden, die kategorisiert und stigmatisiert werden und wir, damit meint sie all jene, die ihre Individualität wahren dürfen, auf Kosten derer, die das nicht dürfen, zu ihren vermeintlichen positiven Gegenfiguren werden (2000, S. 241). Gerade aus diesem Grund ist es notwendig, die eigene Egozentrik zu reflektieren, um zu einer veränderten Sichtweise und Denkweise über Vielfalt und Verschiedenheit zu gelangen.
Es soll unser Ziel sein, Menschen, deren Lebensweise, deren Einstellungen anders sind als die eigenen, Wert zu schätzen, ohne egozentrische Selbstdarstellung, mit der man andere mit sich selbst vergleicht und das "Selbst" als Maßstab aller Dinge bezeichnet. Erst durch die Akzeptanz der Vielfalt kann die Vielfalt als Motor für den Prozess des Lernens innerhalb einer Gruppe, aber auch für das Zusammenleben im Alltag genutzt werden.
Die innere Einstellung zur Andersartigkeit soll verändert werden, damit das Zusammenleben zu einem befriedigenden Erlebnis für alle werden kann. Den Menschen als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sehen, wobei es nicht darum geht, durch Fähigkeiten und Stärken, Unfähigkeiten und Schwächen Klassifizierungen zu schaffen, sondern es darum gehen muss, den Menschen als Menschen wertzuschätzen. Diese Sichtweise erfordert nicht mehr Wege, die uns zusammenführen, wie es die Re-Integration vorsieht, sondern wir befinden uns bereits auf dem gemeinsamen Weg, wobei der Vielfalt jene Wertschätzung zukommt, die sie verdient. Jeder Schüler und jede Schülerin ist mit seinem/ihrem individuellen Sein willkommen, wobei im optimalen Fall die Vielfalt als Ressource erkannt und genutzt wird.
Es ist nicht mehr notwendig, sich für den Gemeinsamen Unterricht zu qualifizieren, da die heterogene Gruppe die Gemeinschaft bildet. Die nichtselektive (was kann er, was nicht) Sichtweise setzt der Klassifikation von Schülerinnen und Schülern ein Ende und eröffnet gemeinsame Wege.
Die Überlegung immer als heterogene, untrennbare Gruppe zu arbeiten, setzt bei Lehrpersonen und SchülerInnen neue Energien frei, die dafür genützt werden können, die Individualität eines jeden Schülers besser beobachten zu können und sich besser kennen zu lernen. Auch kann die freigesetzte Energie dafür verwendet werden sich bewusster mit methodisch-didaktischen Inhalten auseinander zu setzen und sich weniger mit organisatorischen Fragen zu befassen, sofern entsprechende Strukturen bereits vorhanden sind.
Es geht im Grunde darum, verinnerlichte Bilder der einen und der anderen Schüler, die nicht zuletzt durch Funktionsdiagnosen und Individuellen Förderplänen noch verstärkt zum Tragen kommen, zu verändern und festgefahrene Barrieren zu durchbrechen!
Auch HAUSOTTER merkt an, dass eine individuumsbezogene Förderung anhand eines individuellen Förderplans erahnen lässt, dass "Integration auch immer wieder Segregation mit sich zieht" (2000, S. 14) und deshalb nicht im Sinne des Konzepts der Inklusion anzusiedeln ist. Statt individuelle Förderpläne für das betreffende Kind zu erstellen, sollten sich Lehrpersonen Handlungsstrategien überlegen, damit alle Kinder einer Klasse in den Genuss kommen, die Individualität leben zu können und dabei soziale Interaktionen nicht zu kurz kommen. Das erfordert die Erstellung eines gemeinsamen, individualisierten Curriculums für die heterogene Gemeinschaft in einer Klasse.
Erst wenn der Vielfalt und Individualität der Schülerinnen und Schüler in der Schulpraxis Wichtigkeit und Aufmerksamkeit geschenkt wird, kann gemeinsamer Unterricht im Sinne der Inklusion gelingen.
Inklusion als Konzept legt den zentralen Schwerpunkt auf das Einbezogensein als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft (Lipsky und Gartner 1999, S. 13).
Ein vollwertiges Mitglied einer Klasse braucht keine Festschreibungen oder Zuschreibungen, die seine Schwierigkeiten aufzeigen und dadurch Stigmatisierung und Aussonderung legitimieren, sondern es braucht das Vertrauen in noch nicht erkennbare oder noch nicht ersichtliche Fähigkeiten. Das Vertrauen in die Schüler kann als Wurzel für alle Formen der Inklusion gesehen werden (Boban 2000, S. 242).
Der Wunsch nach einem normalen Leben, als individueller Mensch geachtet und in die Gesellschaft eingebunden zu sein, ist ein Grundbedürfnis aller Menschen. Das Bedürfnis nach Geborgenheit und Liebe, nach Geltung und Anerkennung sind Grundbedürfnisse, die eine hohe Bedeutsamkeit im Leben eines Menschen haben und sicherlich bei allen Menschen gleich angelegt sind.
Der Wunsch, als ganz "normaler" Mensch leben zu können, als ganz "normaler" Schüler die Schule zu besuchen, wird auch durch das Zitat von Ernst KLEE unterstrichen: "Der behinderte Junge bedankte sich für die Ohrfeige damals, weil ich der Erste gewesen sei, der ihm trotz seiner Behinderung wie einen ganz normalen Menschen behandelt habe" (1987, S. 89). Der veränderte Begriff von Normalität sieht keine abstrakte, am Individuum feststellbare "Förderbedürftigkeit", die sich aufgrund des "Behinderten-Syndroms" feststellen lässt, sondern spricht von einem Menschen, der in seiner Einzigartigkeit und situativen wie biografischen Besonderheit als Subjekt seines Lebens geachtet wird. Für die Schule bedeutet das, dass eine partnerschaftliche, dialogische Lebens- und Lernbegleitung angeboten werden sollte, bei der nicht von Hilfebedürftigkeit, sondern von Einzigartigkeit gesprochen wird (Wilhelm 2002, S. 22). Diesem Wunsch auch in der Schule gerecht zu werden bedeutet, dass Lehrpersonen die Lernumgebung so gestalten sollen, dass an einem gemeinsamen Gegenstand gearbeitet werden kann, d. h. dass Schülerinnen und Schüler elementare und fundamentale Bereiche behandeln, die sich entsprechen, wobei aber allen SchülerInnen die Möglichkeit gegeben wird, individualisierte Lernziele anzustreben und es auch möglich ist, individuelle Lernziele zu erreichen (Feuser 1995, S. 178-181). Der gemeinsame Gegenstand und das Willkommenheißen der Vielfalt sind wesentliche Bedingungen für das Gelingen der Inklusion! BOBAN fordert auf: Imaginieren wir den Traum von einer Schule, die alle willkommen heißt, täglich neu, um seiner Verwirklichung immer näher zu kommen und da Qualitäten zu verbessern, wo es uns möglich ist (2000, S. 245).
Die tabellarische Gegenüberstellung von integrativer und inklusiver Praxis ermöglicht einen zusammenfassenden Überblick.
Tab. 1: Praxis der Integration und Inklusion: (Hinz 2000, S. 235)
|
Praxis der Integration |
Praxis der Inclusion |
|
|
Inhaltsverzeichnis
Die einzelnen Phasen der Segregation, Integration und der heutige Ansatz der Inklusion gehen nicht fließend ineinander über und lösen sich auch nicht gegenseitig ab. Vielmehr tauchen einzelne Aspekte der verschiedenen Phasen immer wieder auch in anderen Phasen auf und gestalten so die Entwicklung widersprüchlich.
Wichtig erscheint die Auseinandersetzung mit der historischen Entwicklung deshalb, um einerseits die Prozesshaftigkeit der Entwicklung und anderseits die verschiedenen Sichtweisen aufzeigen zu können.
In der Zeit von 1870 bis 1900 wurde die Betreuung von Menschen mit Behinderung insbesondere von religiösen Einrichtungen und Gemeinden übernommen, da der Staat zu dieser Zeit noch keinerlei Initiativen ergriffen hatte. Bedeutsam für diese Zeit war die Initiative des Neuropsychiaters Sante de Sanctis, der um 1900 in Rom eine Heimschule für Kinder mit psycho-physischen Behinderungen errichtet hatte.
Zur selben Zeit bemühte man sich um die Ausbildung von Lehrern, die auf das Unterrichten von Taubstummen und geistig Behinderten vorbereitet werden sollten. 1908 wurden die ersten Sonderklassen eingeführt, die Schüler mit einer physischen oder psychischen Störung aufnahmen, die nicht in der Lage waren, eine Normalklasse zu besuchen. Bis zu dieser Zeit war der Andersartige, der "Verrückte" von der Erziehung praktisch ausgeschlossen (Schöler 1987, S. 35).
In diesem Zusammenhang kann man von Exklusion sprechen, da der Mensch mit Beeinträchtigung von Erziehung und Bildung ausgeschlossen wurde.
In der Reform des italienischen Schulwesens aus dem Jahre 1923 unter Bildungsminister Gentile ("Riforma Gentile") wurde die Schulpflicht auf 8 Jahre verlängert und sie sah außerdem die Bildung für einige Kategorien von Behinderten vor. Dieses Gesetz von 1923 befasste sich außerdem mit dem Problem des Bestehens verschiedener Artenvon Behinderung. Die Verlängerung der Schulpflicht auf 8 Jahre gelangte nie zur Anwendung (Schöler 1987, S. 35).
Ungefähr zur selben Zeit dieses Jahrhunderts wurden vom Staat Institutionen für die Erziehung von Behinderten, die als "heilbar" galten ins Leben gerufen. Es entstanden z. B. Sonderschulen für Blinde und Taubstumme. Die Regelschulen blieben jedoch den Schülerinnen und Schülern mit Behinderung jeglicher Art verschlossen. In der folgenden Zeit, vor allem im Laufe der 60er Jahre, erfolgte der Auf- und Ausbau des Sonderschulwesens mit zwei Arten von Sondereinrichtungen. Zum einen waren es die Sonderklassen, die sich rein räumlich in den Regelschulen befanden, zum anderen gab es noch die Sonderschulen, die institutionell getrennt waren. Die Sonderklassen nahmen nach dem Zweiten Weltkrieg jene Kinder auf, die mit ihren Familien auf der Suche nach Arbeit aus Süditalien in den Norden des Landes kamen (Schöler 1996, S. 17).
Diese Kinder hatten aufgrund der sprachlichen Barrieren Schwierigkeiten, dem Geschehen in der Schule zu folgen. Die Lehrpersonen sahen darin ein nicht zu bewältigendes Problem und entschieden, die "sozialbehinderten" Schüler in Sonderklassen aufzunehmen. In dieser Zeit kam es zu einer Überfüllung der norditalienischen Sonderklassen mit Kultur- und Sozialbehinderten (Schöler 1987, S. 36).
Erste schulische Maßnahmen traf der Staat in Bezug auf die Kriegsinvaliden, aber auch für Menschen mit einer Sinnesbehinderung. Die Menschen mit Behinderung wurden je nach Behinderungsart in Körperbehinderte und Geistigbehinderte, in Taubstumme und Blinde eingeteilt und in den Sonderschulen betreut. Es gab in Italien nur wenig staatliche Sonderschulen, da die Ausbreitung des Sonderschulwesens nicht jenen Anklang fand wie z. B. in den deutschsprachigen Nachbarländern.
In der italienischen Verfassung werden in dieser Zeit bereits einige Grundrechte der Menschen mit Behinderung festgelegt, die sich jedoch begrenzt auf die Schulgesetzgebung bezogen, so z. B. in Art. 34 "Die Schule steht jedermann offen" und in Art. 38: "Die Arbeitsunfähigen und Körperbehinderten haben Anspruch auf Erziehung und Berufsausbildung" (Paggi 2001, S. 1-5).
Bis zum Jahre 1962 konnte man vom Prinzip der Exklusion sprechen, da die SchülerInnen mit Behinderung in Bezug auf Bildung und Erziehung entweder völlig ausgeschlossen waren oder eine "Sonderbeschulung" stattfand, bei der "behinderte" und "normale" SchülerInnen voneinander getrennt wurden. Der Seperation wurde aber auch mit der Reform von 1962 kein Ende gesetzt. Die Reform sah zwar die Errichtung der Einheitsmittelschule vor, die eine einheitliche Beschulung aller Schüler bis zum 14. Lebensjahr bejahte und somit auch Kinder aus sozial-schlechtgestellten Familien die Schule besuchen mussten, doch beherbergte die Einheitsmittelschule auch Sonderklassen für SchülerInnen mit einer schweren Behinderung. In Artikel 12 des Gesetzes Nr. 1859 von 1962 heißt es klar und deutlich: "für nicht anpassungsfähige Schüler können Sonderklassen eingerichtet werden".Welche Schüler nun in diese Sonderklassen kommen sollten, wurde von einer Gruppe von Ärzten, Psychologen und Pädagogen entschieden (Schöler 1987, S.36). In den 70er Jahren, der Zeit der Reformen in Italien (Gesundheitsreform, Psychiatriereform, bei der z. B. die Betreuung der psychiatrischen Patienten in den geschlossenen Anstalten angefochten wurde) wurden auch die Schulstrukturen zunehmend in Frage gestellt (Schöler 1996, S. 18). Die Schule sollte Integration möglich machen und jeden Ausschluss in Bezug auf die Kinder mit Behinderung verhindern. Die Aufgabe der Schule hatte nicht mehr selektiven, sondern integrativen Charakter, da sie jedem Kind offen stand und sie sich die Förderung der persönlichen Entwicklung zur Hauptaufgabe machte (Schöler 1987, S. 37). Man erkannte, dass das bestehende Problem nur durch eine grundlegende Neuorientierung, mit der Eingliederung von Menschen mit Behinderung in die Regelschulen, gelöst werden konnte. Im Rundschreiben Nr. 227 vom 08.08.1975 wurde die Eingliederung der Behinderten in die Allgemeinschule vorgesehen. Dies sollte "durch die Umgestaltung und die Erneuerung der Allgemeinschule, die nach und nach in dieLage versetzt werden musste, auch jene Schüler aufzunehmen, die im Schulpflichtalter besondere Lern- und Anpassungsschwierigkeiten aufwiesen" (Schöler 1987, S. 37).
Auch in der italienischen Verfassung wird im Artikel 34 von einer Schule gesprochen, die "offen ist für alle". Der Orginaltext lautet: "La scuola è aperta a tutti. L' istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita (...)", (Livia Bellomo und Luise Ribolzi 1979, S. 226, zit. in Schöler 1996).
Das bedeutet, dass die Schule allen offen steht und die grundständige Ausbildung Pflicht und unentgeltlich ist (Schöler 1996, S. 18).
Im Zeitabschnitt zwischen 1962 bis zum Jahre 1977 wurden erste Versuche unternommen, SchülerInnen mit Behinderung in das Regelschulsystem zu integrieren. Die Integration beschränkte sich jedoch auf die bloße Anwesenheit, die physische Anwesenheit der SchülerInnen mit Behinderung, wobei Gemeinsamkeiten zwischen SchülerInnen ohne und mit Behinderung so gut wie nicht stattfinden konnten. Eine zusätzliche Barriere war die, dass die SchülerInnen mit Behinderung nicht aus dem unmittelbaren Einzugsgebiet stammten und somit eine Integration sich als schwierig erwies. Entscheidend für die Integration ist das Jahr 1977, da sich ab diesem Zeitpunkt die Integration nicht mehr nur auf die physische Anwesenheit der SchülerInnen mit Behinderung beschränkte, sondern man sich auch über die Qualität der Integration Gedanken machte und entsprechende Gesetze erließ.
Das im Jahr 1977 verabschiedete Gesetz Nr. 517 kann als Wendepunkt für die Qualität der Integration bezeichnet werden, da die gesetzliche Grundlage für die Integration von Schülern mit Behinderung in die Regelklassen der Pflichtschulen geschaffen wurde. Im Rahmen dieses Gesetzes wurden grundlegende Veränderungen der schulischen Gegebenheiten und Strukturen in Angriff genommen, damit es sich nicht mehr nur um die bloße Anwesenheit des Menschen mit Behinderung, sondern um die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung handeln sollte (Schöler 1996, S. 18).
Im Zuge dieses Gesetzes wurden weitere wichtige Bestimmungen erlassen, z. B.:
Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Klassen mit SchülerInnen mit Förderbedarf (max. 4 in einer Klasse, in der Regel sind es 1 - 2) ist auf 20 beschränkt. In solchen Klassen steht, abgesehen von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer, die Mitarbeit einer Stützlehrerin bzw. eines Stützlehrers zur Verfügung. Im Gesetz ist festgelegt, dass auf den Erhalt der Klasse geachtet werden sollte, d. h. eine Aufteilung der Klasse in zwei Lerngruppen nicht der Zielsetzung entsprach.
Mit dem Gesetz 517 werden die Ziffernzensuren abgeschafft, an ihre Stelle tritt ein Beurteilungsbogen, der den persönlichen Stand und Fortschritt jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers enthält. Die LehrerInnen erarbeiten am Anfang des Schuljahres gemeinsam ein Rahmenprogramm für das kommende Jahr. Sie sind u. a. angehalten zur Zusammenarbeit, zu fächerübergreifendem Unterricht und zu Projektunterricht (Schöler 1996, S. 18-19). In dieser Zeit erließ auch die Provinz Bozen im Rahmen ihrer primären Gesetzgebungsbefugnis entsprechende Gesetze:
-
Im Jahre 1978 wurde das erste spezifische Behindertengesetz (Landesgesetz vom 9. Dezember 1978, Nr. 65) erlassen, durch welches sich das Land erstmals mit eigenen Maßnahmen auf diesem Gebiet engagierte.
-
Im Jahr 1983 wurde das Landesgesetz Nr. 20: "Neue Maßnahmen zugunsten der Behinderten" erlassen (Paggi 2001, S. 1-5).
Im Jahr 1992 wurde das staatliche Rahmengesetz Nr. 104 verabschiedet, das grundlegende Neuerungen in vielen Bereichen mit sich brachte. Es sieht eine Vernetzung der verschiedenen Maßnahmen und Institutionen vor und es geht vor allem darum, die Rechte des Menschen mit Behinderung in allen Bereichen des Lebens zu definieren. Dieses Gesetz entwickelt ein Menschenbild, das die Autonomie und die Rechte des Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt stellt und Abschied nimmt vom Menschen mit Behinderung als Objekt von Maßnahmen. Es handelt sich hierbei nicht um ein spezifisches Schulgesetz, sondern um ein Rahmengesetz, das Bereiche der medizinischen, sozialen, arbeitspolitischen und schulischen Maßnahmen umfasst, das eine neue Sichtweise eröffnet (Paggi 2000b, S. 150).
1998 verabschiedete der Südtiroler Landtag ein entsprechendes Gesetz, das Landesgesetz Nr. 3 vom 8. April 1998 mit dem Titel: "Maßnahmen in Bezug auf die Betreuung, soziale Integration und Rechte der Menschen mit Behinderung".
Dieses Gesetz strebt folgende Ziele an (Art. 1, Abs. 2 des L.G. Nr. 3/98):
-
Die Gewährleistung der vollen Achtung der menschlichen Würde, sowie die Rechte auf Freiheit und Selbstständigkeit des Menschen mit Behinderung. Es fördert eine vollständige Eingliederung in Familie, Schule, Arbeit und Gesellschaft.
-
Das Gesetz beugt jenen Umständen vor bzw. beseitigt sie, die die Entwicklung der Person, die Erreichung der höchstmöglichen Selbstständigkeit und die Teilnahme des Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben, sowie die Realisierung der bürgerlichen, politischen und vermögensrechtlichen Rechte verhindern.
-
Das Land verfolgt die funktionelle und soziale Rehabilitation der Personen mit einer Behinderung physischer, psychischer und sensorischer Natur und gewährleistet die Dienste und Leistungen für Prävention, Heilung und Rehabilitation der Behinderungen, sowie den rechtlichen und wirtschaftlichen Schutz des Menschen mit Behinderung.
-
Das Land ergreift Maßnahmen zur Überwindung der Ausgrenzung und des sozialen Ausschlusses.
Im Landesgesetz heißt es wörtlich: "Die Wahrnehmung des Rechts auf Bildung und Erziehung darf nicht durch Lernschwierigkeiten oder Beeinträchtigungen, die sich aus der Behinderung ergeben, geschmälert werden" (Landesgesetz Nr.3). Das Landesgesetz Nr. 3/98 enthält weitere wichtige Rahmenbedingungen, die für die Integration ausschlaggebend sind:
-
In integrierten Klassen wird die Anzahl der Schüler reduziert.
-
Pro Klasse dürfen maximal ein bis zwei Schüler mit Behinderung zugewiesen werden.
-
Den Integrierten Klassen werden je nach Ausmaß der Behinderung spezialisierte Integrationslehrpersonen zugewiesen, sofern diese vorhanden sind. Die Integrationslehrer werden nicht ausschließlich den Schülern mit Behinderung zugewiesen, sondern der gesamten Klasse und sind somit gleichwertiges Mitglied des Klassenrates. Dadurch ist es möglich, den Unterricht durch integrative Unterrichtsformen zu verbessern und zu erleichtern.
-
Für jeden Schüler mit Funktionsdiagnose muss ein individueller Erziehungsplan erstellt, der dann die Grundlage ist für die individuelle Bewertung.
-
Die Schulen werden mit den notwendigen technischen und didaktischen Hilfsmitteln ausgestattet.
-
Bei Schülern, deren Behinderung eine kontinuierliche Betreuung erfordert, werden Behindertenbetreuer zugewiesen (Art. 1 Abs. 4/bis des Landesgesetzes Nr. 20/83).
-
Die Organisation der Erziehungs- und Unterrichtstätigkeit kann flexibel gehandhabt werden, auch in Form von offenen Klassen.
-
Die Erziehungskontinuität zwischen den Schulstufen, bzw. des Kindergartens wird in Form von Übertrittsgesprächen gewährleistet.
-
Es wird eine individuelle Begleitung und Beförderung der Menschen mit Behinderung von ihrer Wohnung zu den Stätten der Bildung und der Rehabilitation und zu außerschulischen Tätigkeiten gewährleistet.
-
In Bezug auf die Diagnostik und therapeutischen Angebote wird die Zuständigkeit den Sanitätseinheiten übergeben, die dann mit den Schulen zusammenarbeiten (Paggi 2000b, S. 154).
Das Gesetz 517 und das Landesgesetz Nr. 3 tragen dazu bei, dass strukturelle Maßnahmen getroffen werden können, um beeinträchtigte SchülerInnen zu re-integrieren, die in der Vergangenheit ausgegrenzt waren. Man bemüht sich im Zuge der Integration, die Isolation, die Segregation wieder rückgängig zu machen, indem man SchülerInnen mit einer Funktionsdiagnose in eine als homogen definierte Gruppe eingliedert. Der Fokus wird jedoch bei den vorher genannten Gesetzen noch auf den Schüler/die Schülerin mit Funktionsdiagnose oder den Menschen mit Behinderung gelegt. Dies ist besonders bei der Zuweisung der Integrationslehrpersonen ersichtlich, die aufgrund des Ausmaßes der Behinderung erfolgt. Das bedeutet, dass je "schwerwiegender" die Behinderung des Schülers oder der Schülerin ist, desto mehr Stundenkontingent wird für die Integrationsklasse beantragt und auch genehmigt werden. Personelle Ressourcen werden somit aufgrund der Etikettierung der SchülerInnen ermöglicht! Auch der Individuelle Erziehungsplan, der für die "besonderen" Schüler erstellt wird, fördert, da er nicht für alle SchülerInnen erstellt wird, die Zwei-Gruppen-Theorie (Schüler mit FD und ohne FD).
Ein weiterer wichtiger Schritt für die Entwicklung der Integration, aber auch für die Entwicklung der Schule allgemein, ist das Landesgesetz Nr. 12 aus dem Jahre 2000, das den Schulen die didaktische, organisatorische, sowie Verwaltungs- und Finanzautonomie überträgt.
Im Landesgesetz Nr. 12/2000, Art. 6, Abs. 1 heißt es:
"... die allgemeinen und spezifischen Ziele in Lernwege umzusetzen, die das Recht aller Schüler und Schülerinnen auf Bildung und Erziehung gewährleisten. Sie erkennen und nutzen die Unterschiede, fördern die Fähigkeiten jedes Einzelnen indem sie zweckdienliche Maßnahmen treffen, um den Bildungserfolg zu erreichen"
Das Gesetz zeigt eine enorme Entwicklung in Bezug der schulischen Integration auf. Im Mittelpunkt steht nicht mehr der "besondere" Schüler, der spezielle Defizite und Schwächen hat, die es gilt durch "besondere" Maßnahmen zu minimieren, sondern es geht um alle Schüler einer Schule. Es gilt, für alle Schüler Maßnahmen anzustreben, die sie für die individuelle Entwicklung benötigen. Integration wird somit ein Grundrecht für alle Schüler einer Schule und konzentriert sich nicht nur auf Schüler mit einer Beeinträchtigung. Es gilt, die individuellen Bedürfnisse, die spezifischen Fähigkeiten und Begabungen der Schüler zu erkennen und ressourcenorientiert damit umzugehen (Paggi 2000b, S. 152-153). Die Feststellung und die Maßnahmen, mit denen der Individualität und Vielfalt der SchülerInnen in einer Schule Rechnung getragen wird, kann als Ansatz der Inklusion bezeichnet werden. Durch das Landesgesetz wird jeder einzelne Schüler zu einem besonderen Schüler, indem seine Individualität und Vielfalt geachtet und respektiert wird und die individuelle Ausgangslage die Basis ist für den weiteren Lernprozess. Da durch die Vielfalt und Differenz aller Schüler der Fokus der pädagogischen Maßnahmen nicht mehr allein beim Schüler mit Beeinträchtigung liegt und die Schüler im Schulalltag die Erfahrung machen, dass die Verschiedenheit ein Teil der Normalität ist, kann von einem Ansatz der Inklusion gesprochen werden.
Inhaltsverzeichnis
Zu den Rahmenbedingungen für die Integration in Südtirol gehört auch der Einsatz personeller Ressourcen. Da die Integration nicht Aufgabe von Einzelpersonen ist, sondern die Zusammenarbeit von Rolleninhabern unterschiedlicher Berufsgruppen ist, wird es im nächsten Kapitel darum gehen, die verschiedenen Berufsbilder der schulischen Integration mit deren Aufgaben zu beschreiben.
Die Fachleute, die in Integrationsklassen zusammenarbeiten, haben ein gemeinsames Ziel: die schulische Integration. Die Arbeit mit dem Schüler/ der Schülerin mit Förderdiagnose kann nur als gemeinsames Anliegen aller am Integrationsprozess beteiligten Personen angesehen werden und kann auch nur dann gelingen.
Dabei darf es sich nicht um eine hierarchisch organisierte Zusammenarbeit handeln, sondern es geht um die Kooperation von Personen mit unterschiedlichen Aufgaben und Qualifikationen, die alle zur Verwirklichung eines gemeinsamen Erziehungskonzepts beitragen (Paggi o.J., S. 1-3).
Den Integrationsklassen wird je nach Schweregrad der Behinderung eine Integrationslehrperson und oder ein/e Behindertenbetreuer/in für eine bestimmte Anzahl von Stunden zugewiesen.
Wie im Landesgesetz 20/83 verankert, erfolgt die Verwirklichung der schulischen Integration unter anderem durch "die Zuweisung spezialisierten Betreuungspersonals für Menschen mit Behinderung, welches durch fachgerechte Maßnahmen die persönliche und soziale Selbstständigkeit sowie die Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit des Schülers mit Behinderung in Zusammenhang mit dem Lehrpersonal fördert." (Art. 21/ter, Abs. 1h)
Die Zuweisung von Behindertenbetreuer/innen erfolgt immer dann, wenn die Behinderung laut Art. 1 Abs. 4/bis des Landesgesetzes Nr. 20/83 als schwer einzustufen ist, d.h. "falls eine oder mehrere Behinderungen die persönliche Selbstständigkeit, entsprechend dem jeweiligen Alter, derart beeinträchtigt haben, dass sich eine ständige, kontinuierliche und umfassende Betreuung auf individueller oder Beziehungsebene als nötig erweist."
Die Behindertenbetreuer/innen werden nicht der Integrationsklasse zugewiesen, d. h. nicht allen SchülerInnen, sondern dem Schüler oder der Schülerin mit Beeinträchtigung. Sie verfügen über Kenntnisse in Bezug auf Behinderungsformen, therapeutisch-funktionale Maßnahmen und Maßnahmen zur Förderung der Autonomie. Sie bringen im Klassenrat Beobachtungen und Überlegungen zu den Schülern mit Funktionsdiagnose ein und arbeiten zusammen mit den Lehrpersonen an der Erstellung des Individuellen Erziehungsplans, wobei die dokumentierten Beobachtungen in Bezug auf die Entwicklung des /der Schülers/in mit Funktionsdiagnose mit einfließen. Die Behindertenbetreuer/innen setzen in Absprache mit den Lehrpersonen und mit den Fachkräften der Sanitätseinheit (Logopädin, Ergotherapeutin, Physiotherapeutin...) die im Individuellen Erziehungsplan festgesetzten Maßnahmen um und stehen dem/der Schüler/in mit Funktionsdiagnose in allen Erfordernissen des täglichen Lebens bei, wobei die Eigenständigkeit und Gesellschaftsfähigkeit gefördert werden soll. Sie haben die Aufgaben, den/die Schüler/in mit Funktionsdiagnose auf dem Weg in die verschiedenen Einrichtungen (Therapie, Schule - Elternhaus) zu begleiten, sie bereiten das Spiel-, Arbeits- und didaktische Material vor und halten Kontakte mit den Eltern, Experten, Lehrpersonen usw. aufrecht.
Der/die Behindertenbetreuer/in ist jedoch nicht Mitglied des Klassenrates, hat aus diesem Grund auch kein Stimmrecht, wenn es um Bewertungen oder Versetzungen des Schülers/der Schülerin mit Funktionsdiagnose geht.
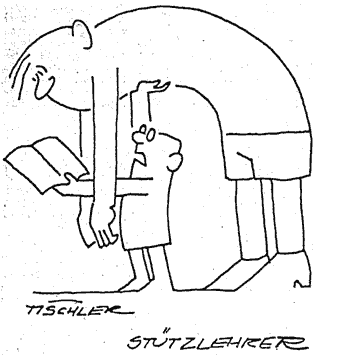
Abb. 2: Tischler 1998, S. 11
Den integrierten Klassen werden auch Integrationslehrpersonen zugewiesen. Diese werden den Klassen, nicht den einzelnen Schülern und Schülerinnen mit FD zugewiesen, mit dem Ziel einer zusätzlichen personellen Ressource für die schulische Integration im Klassenverband. Damit eine Zuweisung eines/einer Integrationslehrers/in erfolgt, ist ein psycho-diagnostisches Gutachten und das Ansuchen der einzelnen Schule notwendig, wobei der Schweregrad der Behinderung ausschlaggebend ist.
Die Zuweisung einer Integrationslehrperson erfolgt durch eine provinziale Arbeitsgruppe, die die Gutachten und Ansuchen bei ihrer Entscheidung berücksichtigt. (Paggi 1996, S. 817)
Laut Landesgesetz Nr. 20/83 Art. 21/ter Abs. 1g arbeitet die Integrationslehrperson "mit den Regellehrern in den Abteilungen und Klassen (zusammen), in welchen diese tätig sind und übernehmen gemeinsam die Verantwortung. Die Integrationslehrer nehmen somit teil an der didaktischen Planung, Erziehungsplanung und an der Erarbeitung und Überprüfung der Tätigkeiten im Kompetenzbereich der Klassenkonferenzen, der Klassenräte und der Lehrerkollegien. Die Integrationslehrer nehmen auch, immer wenn es von Nutzen für die Schüler mit FD erscheint, an den Sitzungen der funktionellen Betreuung und Rehabilitation teil." Die Integrationslehrperson ist vollwertiges Mitglied des Klassenrates in Bezug auf Planung, Umsetzung und Bewertung sämtlicher Schüler und auch vollwertiges Mitglied der anderen schulischen Gremien. Sie verfügt über Kenntnisse und Kompetenzen in Bezug auf Behinderungsformen, Möglichkeiten und Einschränkungen, Differenzierungsmöglichkeiten, spezifische Unterrichtsformen und Lehrmittel, erfasst die Ausgangslage und erstellt gemeinsam mit den Regellehrpersonen und Behindertenbetreuer/innen den IEP.
Sie ist:
-
Experte für integrative Unterrichtsformen und führt sie in Form von Teamunterricht auch durch,
-
Experte für fachübergreifende Kompetenzen
-
Experte für die Planung und Umsetzung von differenzierten Fördermaßnahmen
-
Experte für Differenzierungsmaßnahmen und integrative Unterrichtsformen.
Des Weiteren besitzt sie Kenntnisse in Bezug auf die Behinderungsform und deren Auswirkungen auf Lernen und Verhalten und bringt sie in den Unterricht ein, setzt spezifische Lehr- und Lernmittel ein und hält Kontakte mit Eltern, Experten, Lehrern usw. aufrecht. Sie koordiniert alle Maßnahmen zur Förderung von Schülern mit FD.
Jede Lehrperson im Team entscheidet sich innerhalb des Teams für eine Fächerkombination auf Grund ihrer besonderen Neigungen, Fähigkeiten und Erfahrungen. Die Lehrperson
-
agiert fachspezifisch und ist Experte für die Fachdidaktik,
-
ist Experte für fachspezifische Planung und Umsetzung und
-
ist auch zuständig für die Schüler mit FD.
Das Lehrerteam ist gemeinsam für alle Schüler verantwortlich. Es trifft sich regelmäßig zu Planungssitzungen, in denen der Unterricht gemeinsam besprochen und vorbereitet wird. Die Lehrpersonen regen sich gegenseitig an und tauschen Ideen und Erfahrungen aus. Sie widmen sich auch Kindern mit Lernschwierigkeiten, ohne dass die anderen SchülerInnen vernachlässigt werden, da der Teampartner in der Zwischenzeit mit ihnen arbeitet. Lerninhalte und Arbeitstempo können somit den einzelnen Schülern angepasst werden (Brugger 2001, S. 330-333).
Teamarbeit ist ein dynamischer Prozess, der nicht nur von den verschiedenen Berufsbildern geprägt wird, sondern auch von der Individualität der einzelnen Teammitglieder. Die Notwendigkeit der Teamarbeit bei integrativen Prozessen, die Ressource des Zwei-Pädagogen-Systems, aber auch die damit verbundenen Schwierigkeiten und Ängste werden im Kapitel Teamarbeit näher betrachtet.
In diesem Abschnitt geht es darum, den Weg aufzuzeigen, der durchlaufen werden muss, um in den Genuss von Fördermaßnahmen zu kommen. Die Bereitstellung der Ressourcen für die Integration von SchülerInnen mit Beeinträchtigung erfolgt erst dann, wenn bürokratische Kriterien erfüllt werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich auch mit Dokumenten wie die Funktionsdiagnose, das Funktionale Entwicklungsprofil und den Individuellen Erziehungsplan auseinander zu setzen.
Um in den Genuss von Fördermaßnahmen zu kommen ist in Italien die Feststellung der Behinderung bzw. einer gravierenden Störung durch die Dienste der Sanitätseinheit notwendig. Die Feststellung erfolgt entweder sofort nach der Geburt, sofern die Behinderung bzw. Störung bereits auffällt. Häufig werden aber im Kindergarten oder in der Grundschule die Störungen von der Kindergärtnerin oder Lehrperson beobachtet und auf Grund dessen erfolgt die Meldung an die Dienste der Sanitätseinheit. Die Meldung kann von den Eltern selber, aber auch von den Kindergärtnerinnen, Lehrpersonen über die Direktion-im Einvernehmen mit den Eltern-erfolgen.
Bei der Meldung eines Kindes mit Schwierigkeiten wird eine kurze Problembeschreibung vorgenommen. Diese Beschreibung wird vom Direktor der jeweiligen Institution unterschrieben. Die Erziehungsberechtigten werden von dieser Maßnahme informiert und erklären sich mit dem Ansuchen um eine umfassende Abklärung der Schwierigkeiten einverstanden. Von den Kindergärtnerinnen oder Lehrpersonen wird eine Beschreibung des derzeitigen Entwicklungsstandes in Bezug auf die Bewegung, die Selbstständigkeit, die Sprache und Kommunikation, die Wahrnehmung, die Kreativität, die Arbeitshaltung und Konzentrationsfähigkeit und das Sozialverhalten abgegeben. Das interdisziplinäre Team überprüft, ob es sich dabei um Defizite oder um Schwierigkeiten anderen Ursprungs handelt.
Die Feststellung der Behinderung bzw. der Störung wird Funktionsdiagnose (FD) genannt und wird im Leben eines Menschen mit Beeinträchtigung nur einmal im Leben erstellt und zwar bei der Erstmeldung. Sie erfolgt in interdisziplinärer Zusammenarbeit durch die Fachdienste der Sanitätseinheiten (Fachärzte, Psychologen, Therapeuten). Die Funktionsdiagnose soll die Stärken und Schwächen des jeweiligen Kindes beschreiben, um ein ganzheitliches Bild von den Entwicklungsmöglichkeiten und den Störungen zu erhalten, damit Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen entsprechende Maßnahmen für ihre erzieherische und didaktische Tätigkeit setzen (Paggi 2000b, S. 155-156).
Die Funktionsdiagnose definiert die Art der Behinderung oder Störung, enthält weitere relevante anamnestische Daten, beschreibt die Beeinträchtigungen und Fähigkeiten in den verschiedenen Entwicklungsbereichen und fasst diese zusammen. Auch enthält sie Vorschläge in Bezug auf therapeutische und schulinterne Maßnahmen, wie z.B. die Beseitigung architektonischer Barrieren, eine Reduzierung der Schülerzahl, Therapien, Zuweisung einer Integrationslehrperson, Zuweisung eines/er Behindertenbetreuers/in und einen erhöhten Bedarf an Stützmaßnahmen. Die Feststellung der Behinderung bildet die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen (Paggi o. J.).
Da diese Diagnose einmalig erstellt wird, besteht die Gefahr, dass sie bleibende Bedeutung hat, also stigmatisiert. Sofern es sich um einen Bericht von Entwicklungsmöglichkeiten handeln würde, so wäre durch den Prozess der Entwicklung auch Veränderung möglich und es bestünde nicht der Verdacht eines medizinisch, statischen Modells, das völlig veraltert ist (vgl. Theoriendiskussion).
Nach der Funktionsdiagnose wird das funktionelle Entwicklungsprofil erstellt. An der Ausarbeitung des FEP's sind alle Lehrpersonen der Klasse, Behindertenbetreuer/innen, Vertreter/innen der Sanitätseinheit und die Eltern/Erziehungsberechtigten beteiligt.
Das Funktionelle Entwicklungsprofil ist eine prozessorientierte Beschreibung, die den aktuellen Entwicklungsstand im kognitiven, sprachlichen, emotionalen und sozialen, motorischen Bereich, im Sinnesbereich und in der Selbstständigkeit, sowie vorhersehbare Entwicklungsmöglichkeiten in den genannten Bereichen aufzeigt.
Die Ausarbeitung des FEP's erfolgt dann, wenn ein Schüler mit FD in eine nächst höhere Schulstufe übertritt. Somit kann das FEP Aufschluss geben über den in der Zwischenzeit erreichten Entwicklungsstand und darüber, welche Möglichkeiten sich beim Schüler mit FD noch entwickeln können (Paggi 2000b, S. 156).
Für den Schüler mit Beeinträchtigung muss nach der Funktionsdiagnose in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen bzw. Kindergärtnerinnen, Behindertenbetreuer/in, Psychologen, Therapeuten und unter Mitarbeit der Eltern ein individueller Erziehungsplan ausgearbeitet werden. Der IEP beschreibt die integrierten Maßnahmen, welche für den Schüler mit Behinderung für einen bestimmten Zeitraum (in der Regel für 1 Jahr) vorgesehen werden, damit der Schüler das Recht auf Erziehung und Bildung verwirklichen kann. Der Individuelle Erziehungsplan enthält allgemeine Informationen zum Schüler/ zur Schülerin, wie z. B. Angaben zum Kindergarten- Schulbesuch, Angaben zur Familie, Angaben aus dem psychologischen und/oder ärztlichen Gutachten. Weiters enthält er die Ausgangslage in den Bereichen der Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz sowie die Zielsetzungen und Ergänzungen in Bezug auf die Kompetenzen.
Die fachspezifische Ausgangslage gibt Aufschluss über den derzeitigen Stand in den einzelnen Lernbereichen, wobei die lebenspraktischen Fertigkeiten und die Basisfunktionen miteinbezogen werden sollen.
Weiters werden alle Aussprachen im Klassenrat, falls diese den Schüler mit FD betreffen, die Aussprachen mit Eltern und Vertretern der Sanitätseinheit protokolliert, jeweils mit Datum, den Anwesenden und den getroffenen Vereinbarungen. Im Individuellen Erziehungsplan werden auch die differenzierten Lernziele und Lerninhalte in den einzelnen Lern- und Fachbereichen aufgezeigt sowie die Organisationsformen des Unterrichts, die spezifischen Fördermaßnahmen und/oder der Einsatz spezifischer Lehr- und Lernmittel. Im Individuellen Erziehungsplan werden auch jene Maßnahmen festgehalten, die außerschulisch, d. h. von der Familie am Nachmittag durchgeführt werden, wie z. B. eine Reittherapie, Besuch der Musikschule usw. Somit erhalten alle, die mit dem Schüler mit FD arbeiten, ein ganzheitliches Bild, das schulische und außerschulische Bemühungen vereint (Paggi 1996, S. 816). Die Ergebnisse der durchgeführten Maßnahmen werden immer wieder überprüft, mindestens zweimal jährlich, und falls notwendig, an den aktuellen Entwicklungsstand des Schülers mit FD immer wieder angepasst (Paggi 2000b, S. 156). Die Änderungen sollten mit dem Datum versehen werden, damit eventuelle Entwicklungsfortschritte oder -rückschritte auch terminlich dokumentiert werden. Alle Maßnahmen müssen möglichst präzise dokumentiert werden, da die genaue Beschreibung eine objektivere Beobachtung des Entwicklungsprozesses ermöglicht und auch als wichtige Informationsquelle bei einem Lehrerwechsel oder Schulstufenübertritt dient.
Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang, dass Lehrpersonen Dokumente, wie den Individuellen Erziehungsplan als zusätzliche Informationsquelle nutzen, sich aber vorher ein persönliches, unvoreingenommenes Bild des/der Schülers/in machen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, Berichte und Informationen erst dann einzuholen, wenn man das Kind persönlich kennen gelernt hat.
Laut Gesetz Nr. 104/1992, Art. 12, Abs. 3 ist es Aufgabe der Schule, die Möglichkeiten des Schülers mit Behinderung in den Bereichen
-
des Lernens
-
der Kommunikation
-
der Beziehungen
-
der Sozialisation zu fördern.
Es gilt also, die verschiedenen Bereiche nicht einseitig, sondern gleichwertig miteinander zu verknüpfen. Es sollte sich um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wissenserwerb, den kognitiven Kenntnissen und dem Erwerb von lebenspraktischen und sozialen Kompetenzen handeln. Die Wichtigkeit von Lernbereichen und Inhalten sollen von der individuellen Lebensbedeutsamkeit und vom persönlichen Leistungsvermögen des Schülers abhängen, wobei die Ziele nicht hoch gesteckt werden dürfen, sondern im Bereich der Möglichkeiten des Schülers mit FD liegen müssen. Er stellt somit ein personalisiertes Unterrichtsprogramm für den Schüler mit besonderem Förderbedarf dar, der einerseits dazu dienen soll, die am wenigsten einschränkende Lernumwelt und andererseits die beste Fördermöglichkeit zu finden. Die personalisierten Unterrichtsprogramme sollen für jedes Kind geschrieben werden, das eine spezielle Förderung braucht (Eggert 1997, S. 267).
In der derzeitigen Schulpraxis beschäftigt man sich besonders zu Beginn des Schuljahres damit, Fachjahrespläne für Regelschüler und Individuelle Erziehungspläne für SchülerInnen mit einer Funktionsdiagnose zu erstellen. Jede Lehrperson überlegt, mit welchen Inhalten sich die SchülerInnen im Laufe des Schuljahres auseinandersetzen sollen und welche Lernziele sie im kommenden Schuljahr erreichen möchte. Bereits die getrennte Erstellung der beiden Pläne lässt erahnen, dass es sich mehr um Trennendes, als um Gemeinsames handeln muss und dass bereits bei der Erstellung unterschiedlicher Pläne Grenzlinien zwischen den SchülerInnen einer Klasse gezogen werden.
Die Aufnahme der SchülerInnen mit einer Förderdiagnose ist in Italien gesetzlich geregelt und macht es selbstverständlich, dass alle Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen, während dies in anderen Ländern noch nicht zum Schulalltag gehört. In Südtirol besteht mit dem 6. Lebensjahr das Recht und die Pflicht auf den Schulbesuch, auch für das Kind mit besonderen Bedürfnissen. Das Kind mit besonderen Bedürfnissen wird nach neun Jahren effektiven Schulbesuchs von der Pflicht entlastet, hat aber weiterhin das Recht, die Schule bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zu besuchen. Die Aufnahme von Schülerinnen und Schüler mit Funktionsdiagnose stellt trotz der gesetzlichen Rahmenbedingungen immer neue Herausforderungen an die Schule, an Eltern, an Lehrpersonen und BetreuerInnen. Zu Beginn eines Schuljahres stehen viele Lehrpersonen vor einer neuen Situationen, in denen nicht nur die Flexibilität des Einzelnen gefragt ist, sondern eine produktive Zusammenarbeit einer gesamten Schule gefordert wird. Damit die Freuden und Schwierigkeiten, die sich aus diesem Prozess ergeben, verdeutlicht werden können, ist ein Exkurs in die Praxis notwendig. Die anschließenden Fallbeschreibungen versuchen den Einklang und Widerspruch der Praxis anschaulich zu machen.
Inhaltsverzeichnis
"Integration gelingt dort, wo sie gewollt wird," Gerd Harms, Kultusminister von Sachsen-Anhalt (Roebke et al. 2000, S. 258).
Vor einigen Jahren schulte Julia in die Mittelschule ein. Sie war bereits ein paar Jahre älter als ihre Klassenkameraden, trotzdem entschieden sich die Eltern und die Schulleitung damals dafür, Julia in die erste Klasse Mittelschule einzuschreiben und aufzunehmen. Julia besuchte, bevor sie zu uns in die Schule kam, eine Blindenschule, die ca. 60 km vom Elternhaus entfernt war und von der sich die Eltern eine bestmöglichste Förderung in Bezug auf die Sehbeeinträchtigungen ihrer Tochter erhofften. Julia besuchte die Blindenschule, an der auch ein Heim angesiedelt war und wo sie die ganze Woche verbrachte. Das Wochenende und die Ferien verbrachte Julia im Kreise ihrer Familie. Sie hatte einen kleineren Bruder und eine kleinere Schwester.
Julia hatte epileptische Anfällen, die in ihrer damaligen Schule immer häufiger auftraten. Aufgrund der Tatsache, dass montags die Anfälle besonders schlimm waren und sie sich auch im Laufe der Zeit dermaßen häuften, vermuteten die Eltern, dass Julia die Schule und vielleicht auch der Umstand vom Elternhaus entfernt zu sein, in diesem Ausmaß zu schaffen machten. Durch die Anfälle, die gehäuft montags am frühen Morgen auftraten, war ein Schulbesuch am Montag nicht mehr möglich und musste auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Nicht nur für Julia, auch für ihre Eltern war die gesamte Situation unerträglich. Die Eltern entschieden sich schließlich für den Besuch einer Pflichtschule in der nahen Umgebung, um auch mehr Zeit mit ihrer Tochter verbringen zu können. Mit dieser Entscheidung verzichteten die Eltern auf eine ‚optimale Förderung' in der Blindenschule. Unter ‚optimaler Förderung' verstanden die Eltern in diesem Zusammenhang die Ausstattung der Schule, die notwendigen technischen Hilfsmittel für Blinde, die ausgebildeten Fachkräfte für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung u. ä. Julia wurde trotz allem in die Regelschule eingeschrieben. Die Eltern äußerten zu Beginn offen ihre Bedenken in Bezug auf die Betreuung und Förderung ihrer Tochter in einer Regelschule und es erfolgten mehrere Gespräche, bei denen die Ängste der Eltern und auch der Schule nicht unausgesprochen blieben. Schließlich wurde von der Schulleitung optimale Betreuung zugesichert.
Bevor die Schule begann, wurden Sinnesmaterialien eingekauft, der Förderraum eingerichtet und es fanden informative Gespräche mit der Blindenschule statt.
Bevor der Schulalltag losging, teilten uns die Eltern von Julia mit, dass sie Bedenken hätten in Bezug auf die Geräuschkulisse in der Regelklasse und dass sie vermuteten, dass die Integration für Julia wahrscheinlich zu anstrengend sei. Sie äußerten Bedenken, dass sich auch die epileptischen Anfälle aufgrund des Lärmpegels häufen könnten.
Bereits am ersten Unterrichtstag wurden Betreuerin und Integrationslehrerin mit einem Erst-Hilfe-Täschchen ausgerüstet, das ein entkrampfendes Mittel in Form eines Einlaufes enthielt und das im Falle eines Anfalls benutzt werden musste. Die Angst auf beiden Seiten war groß. Die Eltern hatten Angst, ob sie wohl für ihre Tochter die richtige Entscheidung getroffen hatten; auf der Seite der Schule bzw. der Lehrpersonen hatte man Angst, in naher Zukunft mit einem schlimmen Anfall konfrontiert zu werden. Aus diesem Grund wurde auch ein Gespräch mit dem leitenden Arzt der Kinderstation als notwendig erachtet, der uns Lehrpersonen einen kurzen Einblick in das Krankheitsbild der Epilepsie ermöglichte und uns über die Maßnahmen der Erstversorgung aufklärte. Der Vater von Julia hatte immer wieder versucht, uns die Angst zu nehmen und betont, dass wir bei Julia im Falle eines epileptischen Anfalles "nichts falsch" machen könnten. Fast der gesamte Klassenrat war anwesend und wurde informiert, die Angst war aber dennoch groß, sodass sich einige Lehrpersonen im Laufe des Schuljahres weigerten, Supplenzstunden zu übernehmen.
Einmal in der Woche kam eine Expertin vom Blindenzentrum zu Besuch, die Julia sehr gut kannte und uns wertvolle Handlungsstrategien geben konnte. Da beide Bezugspersonen von Julia nie mit einem blinden Schüler oder einer blinden Schülerin gearbeitet hatten, war auch ihre Situation von Unsicherheit geprägt.
An jedem Schulmorgen und bei jedem Nachhausegehen tauschten sich Eltern, Großeltern, Betreuerin und/oder Integrationslehrerin über das Befinden Julias aus. Das war für uns in der Schule sehr wichtig, damit wir aufgrund der Tagesverfassung unseren Unterricht planen konnten, aber auch von den Familienangehörigen wurde es als wichtig erachtet. Nach einiger Zeit und auch aufgrund der Informationen der Expertin wurden einige Lücken in der Ausstattung der Schule, wie z.B. die raue Wand, an der sich Julia mit den Händen orientieren musste und deren Berührung für Julia unangenehm war oder auch das Stiegenhaus, das für Julia nicht geeignet war. Nur teilweise waren Filzstreifen an den Stufen angebracht, die die Orientierung für Julia erleichterten. Nach und nach wurden derartige Mängel zum Teil auch behoben.
Julia gefiel es in der Schule sehr gut, doch ihre degenerative Erkrankung erschwerte Julia zusätzlich das Gehen. Monat für Monat wurde es für Julia mühseliger. So beschlossen Betreuerin und Integrationslehrerin Julia zu zweit zu führen. Auch unsere regelmäßigen Spaziergänge, die Julia so sehr genoss, wurden nicht unterbrochen. Julia lachte immer und machte uns dadurch immer wieder Mut.
In der Regelklasse verweilte sie anfänglich häufig, dann aber traf sie selbst die Entscheidung die meiste Zeit im Förderraum zu verbringen. Während schulischer Tätigkeiten, wie z.B. Übungen mit dem Tastbrett, Memory, Perlen auffädeln usw. konnte Julia auch ganz ungestört mit uns über ihre altersgemäßen Probleme sprechen.
Julia bekam immer wieder Besuch von anderen Schülerinnen und Schüler, jeder kannte sie und grüßte sie im Schulhaus, obwohl es nicht üblich war, dass sich alle SchülerInnen kannten, da es eine verhältnismäßig große Schule war.
Julia kam gerne in die Schule und was alle erstaunte, war, dass Julia während der Unterrichtszeit nie einen epileptischen Anfall hatte.
Für viele Lehrpersonen waren Supplenzstunden bei Julia von Angst geprägt, besonders bei jenen Lehrpersonen, die mit Julia nicht ständig in Kontakt waren. Die Angst vor einem epileptischen Anfall saß sehr tief und dadurch wurde auch die Zusammenarbeit erschwert.
Julia lernte jenen Lehrpersonen, die mit ihr gearbeitet haben, viel. Sie zeigte uns, dass schulische Inhalte nicht für alle Schüler wichtig sind, dass Integration auch auf einer anderen Ebene stattfinden kann, nicht nur beim Gemeinsamen Unterricht, sondern im Schulalltag ganz allgemein. Vor allem lernten wir von Julia, wie glücklich man in jeder Lebenslage sein kann und wie wichtig soziale Kontakte für alle Menschen sind. Julia lernte uns aber auch an unsere eigenen Grenzen zu gehen. Sie zeigte uns in vielen Gesprächen, wie wichtig für sie die Auseinandersetzung mit dem Tod ist und wie fern diese Gedanken noch bei uns waren.
Julia starb im Sommer 2001 und hinterließ sehr viele Spuren.
An diesem praktischen Beispiel kann man erkennen, wie bedeutsam die erfolgte Integration für Julia, die zuvor ausgesondert beschult wurde, war. Man kann aufgrund dieses Fallbeispieles sagen, dass es keine ‚nicht integrationsfähigen' SchülerInnen gibt, die in Sonderinstitutionen beschult werden müssen und die die Funktion der Segregation erfüllen. Julia fand sich in der neuen Schule sofort angenommen, auch wenn technische Hilfsmittel, behindertenspezifische Ausstattung, ausgebildete Blindenlehrer nicht vorhanden waren. Die täglichen Kontakte mit anderen SchülerInnen und Lehrpersonen auf den Treppen, im Schulhof, auf dem Gang usw. machten Julia glücklich, auch wenn sie nur selten in ihrer Klasse war. Sie grüßte jeden, der an ihr vorbeiging und strahlte dabei.
Die Erfahrung mit Julia zeigen aber auch die Wichtigkeit des Aussprechens der Ängste. Ängste, die in diesem Fall Eltern, Lehrpersonen, Betreuerinnen und Schulleitung hatten und die in offenen Gesprächen gemindert werden konnten. Durch die offenen Gespräche konnte man sich nicht nur Hilfe holen, sondern sich auch gegenseitig Mut machen. Man hatte stets das Gefühl, mit seiner Angst nicht alleine zu sein.
Weiters soll dieses Praxisbeispiel aufzeigen, wie "unwichtig" technische Hilfsmittel, behindertenspezifische Ausstattung im Vergleich zum sozialen Kontakt sind. Julia trug dazu bei das Bewusstsein von Lehrpersonen und SchülerInnen zu schulen, indem sie uns zeigte, dass Integration auch bedeuten kann, nicht immer im Klassenverband zu sein, nur von Fall zu Fall, so wie Julia es für sich entschied. Julia hatte ihr Leben als Subjekt in die Hand genommen und das wurde von Seiten der Bezugspersonen akzeptiert, auch wenn diese eine andere Vorstellung von Unterricht und Integration hatten. Mit dem Fall Julia wird klar, dass jegliche Form integrativer Maßnahmen sich auf das Wohlbefinden der SchülerInnen auswirkt.
Das nächste Fallbeispiel soll eine inklusive Situation schildern, bei der von Seiten der Lehrpersonen versucht wird, am Gemeinsamen Gegenstand zu arbeiten und Gemeinsamkeiten aufzuspüren. Es soll aber auch aufzeigen, wie sich die gemeinsame Beschulung auf den Alltag eines Kindes wie Jasmin auswirkt.
Jasmin ist ein stets lustiges und quirliges Mädchen, das sehr gerne erzählt und sich mitteilt. In den ersten Schulwochen war Jasmin sehr nervös und zappelig. Sie schaffte es teilweise vor lauter Aufregung und aufgrund ihres Temperamentes nicht auf ihrem Stuhl sitzen zu bleiben. Jasmin kannte den größten Teil ihrer jetzigen Klassenkameraden bereits aus der Grundschule und fühlte sich in der Klasse sichtlich wohl. Durch ihre natürliche Art auf Menschen zuzugehen, kennt sie fast jeder in der Schule. In der Früh kommt sie mit ihrem Fahrrad in die Schule und bevor sie das Schulgebäude betritt, macht sie bei irgendeiner Schülergruppe halt und beteiligt sich am Gespräch. Jasmin ist bei fast allen Unterrichtsstunden in der Klasse und arbeitet außer in Mathematik am Programm der Klasse mit, nur in vereinfachter und für sie verständlicher Form. Da Jasmin sehr selbstsicher ist, fragt sie bei Unklarheiten nach oder verlangt von ihrer Seite Hilfestellungen.
Wenn Jasmin vor neuen Aufgaben steht, die sie bewältigen soll, geht sie immer mit einer sehr hohen Erwartung an sich selbst und mit Freude an die Arbeit heran. Sie behauptet von sich, dass sie "alles auf der Welt" kann. Gerade das macht das Arbeiten mit ihr zu einem ständigen Abenteuer und somit zu einem spannenden Erlebnis für alle Beteiligten!
Jasmin ist eine Schülerin, die bereits den Kindergarten und die Grundschule mit ihren Altersgenossen besucht hat. In der Grundschule, wie auch in der Mittelschule, verbrachte sie den Großteil der Stunden gemeinsam mit ihren Klassenkameraden. Dadurch konnten Gemeinsamkeiten entstehen und Freundschaften wachsen. Jasmin ist ein Beispiel dafür, wie Integration bzw. inklusive Ansätze auch nach der Grundschule möglich sind, auch wenn z.B. im Fach Mathematik differenzierte Programme notwendig sind und diese in Bezug auf den Inhalt keine Gemeinsamkeiten mehr zulassen. In den restlichen Fächern, wie z.B. Geschichte, Erdkunde, Naturkunde werden Inhalte so aufgefächert, dass es für alle SchülerInnen möglich wird, daran zu arbeiten. Dies erfordert von Lehrpersonen ein hohes Maß an Vorbereitung, gegenseitige Absprachen und eine Teamarbeit, die sich in ihren Kompetenzen ergänzt.
Die Praxisbeispiele zeigen auf, dass der Integrationsunterricht darauf abzielt, SchülerInnen wie Julia und Jasmin in ihrem individuellen Sein wertzuschätzen. Auch SANDER spricht von einem Unterricht, der den individuellen Entwicklungsstand, die individuellen Fähigkeiten, Neigungen, Interessen und die unterschiedlichen Lernrhythmen dafür nützt, zu einem individuellen Ziel zu gelangen. Es darf aber nicht bei einem individuellen Förderunterricht in der Regelklasse bleiben, sondern es geht um die Einbeziehung der individuellen Verschiedenheiten in den Unterricht und das Leben einer Schulklasse (2000, S. 14). Gerade die Einbeziehung der Verschiedenheit und der Individualität in den Unterricht erweisen sich in der Schulpraxis als schwierig. Am Beispiel Julia kann man erkennen, dass trotz trennender Unterrichtsinhalte Gemeinsamkeiten entstehen konnten, was aber dazu führt, dass soziale Interaktionen vermehrt gefördert werden müssen, z.B. durch Besuche im Förderraum. Am Beispiel Jasmin kann man erkennen, dass Inhalte für alle SchülerInnen so aufbereitet werden können, dass für alle etwas Geeignetes dabei ist und deshalb bereits bei fachlichen Inhalten Gemeinsamkeiten entstehen können. Lehrpersonen haben somit die Aufgabe, gemeinsames Leben und Lernen in der Schule möglich zu machen.
Daraus folgt, dass sich die Schwierigkeiten, die sich in integrativen Situationen ergeben, nicht auf die Vielfalt der SchülerInnen beziehen, sondern in der Planung des Unterrichts zu suchen sind.
Schulklassen sind keine homogenen Gefüge, sondern setzten sich aus SchülerInnen zusammen, die unterschiedliche Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen und Bedürfnissen mitbringen. Die vielfältigen Interaktionen einer Klassengemeinschaft gelten als Basis für den Prozess des Lernens. Dies erfordert von Seiten der Lehrpersonen, die Vielfalt wahrzunehmen, sie zu erkennen und die Vielfalt so zu nutzen, dass die SchülerInnen miteinander und voneinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau lernen. Der Fokus richtet sich somit nicht mehr nur auf das Kind mit Beeinträchtigungen, sondern im Zentrum steht die ganze Klasse mit ihren Schülerinnen und Schülern und deren Bedingungen. Dies erfordert die Kooperation aller am Erziehungsprozess beteiligten Personen, eine inklusive Diagnostik, eine neue Sichtweise von Bewertung und eine Unterrichtsorganisation, die Gemeinsames und Individuelles vereint.
Die einzelnen Brennpunkte werden zunächst theoretisch dargelegt, wobei auch die Praxis mit einfließt, weiters werden Aussagen der InterviewpartnerInnen in den Text eingebunden.
Inhaltsverzeichnis
Lehrpersonen sind in der Schule mehr denn je gefordert eine Balance zwischen der Vielfalt und den gemeinsamen Inhalten zu finden. Damit für alle SchülerInnen möglichst optimale Lernbedingungen geschaffen werden können, wird eine Unterrichtsorganisation erforderlich, die die Verschiedenheit der SchülerInnen bereits bei der Planung mit einbezieht. Aus diesem Grund wird es in diesem Abschnitt darum gehen, verschiedene Instrumente und Zeitdimensionen der Planung in Integrationsklassen zu beleuchten, damit in einem nächsten Schritt das Unterrichtsprinzip der Differenzierung erläutert werden kann, wobei die Heterogenität didaktisch reflektiert und genutzt wird. Jeder einzelne Schritt, jede einzelne Zeitdimension, jede Phase der Unterrichtsorganisation ist von bedeutender Wichtigkeit, vergleichbar mit vielen kleinen Ziegelsteinen, die aufeinandergestellt werden müssen, damit ein Haus entstehen kann. Die einzelnen Bausteine der Unterrichtsorganisation und die Einstellung der Lehrpersonen in Bezug auf die Vielfalt lassen inklusive Situationen entstehen, bei denen die Vielfalt zu einem bunten Erlebnis werden kann.
Wer sich auf den Weg macht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, braucht eine Karte oder einen Plan, auf der/dem die wichtigsten Informationen enthalten sind. Auch im Unterricht benötigen Lehrpersonen Meilensteine, die als Orientierungspunkte dienen (Awecker und Schratz 2002, S. 58).
Außerdem schaffen wir mit der Unterrichtsorganisation die Voraussetzungen dafür, ob Schwierigkeiten und Störungen, mit denen ein Kind in die Schule kommt, verstärkt werden oder ob man die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Kinder nutzt und in den Unterricht mit einbaut. Dies erfordert neue pädagogische Wege und vor allem aber eine veränderte Sichtweise über SchülerInnen mit FD.
Da die Teilnahme am gemeinsamen Lernprozess für alle Schüler grundlegend ist, um kognitive, kommunikative und soziale Lernprozesse anzukurbeln und weiterzuentwickeln, muss der Unterricht so organisiert und strukturiert werden, dass er den Bedürfnissen der Schüler gerecht wird.
Das Gelingen und der Erfolg der Integration liegt in der Hand der Planung des gemeinsamen Unterrichts, an dem mehrere Fachlehrer, Integrationslehrer und/oder Behindertenbetreuer, in manchen Fällen auch der/die SchülerIn beteiligt sind. Da der Unterricht jedoch ein Interaktionsgeschehen ist, lässt sich nicht jede Unterrichtshandlung völlig planen und beabsichtigen, nicht zuletzt deshalb muss im Unterricht auch oft improvisiert werden. Eine lineare Planung, eine Planung, bei der Abweichungen in der Praxis nicht möglich werden, verhindert Freiräume für Lehrpersonen und SchülerInnen und verhindert einen flexiblen Unterrichtsverlauf, in dem spontan Dinge aufgegriffen und erarbeitet werden können. Dies bedeutet aber nicht, dass der Unterricht improvisiert werden soll und keine Planung benötigen würde.
|
Eine Betreuerin, die bereits seit 10 Jahren im Bereich der Integration tätig ist, beschreibt ihre heurige Erfahrung wie folgt: "Mir recht wäre, wenn ich wüsste, was durchgemacht wird, weil ich mich dann auch besser vorbereiten könnte. Mir kommt vor, ich muss oft so flexibel und spontan sein und manchmal ganz schnell aus der Tasche etwas herauszaubern." (Interview Nr. 4) |
Durch die Planung des Unterrichts sollen Lehrpersonen und Schüler sich nicht gezwungen fühlen schematisch vorzugehen, sondern sie sollten dadurch ein sicheres Gefühl, einen roten Faden erlangen, der Lehrpersonen und Schüler durch den Unterricht begleitet. Dieses sichere Gefühl lässt dann auch Flexibilität und Spontaneität zu, so dass Abweichungen und Improvisationen nicht verunsichern oder gar Stolpersteine sind, sondern unter Umständen für alle Beteiligten fruchtbar sind.
Je mehr die Lehrpersonen den individuellen Interessen und Fähigkeiten der SchülerInnen ihre Aufmerksamkeit schenken, je mehr die Vielfalt der Kinder im Unterricht zum Tragen kommen darf, desto besser muss der Unterricht organisiert und geplant werden.
Ideal wäre es, wenn die individuellen Interessen und Fähigkeiten der SchülerInnen bereits bei der Planung miteinbezogen werden. Das gelingt, indem Lehrperson gemeinsam mit den SchülerInnen einer Klasse die Unterrichtsinhalte für die kommende Zeit besprechen. Somit kann der Unterricht den unterschiedlichen Interessen und Wünschen angepasst werden, wobei Schüler und Schülerinnen selbst mitbestimmen können. Sobald SchülerInnen beobachten, dass ihre Interessen und Wünsche ernst genommen werden, steigt auch ihre Motivation am Unterricht (Otto 1998, S. 61-62).
Damit der Unterricht den Wünschen und Ideen, Interessen und Fähigkeiten aller Beteiligten gerecht wird, sollen diese bereits bei der Planung miteinbezogen werden. Laut PAGGI muss der integrative Unterricht die Verschiedenheit der Schüler einer Klasse und die Individualität des Schülers mit FD berücksichtigen. Gemeinsames Lernen setzt voraus, dass bei der Planung eines gemeinsamen Unterrichts in Integrationsklassen individuelle, entwicklungsspezifische Ziele mit fachbezogenen Lernzielen verzahnt werden müssen. Es soll ein Bezug zu den spezifischen Zielsetzungen und Inhalten der Klasse hergestellt werden und gerade dies bedarf der gemeinsamen Planung aller Lehrpersonen einer Klasse. Die Planung darf aus diesem Grund nicht an Integrationslehrpersonen bzw. Behindertenbetreuer/innen delegiert werden (2002, S.17-18).
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Haltung der Lehrpersonen in Bezug auf die Vielfalt der SchülerInnen.
|
Eine erfahrene und ausgebildete Integrationslehrperson äußert sich auf die Frage der Zusammenarbeit, als Zentrum integrativer Prozesse, wie folgt: "wichtig ist die Haltung, die die einzelnen Personen der Vielfalt entgegenbringen, das ist für mich noch elementarer. Die Zusammenarbeit ist dann der zweite Schritt, welcher aus der Haltung heraus entsteht und die sehr wohl wichtig ist. Aber ich denke noch wichtiger ist die Haltung, dass Integration bzw. Inklusion als wichtig erachtet wird, dass es allen ein Anliegen ist. Die Haltung ist die Basis für die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und die Basis für eine sinnvollen Planung." (Interview Nr. 6) |
Aus diesem Grund ist Planung nicht ein Einzelprodukt, das im stillen Kämmerchen erfolgt, sondern ein Produkt aller Beteiligten des Unterrichts, wobei nicht zuletzt die Einstellung der einzelnen Lehrperson in Bezug auf die Vielfalt eine entscheidende Rolle spielt. Von großer Wichtigkeit sind auch die verschiedenen Instrumente der Planung, die eine Orientierungshilfe für Lehrpersonen darstellen.
Die Instrumente der gemeinsamen Planung in Integrationsklassen sind:
-
der Lehrplan, der allgemeine Ziele für alle Schüler einer bestimmten Schulstufe angibt und als gesetzliche Vorgabe gilt,
-
der Jahresplan, der sich an die Voraussetzungen und Bedürfnisse der Klasse anpasst und
-
der Individuelle Erziehungsplan, der wiederum spezifischer ausgerichtet ist und der sich an den individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen des Schülers mit FD orientiert.
Als Planungsinstrument in Integrationsklassen dient vor allem der Jahresplan der Klasse und der Individuelle Erziehungsplan, die noch näher erläutert werden.
Zu Beginn des Schuljahres wird für alle Schüler die Ausgangslage in Bezug auf ihre Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und Sachkompetenz ermittelt. Anhand der Ausgangslage werden Erziehungsziele formuliert und definiert, die den Schwerpunkt der Tätigkeit der Lehrpersonen bilden. Weiters wird im Jahresplan auf die Methoden des Unterrichts Bezug genommen, sowie auf die verwendeten Unterrichtsmaterialien hingewiesen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Kriterien für die Bewertung der SchülerInnen.
Beim Jahresplan muss laut PAGGI der Besonderheit der integrierten Klasse Rechnung getragen werden. Dies kann sich auf besondere Formen im Unterricht beziehen, auf soziale und kooperative Lernformen, sowie auf die innere Differenzierung, wobei aber auch die Formen der Kooperation zwischen Integrationslehrer, Behindertenbetreuer, Regellehrer angegeben werden sollen. Im Jahresplan müssen auch Besonderheiten in Bezug auf die Bewertungskriterien enthalten sein (2002, S.17-18).
Der Individuelle Erziehungsplan ist ein Planungsinstrument des Teams bzw. des Klassenrates in Bezug auf pädagogisch-didaktische Ziele, Inhalte, Methoden und Maßnahmen (Paggi 2002, S.17-18) und wird für die SchülerInnen mit FD erstellt (vgl. 2.2.3.).
BOBAN und HINZ kritisieren, dass Förderpläne in Bezug auf die Sichtweise der Inklusion die konzeptionelle Weiterentwicklung des Gemeinsamen Unterrichts behindern, da sie für einzelne Kinder mit Störungen und Defiziten geschrieben werden (2000, S. 133). Das führt zu einer Besonderung einzelner Kinder und fördert somit die Zwei-Gruppen-Theorie (vgl. 1.1.). Damit individuelle Erziehungspläne nicht aussondernde Funktionen übernehmen und damit SchülerInnen trotzdem zieldifferent lernen können, wird es notwendig sein, die Ausgangslagen aller SchülerInnen zu erheben, um davon ausgehend weitere Ziele zu formulieren.
Wichtig in diesem Zusammenhang erscheint die Zusammenarbeit mit den Eltern, die bei der Erarbeitung des Individuellen Erziehungsplans als Experten herangeholt werden sollen.
|
Auf die Frage der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen in Bezug auf den IEP antwortet eine Mutter wie folgt: "Sie haben mich schon gefragt, ob ich mit dem einverstanden bin, aber andererseits, was hätte ich sagen sollen? Sollte ich meine Wünsche wirklich einbringen, was ich mir für meinen Sohn wünsche? Es ist schon kurz angesprochen worden, ob ich nicht enttäuscht sein werde, wenn er am Ende des Schuljahres nicht lesen und schreiben kann, ich meine, enttäuscht bin ich klar, habe ich aber nicht gesagt, diese Blöße gibt man sich auch nicht. Aber irgendwo auch als Mutter für das Kind ein Ziel zu haben, bis da hin soll er kommen oder ---, wobei ich mir denke, er ist eh schon weiter gekommen, weiter, als wir es uns erwartet haben. Das ist jetzt mein Eindruck, das muss nicht der Eindruck der Lehrpersonen sein. Die Integrationslehrerin hat sich wirklich auch nicht erwartet, dass er beim Lesen so schnelle Fortschritte macht." (Interview Nr. 1). Auch sollten Eltern bei der gemeinsamen Erstellung des IEPs nicht jenes Gefühl verspüren, das eine Mutter im Interview geschildert hat: "Ja, und da habe ich auch das Gefühl gehabt, das ist jetzt wirklich mein Gefühl, das mir gesagt hat, misch dich da nicht zu viel ein, ich weiß nicht warum, aber da habe ich mir gedacht, lass die Finger davon!" (Interview Nr. 1). |
Die Schaffung einer angenehmen Atmosphäre ist für alle Beteiligten erforderlich, damit jeder einzelne sich traut, seine Ideen, Vorschläge und Wünsche für das Kind mit FD frei einzubringen.
Wichtig für den Gemeinsamen Unterricht ist zunächst die Ermittlung der Individualität der SchülerInnen. Der Entwicklungsstand des/der Schülers/in umfasst die individuellen Fähigkeiten und Interessen, Neigungen und Bedürfnisse. Bei der Erstellung der Ausgangslage stehen nicht die individuellen Defizite, die der Schüler mit FD - wie jeder andere Schüler auch - zeigt, sondern die Fähigkeiten und das Potenzial des Schülers. Es geht vor allem darum, die individuelle Persönlichkeit des Schülers zu erkennen, um in einem zweiten Schritt zu einer ressourcenorientierten Beschreibung zu gelangen, die sich auf das Potential des Schülers konzentriert, aber auch jene Bereiche aufzeigen soll, in denen die SchülerInnen mit FD noch besondere Hilfe benötigt.
Erst wenn die Lernausgangslagen der SchülerInnen mit FD erfasst wurden, wenn ihre persönlichen Kompetenzen und Interessen wahrgenommen wurden und noch bestehende Schwierigkeiten in den einzelnen Lernbereichen erkannt wurden, kann der Individualität der SchülerInnen mit FD im Unterricht Rechnung getragen werden.
|
Wie wichtig die Zusammenarbeit der Eltern in Bezug auf persönliche Kompetenzen der SchülerInnen ist, lässt die folgende Aussage einer Mutter erkennen: "Er hat wirklich den Ergeiz, den die anderen zwei", sie meint damit die Geschwister des Buben mit FD, "nicht gehabt haben und er bemüht sich auch so. Er ist einfach in der Früh früh auf. Dann holt er das Lesebuch, denn die Lehrerin hat gesagt, er solle lesen. Dann beginnt er um fünf Uhr früh zu lesen oder schaut sich die Bilder an und erzählt dazu Geschichten. Das kann er! Ich glaube, da liegen seine Fähigkeiten und ich glaube, dass er auch in seinem Leben noch zu etwas kommen wird. Ich denke nicht, dass er weiß Gott was werden muss, aber so kann er sich durchs Leben schlagen, da hat er einfach seine Qualitäten." (Interview Nr. 1). |
Vito PIAZZA zeigt auf, dass für Aktivitäten mit Schülern mit schwerer und schwerster Behinderung anfängliche Voraussetzungen erforderlich sind, bevor Zielanalysen erfolgen können. Aus diesem Grund muss sich die Lehrperson fragen, welche Fähigkeiten und welches Niveau das Kind mit besonderen Bedürfnissen bereits besitzt und in einem zweiten Schritt muss überlegt werden, was es besitzen muss, um das vorgeschlagene Ziel erreichen zu können (vgl. Rittmeyer 1999, S. 186).
Die fachspezifische Ausgangslage dient zur Beschreibung differenzierter Lernziele in den einzelnen Fächern, wobei eine Anlehnung an den Jahresplanes gegeben sein sollte. Hier gilt es für den/die Schüler/in mit FD zu überprüfen, inwieweit er/sie die Lernziele der Klasse erreichen kann und in welchen Lernbereichen differenziertere, weniger komplexe Lernziele angestrebt werden müssen bzw. welche Lernbereiche mitunter auch ersetzt werden müssen.
In der Schulpraxis zeigen sich gerade in diesem Bereich oft Schwierigkeiten. Die Lernziele der Klasse sind häufig für die SchülerInnen mit FD zu komplex, zu hoch gesteckt und sie verfügen nicht über die "notwendigen Voraussetzungen". Das heißt in der Praxis, dass je größer die Kluft zwischen dem Programm der Klasse und dem Individuellen Erziehungsplan ist, desto geringer auch die Gemeinsamkeiten im Unterricht wird. Die Problematik wird hier klar ersichtlich. Der Individuelle Erziehungsplan und der Jahresplan der Klasse sind zwar Planungsinstrumente, die auch in gemeinsamer Teamarbeit ausgearbeitet werden, aber sich meist nicht entsprechen. Damit ein integrativer Unterricht stattfinden kann, müssen Lehrpersonen Verbindungen und Gemeinsamkeiten suchen und arrangieren. Es liegt sozusagen in den Händen der Lehrpersonen, das persönliche Programm des/der Schülers/in mit FD soweit als möglich in den Unterricht, in die Aktivitäten der Klasse einzubauen oder auch nicht. Nur selten wird das Regelprogramm der Klasse so differenziert, dass auch SchülerInnen mit FD daran teilhaben können.
Der Individuelle Erziehungsplan enthält auch die anamnestischen Daten des/der Schülers/in mit FD, das sind alle Daten, die sich im Laufe der Lebenszeit angesammelt haben und wichtige Informationen liefern.
Damit Lehrpersonen den/die Schüler/in mit FD in seiner Komplexität begreifen lernen, ist seine persönliche Geschichte, das aktuelle Lebensumfeld, aber auch die Einflüsse außerhalb der Schule von Bedeutung. Allgemeine Informationen über den/die Schüler/Schülerin sind der Vor- und Nachname, das Geburtsdatum, der Geburts- und Wohnort.
Weitere wichtige Informationen erhält man aus den Angaben zum Kindergarten- und Schulbesuch des Schülers/der Schülerin mit FD und den Angaben zur familiären Situation. Zu den anamnestischen Daten gehören auch Angaben aus dem psychologischen und/oder ärztlichen Gutachten oder dem Funktionellen Entwicklungsprofil. Da Angaben aus psychologischen Gutachten oder aus Funktionellen Entwicklungsprofilen bereits längere Zeit zurückliegen können, sollten diesen Informationen nicht zu große Bedeutung in Bezug auf die Arbeit mit den SchülerInnen mit FD haben. Wichtiger erscheint, sich mit den Stärken, Fähigkeiten, Interessen und noch bestehenden Schwierigkeiten auseinander zu setzen, denn nur wenige psychologische Gutachten sind umfassend, ganzheitlich und ressourcenorientiert.
Das Instrument der Planung sollte nicht als starr und unvariabel gesehen werden, sondern sollte als Leitfaden für den Unterricht dienen. Es ist wichtig, auf aktuelle Situationen kurzfristig und flexibel einzugehen (Paggi 2002, S.17-18).
Die Maßnahmen und die erzielten Ergebnisse des IEPs werden immer wieder evaluiert und gegebenenfalls abgeändert, vereinfacht oder komplexer gestaltet. Veränderungen in Bezug auf die Lernziele müssen protokollarisch festgehalten werden, da sich auch durch den Vermerk über den Zeitpunkt der Veränderung, wichtige Informationen ergeben können. So kann ein Leistungsabfall auch mit veränderten familiären Strukturen, z. B. Geburt eines Geschwisterchens einhergehen und es ist in diesen Fällen notwendig, die Ziele vorübergehend zu reduzieren oder flexibel zu gestalten. Kurzfristige Veränderungen sollen auch dann unternommen werden, wenn Lehrpersonen merken, dass Schüler mit oder ohne FD besondere Interessen, Neigungen und Stärken für den behandelnden Lerninhalt zeigen. Der flexible Umgang , das heißt, gesetzte Ziele auch verändern zu können, erleichtert das Arbeiten und dient unter Umständen auch dazu, Frustrationen auf beiden Seiten zu vermeiden. Gerade diese Flexibilität zeichnet einen kindorientierten Unterricht aus und ist im integrativen Unterricht unabdingbar!
Bei der Planung des Unterrichts können Lehrpersonen die anstehenden Aktivitäten besprechen und diese in Hinblick auf die Fähigkeiten der SchülerInnen überprüfen. Dabei können Inhalte in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilt werden und eventuelle Schwierigkeiten im Vorfeld abgeklärt werden. Ziel der gemeinsamen Planung sollten nicht unterschiedliche, sondern gemeinsame Angebote sein. Auch RITTMEYER betont, dass die Angebote für das Kind mit besonderen Bedürfnissen soweit wie möglich keine verschiedenen und reduzierten Angebote sein sollen und die Integrationslehrpersonen somit die Aufgabe haben, als organisierender Filter zu wirken, der die Reize unterstreicht und manipuliert, dass sie auch für den Rest der Klasse geeignet werden (1999, S. 186).
Durch die gemeinsame Vorbereitung können Lehrpersonen die Lernbedürfnisse der SchülerInnen berücksichtigen und den Unterricht dementsprechend ausrichten. Dies erfordert aber auch ein Zeitmanagement, das die Unterrichtsinhalte in eine zeitliche Dimension rücken lässt.
Da die Monatsplanung für die Lehrpersonen gesetzlich nicht verpflichtend ist, sondern deren Handhabung frei steht, kann man unterschiedliche Tendenzen in der Praxis erkennen. Im folgenden Text gehen wir von optimalen Bedingungen aus, d. h. alle am Unterricht beteiligten Personen planen den gemeinsamen Unterricht monatlich.
Ausgehend von den Zielsetzungen und Maßnahmen des Individuellen Erziehungsplanes wird zwischen Fachlehrpersonen, Integrationslehrperson und BehindertenbetreuerIn eine monatliche Planung erstellt, bei der die Inhalte in groben Zügen besprochen werden und gegebenenfalls für den Schüler mit FD didaktisch so aufbereitet werden, dass die Teilnahme am Programm der Klasse gewährleistet werden kann.
In der Praxis bespricht der Fachlehrer mit dem Integrationslehrer, auch in Anwesenheit mit der Betreuerin oder des Betreuers jene Inhalte, die er in diesem Monat behandeln möchte. In einem zweiten Schritt wird gemeinsam überlegt, welche Inhalte bereits so aufgearbeitet sind, dass keine Differenzierung erfolgen muss, oder, ob Inhalte für den Schüler mit FD didaktisch anders aufbereitet werden müssen, wobei die didaktische Aufbereitung Aufgabe der Integrationslehrperson ist. Wenn die Absprachen in dieser Phase und in dieser Qualität erfolgen, kann das Ergebnis eines gelungenen Unterrichts jenes sein, dass alle Schüler am gemeinsamen Gegenstand arbeiten.
Die Wochenplanung ist vor allem dann notwendig, wenn mehrere Lehrpersonen, Integrationslehrperson und BehindertenbetreuerIn für einen Großteil der Unterrichtsstunden der Klasse zugewiesen sind, aber sich abwechselnd in der Klasse mit den Schülern und Schülerinnen arbeiten. Wichtig ist, wie bereits bei der Monatsplanung erwähnt, die Absprachen in Bezug auf methodische Vorgehensweisen, aber auch die Aufgaben- und Funktionsverteilungen an die verschiedenen Beteiligten zu besprechen. Nicht nur deshalb, damit die notwendigen Vorbereitungen getroffen werden können, sondern auch deshalb, damit die zu übernehmenden Rollen klar sind. Erst dann kann der Unterricht mit mehreren Lehrpersonen und BetreuerInnen gelingen.
|
Wie wichtig die gemeinsame Planung für die Qualität des Unterrichts ist, wird auch durch die Aussage einer Integrationslehrperson, die bereits 14 Jahre im Bereich der Integration tätig ist, bestätigt: "Wenn ich die Ausgangslage erstellt habe, setzte ich mich mit den verschiedenen Fachlehrern zusammen und bespreche das Programm. Meistens ist es so, dass der Regellehrer sagt, welche Ziele er mit der gesamten Klasse anstrebt und ich versuche die Inhalte so aufzubereiten, dass das Kind mit FD am Unterricht mitarbeiten kann. Ich versuche, so gut es geht, die Inhalte der Regelklasse zu vereinfachen, damit ein gemeinsamer Unterricht erfolgen kann. Das erfordert aber nicht nur die gemeinsame Planung zu Beginn des Jahres, sondern auch eine wöchentliche Planung mit all jenen Lehrpersonen, mit denen ich den gemeinsamen Unterricht gestalte. Dafür benötigt man Zeit, aber auch das Bemühen von Seiten aller Lehrpersonen. Bei der wöchentlichen Planung ist das dann so, dass jede Lehrpersonen sagt, was sie in dieser Woche mit der Klasse vor hat und ich mich entsprechend vorbereiten kann, bzw. Inhalte differenzieren kann" (Interview Nr. 7). |
Genauso wichtig wie die Planung ist aber auch die Nachbereitung des Unterrichts, wo mögliche Schwachstellen erläutert und verbessert werden können. Ein gemeinsames Feedback oder eine Evaluation steigert die Qualität des Unterrichts.
Eine flexible Arbeitsorganisation verlangt von den Lehrpersonen nicht nur einen großen persönlichen Arbeitseinsatz, sie müssen auch Neuem gegenüber offen sein, Bereitschaft zur Konfrontation zeigen, traditionelle Wege durchbrechen und gemeinsam neue Wege suchen (Vellas 2002, S. 32).
Durch die Evaluation der Planung können eventuelle Schwierigkeiten, die sich bei der Durchführung im Unterricht gezeigt haben, zur Sprache kommen und besprochen werden. Die gemeinsame Reflexion des Unterrichts führt nicht nur dazu, die Qualität des Unterrichts zu steigern, sondern auch die Kooperationen unter den Lehrpersonen zu fördern. Dabei versteht sich Kooperation nicht als Arbeitsteilung für bestimmte Tätigkeiten, sondern als gemeinsames Suchen nach Lösungen.
Feedback- und Evaluationsrunden sichern nicht nur eine regelmäßige Ergebnisse, sondern können auch dafür genutzt werden, Divergenzen oder Dynamiken zwischenmenschlicher Beziehungen zu berücksichtigen und darüber gemeinsam zu reflektieren (Gerard 2000, S. 33). Qualitätssicherung bedeutet somit, eine regelmäßige Evaluation möglich zu machen, aber auch Zeit in die Schulung und Fortbildung von Lehrpersonen zu investieren.
Auf dem Weg zu einer Schule für alle ist es notwendig, dass Lehrpersonen sich ständig weiter- und fortbilden. Eine inklusive Fort- und Weiterbildung von Lehrpersonen sollte den Inklusiven Gedanken, die Inklusive Haltung, das Inklusive Menschenbild an die Lernenden und Lehrpersonen herantragen und ihnen eine Pädagogik vermitteln, die allen SchülerInnen gerecht werden kann (Wilhelm 2002, S. 23). Gerade von Fort- und Weiterbildung für Lehrpersonen können Impulse für das inklusive Denken ausgehen, die von Lehrpersonen als Chancen gesehen und im Unterricht mit den TeamkollegInnen umgesetzt werden können. Da der Einfluss der eigenen Persönlichkeit der Lehrperson sich auf die Qualität des Unterrichts auswirkt sind Fort- und Weiterbildungen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung notwendig. Die selbsterfahrungsorientierte Persönlichkeitsentwicklung lässt vorhandene Potentiale und persönliche Ressourcen erkennen, die in einem späteren Moment im beruflichen Kontext umgesetzt werden können (Unterweger und Weiß 2002, S. 24) und somit allen SchülerInnen zu Gute kommen.
Weitere Schwerpunkte einer Fort- und Weiterbildung von Lehrpersonen sollten eine verstärkte Sensibilisierung der sozialen Wahrnehmung, sowie die Transparenz von persönlichen Werten in Interaktionen sein. Es sollte darum gehen, persönliche Kommunikations-, Interaktions- und Kooperationsstrategien bewusst zu machen und zu erweitern.
Das Bewusstmachen des eigenen Konflikt- und Gesprächsverhaltens, das Finden von Wegen und Strategien für ein konstruktives Miteinander sind unerlässliche Voraussetzungen für die Arbeit mit SchülerInnen, mit deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, mit KollegInnen und unerlässlich auch für die Arbeit im Team (Unterweger und Weiss 2002, S. 25).
Wenn derartige Fort- und Weiterbildung für Lehrpersonen angeboten und wahrgenommen werden, wird es in Zukunft auch für Lehrpersonen selbst eine Herausforderung sein, im Team zu arbeiten, den gemeinsamen Unterricht zu planen und zu organisieren.
"Differenzierung" kommt vom Lateinischen und bedeutet so viel wie "Unterscheidung", "unterschiedliche Beurteilung oder Behandlung". Die unterschiedliche Behandlung bezieht sich in Schule und Unterricht auf die SchülerInnen. Mit Unterschiedlichkeit meint man in diesem Fall die Schülerinnen und Schüler in einer Schulklasse, die trotz der selben Jahrgangsstufe sehr verschieden sind. Sie sind zwar gleich alt, haben aber biografisch verschiedene Entwicklungen durchlaufen, haben unterschiedliche Bedürfnisse, auch ihre körperliche und psychische Verfasstheit ist individuell, genauso wie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, ihre Lernvoraussetzungen und Lernweisen, ihre Wahrnehmungs-, Sprach- und Handlungskompetenzen, ihre Leistungsbereitschaft, ihre Einstellungen und Verhaltensweisen, sowie ihre Interessen und Neigungen.
Es werden unterschiedliche pädagogische und didaktische Maßnahmen notwendig, damit man als Lehrperson der Vielfalt einer Jahrgangsklasse gerecht werden kann und erfolgreiches Lernen aller SchülerInnen möglich wird.
Das Unterrichtsprinzip Differenzierung besagt, dass die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe oder Klasse schul- und unterrichtsorganisatorisch berücksichtigt werden soll (Wiater 2001, S. 26-39).
Die ausgeprägte Verschiedenartigkeit der SchülerInnen fordert ein Umdenken der Lehrpersonen, aber auch des ganzen Schulsystems. Es bedarf einer Unterrichtsorganisation, bei der die Individualität und Vielfalt aller SchülerInnen berücksichtigt wird und Schwierigkeiten nicht verstärkt zum Tragen kommen.
Differenzierung, so FEUSER, kann und darf nicht mit zieldifferentem Lernen verwechselt werden, denn dieses legitimiert die Segregation. FEUSER spricht davon, dass das Kind zwar rein physisch in der Klasse anwesend ist, rein formal dieser Klasse angehört, aber keine Gemeinsamkeiten zwischen den SchülerInnen stattfinden können (1995, S. 168-169).
Folge dessen bedeutet Differenzierung nicht, sich auf einen Schüler oder auf eine Schülerin zu konzentrieren und für sie ein differenziertes Programm zu erstellen, das seiner/ihrer Ausgangslage entspricht, sondern die Differenzierung muss auch Gemeinsamkeiten der Jahrgangsklasse oder Lerngruppe berücksichtigen. Differenzierung sollte sich aus diesem Grund nicht nur auf die individuelle Betreuung innerhalb eines Gesamtsystems, einer Klasse beziehen, sondern sollte als Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand nach FEUSER verstanden werden. Um die individuelle Förderung und die soziale Integration innerhalb einer Klasse gleichzeitig zu fördern, muss der "Kooperation am gemeinsamen Gegenstand" und der "inneren Differenzierung durch Individualisierung" Rechnung getragen werden. Integration sollte als kooperative Tätigkeit der Subjekte im Kollektiv verstanden werden (1995, S. 174-175).
In der alltäglichen Erziehungs- und Unterrichtsaktivität müssen Lehrpersonen aufgrund der Ausgangslagen und Entwicklungen der SchülerInnen sich immer wieder neu überlegen, wann es an der Zeit ist, gleiche oder individuelle Ziele anzustreben. Eine häufige Form in der Schulpraxis ist die innere Differenzierung, bei der der Vielfalt durch unterrichtsorganisatorische Maßnahmen Rechnung getragen wird.
Bei der inneren Differenzierung bleibt die Jahrgangsklasse erhalten, wobei die Heterogenität didaktisch reflektiert und genutzt wird. Die wesentlichen Ziele sind die individuelle Förderung und die soziale Integration (Wiater 2001, S. 29).
Der Unterricht muss demnach so organisiert sein, dass einmal die individuelle Arbeit, aber auch die Arbeit in Gruppen im Vordergrund steht. Somit haben alle SchülerInnen die Möglichkeit auf sich selbst zu achten, in ihrem bevorzugten, eigenen Tempo zu arbeiten und gleichzeitig sind sie Teil des sozialen Kontextes. Der Erwerb von Wissen und Können ist demzufolge ein Nebenprodukt, das ganz selbstverständlich entsteht. Dadurch, dass den SchülerInnen die Selbstbestimmung zugesprochen wird, können sie angstfrei agieren und übernehmen nach und nach die Verantwortung für ihr Tun. Bereits Maria Montessori und Celestin Freinet haben wichtige Forderungen für einen Unterricht gestellt:
-
Weg mit dem Unterricht, in dem alle Schüler zur selben Zeit dasselbe tun müssen!
-
Weg von der überwiegend zweidimensionalen Welt der Bücher und Arbeitsblätter! Hin zu wirklichem Tun (Springer 1990, S. 40-41).
Das bedeutet, dass gemeinsames Lernen nicht davon bestimmt wird, dieselben Arbeitsblätter zur selben Zeit auszufüllen, die selben Merksätze im Heft stehen zu haben, nach dem gleichen Punktesystem bewertet zu werden, sondern eine Unterrichtsorganisation verlangt, die alle Sinne und die Vielfalt der SchülerInnen beim Lernen nutzt und jedem Schüler, jeder Schülerin den benötigten Raum dafür gewährt.
WIATER spricht davon, dass beim Nichtbeachten von Entwicklungsbesonderheiten von Kindern und Jugendlichen nicht nur der Erfolg für schulisches Lernen aufs Spiel gesetzt wird, sondern es entsteht vom ersten Schuljahr ein Teufelskreis von Lernproblemen mit der Konsequenz eines negativen Selbstbildes der Betroffenen. Die Folge sind meist Schulangst, Schulversagen, Schulverweigerung und soziale Auffälligkeiten. Aber nicht nur Entwicklungsbesonderheiten, sondern auch die Erkenntnis aus der Lernpsychologie, die besagt, dass das Lernen eine höchst individuelle Sache ist und der Erfolg davon abhängt, ob gehirnkonform unterrichtet wurde oder nicht, muss zum Denken anregen (Wiater 2001, S. 31). Diese Erkenntnis und das Wissen um die Vielfalt erfordert einen Unterricht, der mehreren Lerntypen unterschiedlicher Lernniveaus Rechnung trägt. Dadurch kann die innere Differenzierung aufgrund
-
thematisch-intentionalen Aspekten
-
methodischen Aspekten
-
medialen Aspekten
-
sozialen Aspekten erfolgen.
Das bedeutet, dass einmal aufgrund der Schwierigkeitsgrade und Menge der Lerninhalte und Lernziele, nach Leistungsfähigkeit, Arbeitstempo und Interesse differenziert werden kann und somit den thematisch-intentionalen Aspekt umfasst. Der methodische Aspekt unterscheidet zwischen unterschiedlichen Sozialformen, Kommunikationsformen und Arbeitsweisen, während der mediale Aspekt die unterschiedlichen Lerntypen berücksichtigt, passende Arbeits- und Anschauungsmittel zum Lerninhalt zur Verfügung stellt. Versuchen Lehrpersonen das soziale Miteinander in der Klassengemeinschaft zu fördern, so spricht man vom sozialen Aspekt (Wiater 2001, S. 28).
Dies zu berücksichtigen bedeutet, jeden Schüler, jede Schülerin als Mensch zu respektieren, der/die einmalig ist und sich von anderen unterscheidet.
SchülerInnen sollen die Erfahrung machen können, dass auch ihr individuelles Lernniveau zum Unterrichtsgeschehen beiträgt und ihre individuelle Arbeit durch ein gemeinsames Thema verbunden ist.
FEUSERs Forderung nach einem Gemeinsamen Gegenstand, nach einem "Lernen an der gemeinsamen Sache" löst Unverständnis bzw. Missverständnis aus (Rittmeyer 1999, S. 270). Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Lehrpersonen meinen, die wesentliche Aufgabe liege bei der Differenzierung darin, den Lerninhalt zu differenzieren und sehen die eigentliche, noch viel wesentlichere Aufgabe nicht darin, die Gemeinsamkeiten in einer Klasse zu pflegen und ihr auch zeitlich gesehen mehr Raum zu schenken. Bei Kindern mit einer schweren Mehrfachbehinderung dürften gemeinsame Inhalte schwer realisierbar sein, aus diesem Grund betont HINZ, dass bei stark kognitiv akzentuierten Lernbereichen die Gemeinsamkeiten in der gegenseitigen Beschäftigung der Kinder miteinander liegen müsse (Rittmeyer 1999, S. 271).
Dass Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Lerninhalte nicht oder nur selten angestrebt werden, liegt vielfach nicht an der Art der Behinderung, sondern am fehlenden Engagement von Lehrpersonen.
|
Eine Betreuerin berichtet wie folgt: Gemeinsame Situationen müssten "...auch in Mathematik oder Deutschstunden möglich sein und wenn man einmal im Monat eine Spielstunde einführt! Sie könnten ja dann ein Spiel miteinander spielen, wo sie lernen mit Zahlen umzugehen", weiters sagt sie: "Ich versuche schon den SchülerInnen Aufgaben zu erteilen, wie z. B. das Schuhe anziehen mit Paula oder beim Kochprojekt --- aber, dass wirklich einmal in der Klasse alle gemeinsam wieder das Gleiche tun --- ich glaube, das tut den Kindern auch gut, dass sie sehen, alle arbeiten am Gleichen." (Interview Nr. 4). |
Der Erfolg der gemeinsamen Erziehungs- und Unterrichtsaktivität ist dann gegeben, wenn einerseits die Individualität und die verschiedenen Förder- und Entwicklungsbedürfnisse der SchülerInnen mit den unterschiedlichsten Bedingungen pädagogisch und methodisch-didaktisch erkannt werden und andererseits Entsprechung finden (Myscher und Ortmann 1999, S. 13).
Die Lehrpersonen sind somit gefordert, zwischen gemeinsamen Inhalten und der Heterogenität der Klasse einen optimalen Weg für alle SchülerInnen anzustreben. Das erfordert eine Unterrichtsorganisation die die Vielfalt bereits in der Planungsphase berücksichtigt.
Erst wenn sich alle Lehrpersonen zum Ziel setzen, die Individualität, die Eigenartigkeit und die Einmaligkeit eines jeden Schülers, einer jeden Schülerin, aber auch eines/einer jeden Lehrers/in zu respektieren, können individuelle Lernwege die Grundlage für einen gemeinsamen Unterricht sein (Demmer-Dieckmann 2001, S. 203 f). Unterrichtsmodelle mit innerer Differenzierung realisieren Chancenausgleich, nach dem Prinzip von BÖHNEL "Jedem das Seine" im Gegensatz zu "Allen das Gleiche". Der Unterricht ist schülerInnenzentriert und durch die flexible Zusammenfassung in Kleingruppen kann jede/r Einzelne individuell optimal gefördert werden. Die Lehrpersonen wissen über den aktuellen Leistungsstand jedes/jeder einzelnen Schülers/Schülerin besser Bescheid, nicht zuletzt auch deshalb, da Lehrpersonen als Beobachter fungieren. Sie können auf etwaige Defizite rascher eingehen und richten ihren Unterricht nicht an einer fiktiven Leistungsnorm der Gruppe aus (Böhnel 2000, S. 51-52).
Wichtig erscheint, die Unterscheidung zwischen Unterrichtsdifferenzierung und individualisierten Unterricht näher ins Auge zu fassen.
Nach TETLER und KREUZER darf Unterrichtsdifferenzierung nicht mit individualisiertem Unterricht verwechselt werden. Der Unterschied liegt darin, dass man beim individualisierten Unterricht nur vom einzelnen Schulkind ausgeht und sich abgespalten hat vom Pol der Gemeinschaft, also keinen gemeinsamen Gegenstand anstrebt. Bei der Unterrichtsdifferenzierung jedoch streben Lehrpersonen und SchülerInnen etwas Gemeinsames an, wobei die Interessen, Voraussetzungen und Bedürfnisse der einzelnen SchülerInnen der Ausgangspunkt ist (Tetler und Kreuzer 2000, S. 90, 92).
Für die Praxis bedeutet das, dass individuelle Förderpläne, sofern sie nicht Gemeinsamkeiten mit der restlichen Klasse aufweisen, zwar individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten fördern, aber keine soziale Integration ermöglichen. Das Nebeneinander in derselben Klasse fördert Segregation, dem man nur Abhilfe leisten kann, durch das Schaffen von Situationen, bei denen alle SchülerInnen der Klasse beteiligt sind.
SALARI ist der Überzeugung, dass die Interventionen im gemeinsamen Unterricht - wo und soweit wie möglich - für den Schüler mit einer Behinderung nicht verschieden sein sollten. Vielmehr sollten die Interventionen mit dem Schüler mit Behinderung soviel wie möglich in die Arbeit mit der ganzen Klasse integriert werden (Rittmeyer 1999, S. 185).
Es geht also nicht darum, die individuellen Maßnahmen des Schülers mit FD zu den Maßnahmen der anderen Schüler zu addieren und damit zu meinen, den integrativen Unterricht erfolgreich organisiert zu haben. Vielmehr haben Lehrpersonen die Aufgabe die Didaktik zu einem einheitlichen Ganzen zu entwickeln, so, wie sich auch die einzelnen Schüler zu einer Gemeinschaft entwickeln müssen. Die Gefahr, dass Schüler mit FD einen parallel zum Unterricht, in sich geschlossenes und individuelles Programm, fern vom Unterricht der anderen Schüler, erarbeiten, ist in einer problematischen Weise integrativ und schon gar nicht inklusiv. Auch genügt es nicht mehr Arbeitsblätter nach Schwierigkeitsgrad zu differenzieren, damit Lerninhalte möglichst ähnlich abgewickelt werden können, sondern es müssen Wege gesucht werden, alle SchülerInnen in den Unterricht mit einzuschließen, das erhebt den Anspruch auf einen binnendifferenzierten, ganzheitlichen und handlungsorientierten Unterricht.
Gemeinsames Lernen muss an einem gemeinsamen Thema festgemacht werden, damit Leben und Lernen in einer Klasse der Vielfalt zu einem bunten Erlebnis werden kann. Erst wenn vielfältiges und handelndes Lernen bereits bei der Organisation berücksichtigt wird und wenn nicht jedes Kind die gleichen Aufgaben zur selben Zeit erfüllen und lösen muss, kann im Unterricht eine Atmosphäre geschaffen werden, bei denen sich alle SchülerInnen in die Klasse einbezogen fühlen. Durch das gemeinsame Leben und Lernen unterschiedlicher SchülerInnen, die je individuelle Fähigkeiten und Voraussetzungen in den gemeinsamen Unterricht mitbringen, sind Lehrende gefordert, gemeinsame Lernprozesse am gleichen Thema auf unterschiedlichem Niveau zu ermöglichen. Dadurch wird es möglich sein, eine Lernumgebung zu schaffen, in der persönliches Wachstum und Entwicklung für alle Kinder möglich wird, in der Beziehungen wachsen können und in der gemeinsames Lernen Spaß macht. Dieser Wachstumsprozess kann nur dann erfolgen, wenn ganzheitliche Lernerfahrungen ermöglicht werden, die es gilt, bei der Organisation von Unterricht zu berücksichtigen. Jedes einzelne Kind erfährt bei der gemeinsamen Arbeit die Wichtigkeit seines Beitrags für das Gruppenergebnis, es erkennt, dass seine eigene Arbeit die Fülle der gemeinsamen Arbeit bereichert. Allen Schülern der Klasse kann so deutlich werden, dass die Vielfalt der Arbeiten zur Einheit des Themas beiträgt und von großer Bedeutung ist. Schüler bekommen, dadurch dass ihnen der Wert ihrer persönlichen Arbeit vermittelt wird, auch die notwendige und fundamentale Grundlage für das Lernen und die Motivation (Jaumann und Riedinger 1996, S. 44 - 105).
Damit Inklusion erreicht werden kann, müssen auch Lehrpersonen gewohnte Formen des frontalen Unterrichts aufgeben und den Unterricht so differenzieren, damit das Lernen in einem anregungsreichen Umfeld mit den erforderlichen Materialien und Hilfsmittel erfolgen kann. Dies erhebt den Anspruch auf Organisation (Sander u. Christ 1993, S. 205)!
Im Sinne der Inklusion, eines Gemeinsamen Unterrichts muss man die Schule, den Unterricht so verändern, dass alle Kinder miteinander und voneinander lernen können: hochbegabte Kinder, ausländische Kinder, stille und lebhafte Kinder, Kinder mit großen oder kleinen Beeinträchtigungen, Kinder von Alleinerziehern usw. Gerade das Wahrnehmen, Aufgreifen und Nutzen der Heterogenität in einer Schulklasse entspricht der Sichtweise der Inklusion und muss die Basis für die Unterrichtsorganisation sein (Jaumann und Riedinger 1996, S. 52).
Daraus folgt, dass eine inklusive Schule keine Förderpläne für einzelne SchülerInnen in der Klasse braucht, sondern die Lehrpersonen Strategien und Handlungskompetenzen für die ganze Klasse mit all ihrer Individualität benötigen. Insofern könnte der Jahresplan und der Förderplan durch ein gemeinsames Curriculum für alle SchülerInnen ersetzt werden, der lebensrelevante Inhalte aufweist und zwar von der basal - fundamentalen bis zur logisch - abstrakten Erschließung der Welt. Die Individualität der Kinder ist ausschlaggebend dafür, mit welchen Inhalten sich das Kind befasst (Wilhelm et al. 2002, S. 48).
|
Eine Integrationslehrperson, die vor kurzem ihre Ausbildung abgeschlossen hat, äußert sich zum gemeinsamen Curriculum folgendermaßen: "Also, für mich ist die Inklusion die Weiterentwicklung der Integration im positiven Sinn, d. h. dass ich nicht mehr das Hauptaugenmerk auf das Kind mit Behinderung lege und mir überlege, wie ich dieses Kind jetzt am besten integriere, sondern, dass ich einfach davon ausgehe, wir sind alle verschieden, haben Stärken und Schwächen und jeder braucht sozusagen Inklusion. Und was mir hier am meisten einleuchtet wäre, wirklich so eine Art Curriculum zu machen, wo ich versuche jedem Kind den Raum zu geben, den es für individuelle Lernprozesse benötigt." (Interview Nr. 6) |
Durch einen offenen Unterricht können Lehrpersonen jedem Kind bei seinem Lernen und sonstigen Tun Unterstützung und Anregung geben, damit es seine persönlichen Ziele erreichen kann.
Somit wird die inklusive Schule nicht mehr zwischen zielgleichem und zieldifferentem Unterricht zu unterscheiden versuchen, weil jedes Kind auch heute schon mehr oder weniger zieldifferent lernt (Sander 2003, S. 129), sondern wird die Individualität aller SchülerInnen wertschätzen und achten!
Der Unterricht sollte im Sinne einer inklusiven Schule so konzipiert sein, dass eine Balance zwischen den einzelnen SchülerInnen als einzigartige Individuen und der Gemeinschaft geschaffen werden soll. Soziale Interaktionen, das gemeinsame Tun, das Arbeiten an gemeinsamen Themen und Inhalten steht dabei im Vordergrund, denn ein inklusiver Unterricht beschränkt sich nicht nur auf äußerliche und formale Gemeinsamkeiten, sondern führt dazu, dass alle SchülerInnen Teil des sozialen Kontexts sind. Dafür ist es notwendig, den Unterricht entsprechend zu planen und organisieren. Die SchülerInnen einer Klasse oder einer Lerngruppe haben unterschiedliche Kompetenzen, individuelle Fähigkeiten, Stärken, Interessen und durchlaufen individuelle Entwicklungen. Der inklusive Unterricht hat die Aufgabe, das individuelle So-Sein aufzufangen und den Prozess von SchülerInnen angemessen zu begleiten. Weiters soll der Unterricht so gestaltet werden, dass Kinder miteinander auf dem jeweiligen Entwicklungsniveau an einem gemeinsamen Thema, an gemeinsamen Inhalten arbeiten, die es gilt in ihrer Komplexität aufzufächern mittels Innerer Differenzierung. Ein gemeinsames Curriculum für alle SchülerInnen würden der inklusiven Schule Rechnung tragen, die ein Ort ist, in der die Vielfalt willkommen ist und jeder/jede SchülerIn seinen/ihren sicheren Platz hat. Dadurch leistet die inklusive Schule einen Beitrag für das reelle Leben, in dem Vielfalt zum Alltag gehört, es können durch Gemeinsamkeiten im Unterricht Freundschaften entstehen, die im optimalen Fall auch über die Grenzen des Schulhofes andauern.
Inhaltsverzeichnis
Dies scheint eine passende Überschrift zu sein, um die Prozesshaftigkeit der Zusammenarbeit, die auch in den letzten Jahren in den Schulen Südtirols stattgefunden hat, aufzuzeigen. Besonders in Integrationsklassen nimmt Teamarbeit eine bedeutende Stellung ein, da man nur im Team den unterschiedlichen Lernanforderungen der einzelnen SchülerInnen gerecht werden kann. Teamarbeit kann deshalb als das Zentrum integrativer Prozesse bezeichnet werden.
Der Prozess der Zusammenarbeit versteht sich nicht als "Summe von Einzelzuständigkeiten und pädagogischen Fähigkeiten", sondern als "Schaffung gemeinsamer Aufgabenverantwortung und Gestaltung innovativer Lernsituationen" (Schley et.al.1989, S. 330). Es geht bei der Teamarbeit unter anderem darum, immer wieder Gemeinsames zu finden, ohne seinen Platz als eigenständige (Fach-) Person aufzugeben. Das Bereitsein sich in den Kompetenzbereichen zu ergänzen, voneinander zu lernen, Altbewährtes aufzugeben und für Neues offen zu sein, damit Gemeinsames gefunden werden kann, löst häufig Schwierigkeiten bei der Arbeit im Team aus.
Auch SCHLEY beschreibt Teamarbeit als ein Spannungsfeld, das sich zwischen vier Grundbedürfnissen abspielt. Die Ambivalenz der Grundbedürfnisse gilt es bei der Teamarbeit auszubalancieren. Die Grundbedürfnisse sind gekennzeichnet durch das Streben nach Nähe, das Bedürfnis nach Distanz, das Streben nach Dauer und das Bedürfnis nach Wechsel (Schley 1989, S. 334).
Das Streben nach Nähe ist einerseits gekennzeichnet durch den Wunsch im Team zu arbeiten, wobei Erfahrungen, Beobachtungen, Stimmungen usw. ausgetauscht werden können. Durch die gemeinsame Arbeit und der gemeinsame Austausch innerhalb des Teams wächst auch das gegenseitige Vertrauen, das die Basis bildet, für eine produktive Teamarbeit. Auf der anderen Seite entsteht innerhalb eines Teams eine enge Bindung, die auch das Gefühl von Abhängigkeit hervorrufen kann und die auch die Selbstständigkeit der einzelnen Teamkollegen hemmen kann und dadurch die Individualität des einzelnen darunter leidet. Dieser Umstand leitet das Bedürfnis nach Distanz ein, das gekennzeichnet ist vom Bedürfnis sich abzugrenzen, selbstständig und unabhängig zu sein, um individuelle Stärken erfahren zu können. Dies sollte aber nicht mit Starrsinn, Eigenbrödlertum, Unduldsamkeit und Abkapselung verwechselt werden, da eine derartige Abgrenzung die Teamarbeit hemmt und unmöglich macht.
Wichtig erscheint bei der Teamarbeit, dass man die Balance hält zwischen dem "Aufeinander Zugehen" und dem "Sich Zurückziehen", das eine gute Zusammenarbeit kennzeichnet.
Neben den räumlichen Dimensionen der Nähe und Distanz beschreibt SCHLEY auch die zeitlichen Dimensionen der Dauer und des Wechsels.
Das Streben nach Dauer ist der Wunsch nach Kontinuität, nach Verlässlichkeit und geregeltem Ablauf, nach dem Einhalten von Spielregeln. Dies wiederum darf nicht bedeuten, dass Zusammenarbeit geprägt sein soll von einem starren Einhalten von Absprachen und Planungen, sondern den Ausgleich schaffen soll zwischen Planung, Abweichung, Bewahrung und Veränderung. Das Streben nach Dauer steht in der Balance zum Bedürfnis nach Wechsel. Es stellt den Wunsch dar, Bewährtes zu überprüfen, Neues entwickeln zu können und Selbstverständliches in Frage zu stellen. Wiederum darf sich das Bedürfnis nach Wechsel nicht dadurch kennzeichnen, dass ein Team nie zur Ruhe kommt, sich dadurch keine Leitlinie entwickeln kann und deshalb Ideen nicht ausreifen können (Schley 1989, S. 334).
Dem Streben nach Dauer hat auch das Landesgesetz zur "Autonomie der Schule" Nr. 12 vom 29. Juni 2000 Art. 6, Abs. 5 Rechnung getragen, das die pädagogische, didaktische und organisatorische Kontinuität fördert und unterstützt. Besonders in Integrationsklassen ist die Kontinuität von besonderer Bedeutung und man versucht bei der schulischen Zuweisung von Integrationslehrpersonen und Behindertenbetreuer die Kontinuität beizubehalten (Paggi 2000a, S.19).
Bei der Zusammenarbeit im Team müssen unterschiedliche Bedürfnisse der einzelnen Teammitglieder zu einem sinnvollen Ganzen zusammenwachsen und dabei ist jede einzelne individuelle Kraft nötig. Teamarbeit wird erst dann zu einem dynamischen Prozess, wenn die Arbeit jedes einzelnen Teammitglied als wertvoll gilt, das Engagement des einzelnen zählt, aber nicht alleine ausschlaggebend für den Erfolg ist. Das Endprodukt ist das Ergebnis aller Köpfe im Team und nicht die Leistung von Einzelkämpfern!
Durch die Verschiedenheit der einzelnen TeamkollegInnen wird nicht nur der Unterricht bereichert, sondern auch die Arbeit für die einzelne Lehrperson erleichtert. Die Verschiedenheit der Teamkollegen lässt den Unterrichtsalltag lebendiger und kindgerechter werden. Teampartner, die ihre Teamkollegen eine wohlwollende Akzeptanz entgegenbringen, werden auch im Umgang mit Schülern und Schülerinnen unterschiedlicher Art zurechtkommen (Jaumann und Riedinger 1996, S. 26).
Nur wer auch im Team die Heterogenität, die Verschiedenheit der einzelnen Teamkollegen akzeptieren kann, wird bereit sein, die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in der Klasse wahrzunehmen und ressourcenorientiert damit umzugehen! Eine gelungene Teamarbeit ist die Voraussetzung für eine integrative Pädagogik. Sie ist das Ergebnis integrativer Arbeit (Schley 1998, S. 116-117).
Der Gemeinsame Unterricht und die damit verbundene Unterrichtung und Förderung aller Kinder und Jugendlichen muss als gemeinsame Teamaufgabe verstanden werden (Struck und Lage 2001, S. 202). Es geht darum, die verschiedenen Arbeitsbereiche so miteinander zu vernetzen, dass die Aufgaben der Lehrpersonen fließend ineinander übergehen und sie im Klassenverband gemeinsam und wechselseitig interagieren. Teamarbeit sollte die Arbeit im Unterricht nicht nur erleichtern, sondern den Unterricht im hohen Maße bereichern, damit Lehrer, sowie SchülerInnen den Zielsetzungen näher kommen können, die sie sich für das Schuljahr gesetzt haben.
Leider wird Teamarbeit in der Schulpraxis oft so gesehen, dass der vermeintlichen "Freiheit" der Lehrpersonen durch die Ablösung des Klassenlehrersystems in der Grundschule und der Einführung des Mehrlehrersystem (Teamunterricht), auch nicht zuletzt durch die Anwesenheit von Integrationslehrpersonen, ein Ende gesetzt wird. Gerade die Angst, der Freiheit beraubt worden zu sein, führt im Unterricht nicht selten zu großen Problemen und beeinflusst unwillkürlich integrative Prozesse.
|
Eine Betreuerin, die bereits seit 23 Jahren in den verschiedenen Schulstufen im Bereich der Integration tätig ist, antwortet auf die Frage der Zusammenarbeit wie folgt: "Zusammenarbeit, das ist ein Kapitel für sich. Also Zusammenarbeit, oh! --- " (lachend) Dann beginnt sie zu erzählen und berichtet, dass die Zusammenarbeit der Lehrpersonen und Betreuer bereits vom Führungsstil der Schule abhängig ist und dieser sich auch auf den Klassenrat ausdehnt. Sie sieht die Problematik im Zeitmanagement und in unterschiedlichen pädagogisch - didaktischen Grundprinzipien. Sie sagt: "Der Integrationslehrer, der mit mir zusammenarbeitet, bemüht sich sehr und er wäre auch froh, wenn ich am Nachmittag zweimal in die Schule käme, um zu planen. Er verfolgt bei der Planung das Ziel, seine Linie durchzusetzen und ich lasse mich eben nicht gerne von meiner Linie abbringen"! (Interview Nr. 2). |
Auch CANNONI und FOSSA (Jahr) geben an, dass u. a. die geringe Bereitschaft der Lehrer zur Zusammenarbeit für die geringe Integration verantwortlich ist. Die hohe berufliche Unzufriedenheit der Lehrpersonen hat ihre tieferen Ursachen in den Schwierigkeiten der Beziehungen zu anderen Lehrern, die sich auf verschiedene Aspekte der schulischen Arbeit auswirken. Auch BARILLI und BRUNELLI (Jahr) weisen darauf hin, dass "Stützlehrer", heute spricht man von Integrationslehrpersonen, die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit als zentrale Erfahrung sehen.
|
In diesem Zusammenhang erscheint die Aussage eines Interviewpartners passend, der als Psychologe, Integrationslehrer und Klassenlehrer mehrjährige Erfahrung mit der Teamarbeit aufweisen kann. Er erzählt folgendes: "Von Jahr zu Jahr habe ich die Zusammenarbeit als ganz unterschiedlich erlebt. Und ich habe auch bald die Illusion aufgegeben -- relativ bald, dass ich durch meine Person das Team gestalten kann. Es ist eindeutig auch von der Person des anderen abhängig, auch des einzelnen Schülers, wie er ist, klar, auch vom kleinen Team in der Schule, das für die einzelnen Klassen zusammengebastelt wird. Da gab es Situationen, wo es für mich perfekt gelaufen ist, wo ich im Nachhinein sagen konnte, das war ein Wahnsinnsjahr, wo viele Rechnungen aufgegangen sind und wo viele Leute mitgetan haben, weil -- dass nicht nur ich Lust gehabt habe, sondern alle die Lust gehabt haben, etwas in Gang zu setzten. Wo alle Lehrpersonen in der Klasse an einem Strang gezogen haben. Dann hat es auch andere Jahre gegeben, wo sich nicht viel getan hat, wo man -- nicht man, sondern vor allem auch ich mich an die Brust klopfen muss, weil ich den Rückzug angetreten habe. Am Anfang war ich massiv viel in der Klasse und habe probiert, habe die Lehrer informiert und hunderttausendmal zusammengetrommelt. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass die Rechnung nicht aufgehen wird, dass die Arbeit im Team nicht ins Rollen kommt! Ich habe das Arbeiten in der Gruppe ganz unterschiedlich erlebt und darum kann ich sagen, dass Teamarbeit nicht von mir selbst, sondern vor allem auch von den einzelnen Lehrpersonen abhängig ist" (Interview Nr. 5). |
WOCKEN, BOBAN und HINZ haben bereits Ende der 80er Jahre darauf hingewiesen, dass in allen Erfahrungsberichten und Untersuchungen über Schwierigkeiten der integrativen Arbeit im Unterricht an erster Stelle Kooperationsprobleme genannt werden und erst an zweiter oder dritter Position Belastungen durch SchülerInnen und Unterrichtsgestaltung (zit. nach Rittmeyer 1999, S. 236-330).
Dies zeigt auf, dass Teamarbeit im inklusiven Zusammenhang näher erläutert werden muss. Wichtig erscheint in der Zusammenarbeit die einzelnen Rollen und die damit verbundenen Aufgaben zu regeln, aber nicht unterschiedliche Kompetenzen mehr- oder minderwertig einzustufen.
|
Eine langjährige erfahrend Betreuerin berichtet folgendes: "Ich glaube, die ideale Zusammenarbeit habe ich heuer mit meiner Integrationslehrerin. Sie macht keine hierarchischen Unterschiede, akzeptiert mich voll als Mensch, was schon einmal eine Basis ist" (Interview Nr. 2). |
Wie unbewusst die Angst der unfreiwilligen Selbstenthüllung im Team eine Rolle spielt, wird versucht im nächsten Abschnitt aufzuzeigen.
SCHÖLER beschreibt das Problem der Teamarbeit treffend, indem sie sagt: "Manche Lehrerinnen und Lehrer haben mehr Angst vor dem zweiten Erwachsenen in der Klasse als vor dem behinderten Kind" (zit. in Jaumann und Riedinger 1996, S. 25).
Durch das Mehrlehrersystem im Teamunterricht und durch die Anwesenheit von Integrationslehrpersonen werden Eigenheiten, Schwächen, Empfindsamkeiten, Fehler und vieles mehr von Kolleginnen und Kollegen erkannt. Gerade einfach Mensch sein zu können, mit all seinen Stärken und Schwächen, löst bei der Arbeit im Team Ängste aus.
WOCKEN spricht in diesem Zusammenhang von der Enthüllung der Rolle und der Enthüllung der Person. Mit Enthüllung der Rolle meint er, dass durch die Arbeit im Team die pädagogischen und fachlichen Fähigkeiten dauernd der Beobachtung anderer Fachleute ausgesetzt sind: "Im Team fallen alle Mitglieder gleichsam aus der Rolle... . Übrig bleibt die nackte Wahrheit darüber, was der einzelne kann und was er nicht kann" (Wocken 1988, S. 210).
Unter Enthüllung der Person versteht er, dass bei der Arbeit im Team emotionale Stimmungen und Reaktionen, persönliche Probleme usw. vor Teamkollegen nicht verborgen werden können: "Je intensiver die kooperativen und kommunikativen Prozesse sind, desto mehr trägt der Lehrer seine eigene Haut zu Markte" (Wocken 1988, S. 212).
Die verschiedenen Aussagen verdeutlichen die unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit denen ein Team ausgestattet ist und wie wichtig einerseits der Respekt untereinander ist und andererseits die eigene Persönlichkeit nicht darunter leiden darf. Dieses Gleichgewicht muss jedes Teammitglied selbst finden, da es Erfolgsrezepte für eine gelungene Teamarbeit nicht gibt.
Das Wissen, dass wir als Erwachsene im Klassenraum durch die Art unseres Zusammenlebens positive Vorbilder sind und wir gerade deshalb zeigen sollen, dass Lehrpersonen im Stand sind, mit der eigenen Verschiedenheit umzugehen, erscheint eine wichtige Erkenntnis. Durch das Vorbild geben wir den Schülerinnen und Schülern die innere Sicherheit, dass auch ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und ihr jeweiliger Entwicklungsstand respektiert und geachtet wird (Schöler 1993, S.146).
|
Eine Betreuerin, die bereits 23 Jahre im Bereich der Integration tätig ist sieht ihre Aufgabe im Gemeinsamen Unterricht vor allem darin, als Vorbild zu fungieren. Sie betont: "Ja, ganz wichtig ist auch die Vorbildfunktion, die man einnimmt. In dem Moment wo die anderen Schüler sehen, dass das Kind zwar rotzig ist, ich mich aber davor nicht ekle oder wenn es die Hose runterzieht, ich nicht gleich in Panik ausbreche, sondern ruhig bleibe, habe ich eine Vorbildfunktion. Kinder beobachten wahnsinnig gut und wenn sie sehen, wie ich mich verhalte, so kann man sie sehr gut lenken." (Interview Nr. 2). |
In Bezug auf eine Schule für alle, darf es keine Lehrpersonen für spezielle oder andere Schüler geben, da dies eher eine problematische Praxis von Integration fördert und nicht der Sichtweise der Inklusion entspricht. Die Erwartungshaltung, die einer Integrationslehrperson entgegengebracht wird, auch wenn sie nicht über die entsprechende Spezialisierung verfügt, ist allgemein sehr hoch. Die Integrationslehrperson ist die Verantwortliche für die SchülerInnen mit "Schwierigkeiten" und wird in Bezug auf den/die IntegrationsschülerIn als AnsprechpartnerIn gesehen. Regellehrer, die oft über mangelnde Ausbildung klagen, sind froh, wenn ihnen diese Verantwortung abgenommen wird. In der Praxis führt dies häufig auch dazu, dass die Integrationslehrpersonen die Aufgaben in Bezug auf die IntegrationsschülerInnen dann alleine übernehmen. Auch fühlen sich Integrationslehrpersonen für den/die SchülerIn mit FD in besonderen Maße verantwortlich, da sie ja aufgrund des Schülers/der Schülerin mit FD ihre Zuweisungen bekommen haben. Die Zuweisung der Integrationslehrperson an die ganze Klasse entspricht dem Prinzip der Inklusion, da somit alle SchülerInnen von beiden Lehrpersonen profitieren können. Als optimal erscheint, sich in den Rollen IntegrationslehrerIn und Fachlehrperson auch hin- und wieder abzutauschen.
|
Ein weiterer Aspekt ist auch, dass Kinder mit FD sich speziell an die Integrationslehrperson wenden und somit eine Situation eintreten kann, wie sie von einer Mutter beschrieben wird: "Er redet jetzt auch nicht mehr nur von der Integrationslehrerin, sondern auch von anderen Lehrpersonen!" (Interview Nr. 1). |
Aus diesem Grund kann ein möglicher Ansatz der Inklusion nur bedeuten, dass es keine Klassifizierungen und keine schülerbezogenen Aufgabenbereiche zwischen den einzelnen Lehrpersonen mehr geben darf. Es kann keine Lehrperson für spezielle Kinder geben, sondern alle Lehrpersonen müssen für alle SchülerInnen zuständig sein und die gemeinsame Verantwortung und Funktionen in allen Aufgabenbereichen übernehmen und erfüllen können - nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis.
Beim Gemeinsamen Unterricht geht es nicht um ein "aufgabengeteiltes Nebeneinander", wobei jede Lehrperson ihre spezifische Rolle einnimmt und dies dazu führt, nur für ihren speziellen Teil der Aufgaben die Verantwortung zu übernehmen. Es muss eine gemeinsame Verantwortung für alle Schüler der Klasse geben, damit keine hierarchische Gliederung, sondern ein gemeinsames Ganzes entstehen kann.
Die Verschiedenheit der Lehrpersonen durch die eigene, persönliche Lebensgeschichte, die Verletzungen, Erfolge und vielfältigen Erfahrungen familiärer und schulischer Sozialisation gelangen somit zum Einsatz und werden als Ressource genutzt. Diese grundlegenden Erfahrungen leiten die pädagogische Arbeit und das Zusammenleben in und außerhalb der Schule. Sich dessen bewusst zu machen, ist bei der Arbeit im Team unverzichtbar (Jaumann und Riedinger 1996, S. 54).
Weiters kann durch ein Zwei-Pädagogen-System auf die Grundqualifikationen sozialen Lernens vermehrt eingegangen werden. Es kann ein Unterricht praktiziert werden, bei dem die notwendig Zeit vorhanden ist, Schwächen und Schwierigkeiten aufzufangen, wo es aber auch möglich ist, auf besondere Stärken und Begabungen der Schüler individueller einzugehen.
"Ein gutes Team ist" laut SCHLEY "gekennzeichnet durch die Bewegung von Nähe und Distanz, von Einigkeit und Abgrenzung. Kontinuierliche Aufbauphasen gehen in kritische Überprüfungs- und Umbruchphasen über. Ein gutes Team lebt vom Austausch, der Akzeptanz und der Auseinandersetzung. Es gibt in jedem Team Menschen, die eher den einen oder den anderen Pol verkörpern. ... Und wie bei einem Musikstück hat jeder seinen Einsatz, als ob es eine unsichtbare Partitur gäbe. Gruppendynamik und Persönlichkeitsdynamik wirken zusammen" (zit. in Jaumann und Riedinger 1996, S. 29).
Auch können bei dem Zwei-Pädagogen-System Vermittlungen von Lerninhalten individuell gegeben werden, da sich die Persönlichkeit des Lehrers auch auf die Art der Erklärungsmuster niederschlägt. Durch die Individualität der Erklärungen und Hilfestellungen, die im Unterricht von beiden Lehrpersonen gegeben werden können, wird der Heterogenität der Lerngruppe Rechnung getragen. Natürlich erfordert eine derartige Nutzung zweier Pädagogen auch eine besondere Art von Planung und Organisation, die sich nicht nur auf spezielle SchülerInnen konzentriert, sondern der Verschiedenheit aller SchülerInnen gerecht wird.
Durch das gemeinsame Tragen der Verantwortung für alle Schüler erhält auch die Kooperation der Lehrpersonen einen anderen Stellenwert. Es geht im Unterricht nicht mehr nur darum, wie man gemeinsame Situationen und Aktionen miteinander arrangieren und organisieren kann, damit Integration erfolgen kann, sondern es muss darum gehen, gemeinsam einen Unterricht für alle zu gewährleisten. Auch können sich die Lehrpersonen ein Stückweit mit sich selbst und dem Teamkollegen/-kollegin auseinander setzten, damit Teamarbeit effizienter gelingen kann. Es geht mitunter darum, unterschiedliche Werte, Normen, Erziehungsstile und -maßnahmen anzusprechen, sie zu respektieren, aber auch einen gemeinsamen Konsens zu finden. Bei der Auseinandersetzung, die zwischen den TeamkollegInnen stattfindet, kommt man sich ein Stück näher, lernt sich besser kennen, reflektiert sich selber und kann dann auch gemeinsam Unterricht gestalten, bei denen alle gleichviel oder gleichwenig, vor allem aber gemeinsame Verantwortung für alle SchülerInnen tragen.
Wichtig bei jeder Zusammenarbeit ist die Bereitschaft dem Teamkollegen oder der Teamkollegin das Vertrauen zu schenken. Vertrauen ist die Basis für das Gelingen der Teamarbeit, aber auch die Basis für die Entwicklung der Kinder. Nur wenn den Kindern Vertrauen in Bezug auf ihre Fähigkeiten und Stärken geschenkt wird, so können sie Selbstvertrauen aufbauen und gestärkt in eine Entwicklung gehen. Genauso wie Kinder brauchen aber auch Erwachsene das gegenseitige Vertrauen in die Fähigkeiten der anderen.
Diese Einstellung kann dazu beitragen, dass die Kooperation aller Beteiligten am Erziehungsprozess gelingen mag und inklusive Perspektiven verwirklicht werden können.
Eine Schule für alle erfordert auch die Zusammenarbeit aller Lehrpersonen. Die Berücksichtigung der Vielfalt kann nicht nur Aufgabe einer Lehrperson sein, sondern soll vom Team, vom Kollegium, ja von der gesamten Schule mitgetragen werden. Bei der kooperativen Zusammenarbeit sollte es zu einer Bündelung von gleichwertigen Fähigkeiten und Kompetenzen kommen, die zur Förderung aller SchülerInnen beitragen soll. Die Doppelbesetzung im Unterricht sollte nicht darauf abzielen, dass eine/einer der beiden Lehrpersonen die "individuelle Förderung für die Schwächeren" übernimmt, sondern die Ressource des Zwei-Pädagogen-Systems sollte so genutzt werden, dass beide Lehrpersonen einen binnendifferenzierten Unterricht planen und durchführen, mit dem Ziel, allen SchülerInnen in ihrer Vielfalt gerecht zu werden. Von einem inklusiven Ansatz kann dann gesprochen werden, wenn es sich bei der Teamarbeit nicht um ein rollenspezifisches Nebeneinander handelt, sondern ein Unterricht praktiziert wird, in dem alle Beteiligten zum Wohle aller SchülerInnen gleichwertig miteinander kooperieren.
Inhaltsverzeichnis
- 3.1. Einleitende Gedanken
- 3.2. Ziele der Beobachtungen
- 3.3. Die Rolle des Lehrers in Bezug auf die Beobachtung
- 3.4. Die Qualität der Beobachtung
- 3.5. Die Angst vor der Diagnostik und Diagnostik mit Spaß
- 3.6. Die systemische Perspektive in der Diagnostik
- 3.7. Inklusive Perspektive - das diagnostische Mosaik
- 3.8. Fazit
Damit ein differenziertes Bild, eine differenzierte Einschätzung der SchülerInnen erfolgen kann, sollen Lehrpersonen ihre individuellen Beobachtungen und Erkenntnisse zusammentragen und auswerten. Die daraus resultierenden Ergebnisse sind die Basis für das weitere pädagogisch-didaktische Tun. Daher geht es im folgenden Abschnitt darum, die Qualität und die Zielsetzung der Beobachtung näher ins Auge zu fassen und die mit der Beobachtung verbundene veränderte Rolle der Lehrperson aufzuzeigen. Weiters wird es darum gehen, die weit verbreitete Angst der Diagnostik anzusprechen. Im Zuge der Diskussionen über die Diagnostik in den letzten Jahren wird es in einem Abschnitt darum gehen, die systemische Perspektive zu erläutert und anhand des diagnostischen Mosaiks inklusive Perspektiven zu eröffnen. In diesem Kapitel werden auch immer wieder Aussagen der Interviewpartner mit einfließen, um verschiedene Sichtweisen der Diagnostik zu verdeutlichen.
SPRINGER fordert: "Wer darangeht, andere in hilfreicher Absicht zu beobachten, muss immer sich selbst mit beobachten. Wer glaubt, das nicht tun zu müssen, muss sich als erste Rückmeldung eingestehen, dass er keine hilfreiche Absicht hat. Der Standpunkt, von dem aus die Beobachtung gemacht wird, und das Mittel, die Brille, durch die "es" gemacht wird, bestimmen das Ergebnis" (Springer 1990, S. 25).
Mit der Aufforderung sich selbst als Pädagoge zu beobachten, auf Grund des Bewusstseins, dass Beobachtungen Ergebnisse bestimmen können und auf Grund des Wissens, dass Diagnostik auch selektive Funktion hat, besteht die Notwendigkeit die Ziele der Beobachtungen näher zu betrachten.
Die Beobachtungen der Lehrpersonen müssen dem Ziel dienen zu sehen, was gebraucht wird, damit sich Lehrpersonen in der jeweiligen Situation vorbereiten und weiterbilden können. Erst die Beobachtungen bewirken, dass Lehrpersonen entwicklungsspezifisch auf Schüler eingehen können und somit ein angemessenes und entwicklungsförderndes Handeln ermöglicht werden kann.
Zweck der Beobachtung ist somit nicht die Beurteilung der SchülerInnen oder die Festlegung des/der Schülers/Schülerin auf bestimmte Merkmale, schon gar nicht die Erstellung einer Diagnose, sondern es sollte Lehrpersonen darum gehen, ein besseres Verständnis für die SchülerInnen zu entwickeln. Vor allem sollten die Diagnosen, bzw. psychologische Gutachten, die für die Schule erstellt werden, unterstützende Funktionen für Lehrpersonen in ihrem Handeln haben.
|
Diese Aussage stammt von einem Psychologen, der lange Zeit auch in der Schule als Klassenlehrer und Integrationslehrer tätig war. Er betont, "dass es sich hierbei nicht um eine ressourcenorientierte Beschreibung handelt und in Bezug auf das eigentlich Tun in der Schule relativ wenige Strategien aufzeigt. Meist bleibt alles dem Lehrer überlassen, es gibt schon einige Tipps, aber irgendwie wird man durch das psychologische Gutachten doch auf die Symptome und auf die Schwierigkeiten hingewiesen" (Interview Nr. 5). |
|
In einem zweiten Moment spricht er vom systemischen Ansatz: "Ein Mensch ist individuell, nicht allein, er kann nicht losgelöst betrachtet werden -- eine allgemeine psychologische Sicht - mit seinem Problem, sondern meistens, dass er Problemträger ist, also Indexpatient ist und rund um ihn herum das System ist, die Leute, die die Umstände auch mitbedingen. Das Symptom oder der Mensch mit seiner Geschichte hat nicht nur für sich eine Funktion, sondern für das ganze System. Da gehört der Lehrer, die kleinen Geschwister hinein, alle, die auf dieser Ebene angesiedelt sind, das ist ein riesengroßer Haufen. Man teilt daraufhin den verschiedenen Ebenen verschiedene Rollen zu und es wird geschaut, auf welcher Ebene das Symptom welche Funktion hat und welche Dynamik das Kind in Bewegung setzt." (Interview Nr. 5) |
Aus diesem Grund sollte bei der Beobachtung nicht das isolierte Kind im Mittelpunkt stehen, das an einem bestimmten Punkt seiner Entwicklung angelangt ist, sondern sie sollte umfassend erfolgen, d. h. sie sollte
-
das Kind, das in sein Umfeld eingebettet ist,
-
die Wechselwirkung, die sich zwischen Umfeld und Kind ergibt
-
und der sich daraus ergebende Prozess.
Damit nicht nur das isolierte Kind beobachtet wird, müssen häufige Beobachtungssequenzen im Unterricht angestrebt werden, mit dem Ziel, das Kind, das Umfeld, die Wechselwirkung und den Prozess wahrzunehmen und dann entsprechend zu handeln.
Natürlich wird es Lehrpersonen nicht möglich sein alle Schüler mit gleicher Intensität zu beobachten, es ist auch nicht notwendig, dass jeder Schüler, jeden Tag zum Beobachtungsmittelpunkt wird. Dennoch sollte die Lehrperson ein sehr feines Gefühl dafür entwickeln, was in der Klasse und bei den einzelnen Schülern vor sich geht. Sie sollte bereits vom ersten Tag an mit wachem, wohlwollendem Interesse die jungen Menschen, die ihr anvertraut wurden, begleiten (Springer 1990, S. 24 f.).
Nur mit wachen Augen können Lehrpersonen SchülerInnen beobachten, ihre Bedürfnisse erkennen, Hinweise für Planungskriterien erhalten und Leistungsbeurteilung durchführen. Die Lehrperson wird im Laufe gezielter Beobachtungen erkennen, wie die einzelnen SchülerInnen geführt, begleitet und motiviert werden können. Durch die resultierenden Ergebnisse der Beobachtungen können Lehrpersonen alle notwendigen Maßnahmen treffen, damit der/die SchülerIn, bzw. alle SchülerInnen sich wohlfühlen und somit der Prozess des Lernens gelingen kann. Die Beobachtungen ermöglichen den Lehrpersonen ein besseres Verständnis für den/die SchülerIn zu entwickeln, ihn als Persönlichkeit wert zu schätzen und zu achten. Daraus lassen sich schülerzentrierte Richtlinien für Handlungs- und Lernsituationen ableiten.
Auch UTZ betont, dass für PädagogInnen die Beobachtungen die Grundlagen zum Verständnis und zum richtigen Umgang mit den Kindern sind (Utz 1996, S. 20). Der richtige Umgang bedeutet, dass Lehrpersonen durch eine gezielte, ressourcenorientierte Beobachtung die Stärken, Fähigkeiten und Interessen der SchülerInnen wahrnehmen und ermitteln und die SchülerInnen ermutigen noch ungegangene, neue Wege zu beschreiten. Durch Beobachtungen wird es möglich sein, an dem Punkt des Lernens anzuknüpfen, wo SchülerInnen die notwendige Sicherheit besitzen. Sie können somit Neuem unbefangen entgegentreten, ohne Angst zu haben, Schwierigkeiten nicht bewältigen zu können. Für die Lehrperson bedeutet das, dass sie nicht nur ein/eine guter/gute Beobachter/in sein muss, sondern die Beobachtungen auch sofort umsetzten muss in Handlungsstrategien, die dem/der Schülerin auf dem Weg des Lernens helfen.
Diese Annahme wird durch die Aussage von LEINHOFER: "Ein guter Erzieher ist auch ein guter Beobachter" (1991, S. 26) bestätigt.
Beobachtungen bringen alle am Erziehungsprozess beteiligten Personen näher an den/die SchülerIn, es werden neue Sichtweisen eröffnet, der Blickwinkel geweitet und durch die gemeinsame Ermittlung des IST - Standes können alle weiteren Handlungen an den Stärken, Fähigkeiten und Interessen des/der Schülers/Schülerin angeknüpft werden.
Nicht zuletzt geben Beobachtungen auch Aufschluss über das eigene Erzieherverhalten, sie können dazu führen, dass besondere Fähigkeiten der Lehrpersonen entdeckt werden, aber auch Stellen aufgezeigt werden, wo noch Veränderungen und Verbesserungen notwendig sind.
Die Tätigkeiten der Lehrperson darf sich nicht nur auf die Wissensvermittlung, das Prüfen und Beurteilen richten, sondern umfasst vielmehr die Funktionen des Organisators und des Helfers. Um diese Funktionen wahrnehmen zu können bedarf es der pädagogischen Diagnostik, wobei es nicht darum geht, Kategorien zu bilden und/ oder Diagnosen zu erstellen, sondern es muss rein darum gehen, das Kind besser kennen zu lernen.
Das heißt konkret, dass sich die Lehrperson nicht mehr primär auf die Leistungen der SchülerInnen konzentriert, sondern sich darauf konzentriert, wie der/die SchülerIn zu dieser Leistung gekommen ist, welchen Lernprozess er/sie durchlaufen hat. Laut SPRINGER sind Beobachtungen erste und wichtigste Voraussetzung für den Unterricht in Integrationsklassen, damit eine Atmosphäre geschaffen werden kann, in der sich Schüler entwickeln können (Springer 1990, S. 41).
Die Lehrperson muss somit Situationen schaffen, wie z. B. Wochenplanarbeit, Stationenarbeit, Werkstatt-Unterricht usw., damit sie Beobachtungen in Ruhe durchführen kann. Sie sollte sich auch immer wieder anhalten, in die Rolle des/der Beobachters/in zu schlüpfen, sich selbst im Unterricht zurückzunehmen und den SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, selbsttätig zu werden.
Die Beobachtungen nehmen in der Schule einen zentralen Platz ein und sollten deshalb keine wertende Beurteilung enthalten und auch ohne Zuschreibung von Eigenschaften erfolgen. Aus diesem Grund sollten Beobachtungen monatlich durchgesehen werden, da dabei Unsicherheiten der Einschätzungen auffallen und gegebenenfalls durch neuere Beobachtungen ergänzt werden können (Schwark et al. 1991, S. 114-115). Das erhebt auch den Anspruch in Bezug auf psychologische Gutachten, bzw. Diagnosen, die einmal im Leben eines Schülers erstellt werden, neue Regelungen zu treffen.
Die Qualität der Informationen ist auch entscheidend davon abhängig, wie Beobachtung methodisch gestaltet wird.
|
Eine Lehrperson schildert ihre Erfahrungen mit Beobachtungen im Unterricht wie folgt: "Ich mache Beobachtungen eigentlich ziemlich unstrukturiert. Ich schreibe sie auch nicht gleich auf, außer es ist etwas ganz besonderes und wenn es mich überkommt, dann schreibe ich einfach alles auf - zusammenfassend - und probiere die Entwicklung mitzunehmen"(Interview Nr. 6). |
Aus diesem Grund sind methodische Kriterien für die Beobachtung in der Schule erforderlich. Nach Ansicht von BARILLI und BRUNELLI sind folgende vier Regeln für die Beobachtung wichtig:
-
Die Beobachtungen sollen regelmäßig durchgeführt und wiederholt werden, z. B. in Form eines Tagebuches. Diese Aufzeichnungen sind bedeutsam für die Erkennung eines Lernfortschrittes.
-
Beobachtungen müssen aufgeschrieben werden, damit man sie miteinander vergleichen kann, um dadurch Veränderungen und Entwicklungen der Schüler verfolgen zu können.
-
Die Beobachtungen sollen möglichst sofort festgehalten werden, da sie den Tatsachen entsprechen und deshalb frei von Beurteilungen und Einschätzungen sein müssen.
-
Die Beobachtung soll anhand eines Rasters erfolgen, der jedoch nicht zu detailliert sein darf, damit sich die Aufmerksamkeit des Beobachters nicht in analytischen Aspekten verliert und ihn hindert, einen einheitlichen Bezugsrahmen zu finden (Rittmeyer 1999, S. 179).
Erst wenn die Beobachtung qualitätsbewusst durchgeführt wird, kann sie auch von allen Lehrpersonen sinnvoll genutzt werden. Sinnvoll nutzen bedeutet in einem Lehrerteam, dass Schülerbeobachtungen
-
bei Klassenkonferenzen Anlass zur Diskussion sein können
-
sie helfen notwendige Fördermaßnahmen zu erkennen und durchzuführen
-
sie geben Anlass, die Unterrichtssituation der jeweiligen Klasse zu erörtern und gegebenenfalls Veränderungen herbeizuführen
-
und bietet eine Grundlage zur Beratung der Erziehungsberechtigten, sowie der Schülerinnen und Schüler (Ziegenspeck 1999, S. 346).
Von großer Wichtigkeit ist das Zusammentragen der gemachten, unterschiedlichen Beobachtungen, der Informationsaustausch, damit es möglich wird zu einem Bild zu gelangen, das frei ist von Vorurteilen (Rittmeyer 1999, S. 178).
Damit dem Kind eine verstehende Haltung entgegengebracht werden kann, müssen Beobachtungen - die individuellen Bilder der Lehrpersonen von SchülerInnen - der Zündstoff für Diskussionen im Lehrerteam sein.
Auch BOBAN und HINZ betonen, dass Beobachtungen der Anlass sein sollen für die gemeinsame Betrachtung der Situation eines Schülers/einer Schülerin, mit dem Ziel, aus den unterschiedlichen Betrachtungsweisen zu einem Gesamtbild zu gelangen (1998, S. 153).
Lehrpersonen sollten sich aber auch bewusst sein, dass das Niederschreiben von Beobachtungen eine einseitige Sichtweise vermitteln kann, da Lehrpersonen häufig
-
negative Auffälligkeiten festhalten,
-
über unauffällige SchülerInnen nur wenige Aussagen machen,
-
eine Beschreibung mit wertenden Begriffen wie "faul/fleißig" verfassen
-
nicht die notwendige Zeit aufbringen, Beobachtungen in stressfreien Situationen durchzuführen (Schwark et al. 1991, S. 114-115).
Eine Diagnostik, die zum Wohle des Kindes erfolgt, muss die eigene Wahrnehmung einschließlich aller Ambivalenzen und Widersprüche in den Blick nehmen (Boban und Hinz 1998, S. 152)
Die weit verbreitete Angst der Lehrpersonen vor Diagnostik ist nicht ganz unbegründet. Meist werden Lehrpersonen beim Übernehmen einer Integrationsklasse das erste Mal mit Diagnostik konfrontiert und verbinden sie dann mit psychologischen Gutachten, Fachausdrücken und Ohnmacht.
Auf viele Lehrpersonen wirken psychologische Gutachten fremd, wenig aussagekräftig und stigmatisierend.
|
Hierfür ein Beispiel aus der Praxis, das aufzeigt, dass man ohne psychologische Ausbildung und Kenntnis der Terminologie auf Hilfestellung angewiesen ist. "Von der Grobmotorik her fällt besonders seine Ataxie auf. Der Gang ist unkoordiniert, steif und wackelig. Auffallend sind auch choreatisch - athetotische Bewegungen der oberen Extremitäten einschließlich Kopf. Die Handführung ist zittrig" Eine Lehrperson mit fast 35 Dienstjahren äußert sich in Bezug auf die Fachausdrücke bei Diagnosen wie folgt: "Da kann ein einmaliges Gespräch mit dem Psychologen auch nicht weiterhelfen. Vielfach ist es auch so, dass die Testsituation schon längere Zeit her ist und der Psychologe den Schüler schon lange nicht mehr gesehen hat. Das Gutachten ist mitunter wohl auch veraltet und müsste meiner Meinung nach jedes Jahr neu erstellt werden. Beim Schüler wird sich wohl im Laufe seiner schulischen Laufbahn irgendwelche Änderungen, Fortschritte ergeben, oder? Sonst ist unsere gemeinsame Arbeit vergebens" (Interview Nr. 8). |
EGGERT eröffnet eine neue Sichtweise von Diagnostik, die sogar Spaß machen kann. Er spricht davon die Diagnostik zusammen mit den Kindern zu machen, in einem gewohnten Umfeld. Diagnostik sollte nicht festlegen, sondern zur Förderung gehören und viele Fördervorschläge möglich machen. Er betont, dass die Diagnostik Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Kindes miteinander verknüpfen sollte.
Pädagogische Diagnostik macht dann "Spaß" ,wenn man im
-
Team arbeiten kann,
-
das Kind im gewohnten Umfeld beobachtet,
-
ohne Zeitdruck arbeiten kann,
-
gute Angebote für Schüler entstehen,
-
Fortschritte in der Förderung feststellen kann
-
und wenn das Kind möglichst unbemerkt in einer stressfreien Situation beobachtet werden kann (Eggert 1997, S. 78-79).
Bei der systemischen Perspektive, die in den letzten Jahren die Diskussion um Diagnostik bestimmt, lässt sich folgendes kurz zusammenfassen:
-
Diagnosen sind Beschreibungen des Beobachters über das, was er mit seiner Brille, d. h. mit seinen Vorannahmen, seinen Theorien, seinem Wissen und seiner Erfahrung beobachtet. Diagnosen sind somit abhängig vom jeweiligen Diagnostiker.
-
Diagnosen bilden die Wirklichkeit nicht ab, sondern schaffen sie. Diagnosen haben Wirkung, d. h. sie gestalten die Wirklichkeit (Walthes 2003, S. 59-65).
Folge dessen sind Diagnosen Aussagen, die auf die betreffende Person einwirken und deren Wirkung nicht unterschätzt werden darf. Das bedeutet, wenn Diagnosen keine Aussichten auf Entwicklungsprozesse mehr zulassen und alle medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Möglichkeiten und Maßnahmen ausgeschöpft zu sein scheinen, wenn die Entwicklung eines Menschen angezweifelt wird, dann hat dies für die betreffende Person fatale Auswirkungen.
Auch REUTTERER bestätigt, dass vorgefasste Meinungen oder Erwartungen des Beobachters häufig bestätigt werden, da sich die Voraussage von selbst erfüllt. Dieser Beurteilungsfehler wird in der Psychologie als Rosenthal-Effekt oder "Self-fulfilling prophecy" bezeichnet (1996, S. 230).
Aus diesem Grund muss in Bezug auf Funktionsdiagnosen, die in der Praxis eine defizitorientierte Sichtweise vermitteln, ein Umdenken stattfinden. Funktionsdiagnosen, die von Eltern beschrieben werden als:
|
"...ein Hammer, da wir gewusst haben, dass es schwerwiegend war. Niemand kann am Anfang etwas genaues sagen, sondern es heißt Schädigung und es kann sein, dass das ausfällt oder das ausfällt und man muss abwarten..." (Interview Nr. 3). |
Diagnosen haben eine enorme Wirkung auf alle Beteiligten, ganz besonders dann, wenn nur geringe Zukunftsperspektiven genannt werden!
Von Eltern, aber auch Lehrpersonen wird immer wieder betont, dass das medizinische und psychologische Fachvokabular Schwierigkeiten bereitet und auch deshalb befremdend wirkt. Diagnosen sollten deshalb für alle Beteiligten plausibel und nachvollziehbar, sowie hilfreich und nützlich sein. Diese Kriterien erfüllen sie, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen:
-
Diagnosen können und sollen keine generalisierten Zustandsbeschreibungen sein, sondern flexible Deutungen, die auf das konkrete Problem in seinem spezifischen Kontext bezogen sind.
-
Diagnosen können und sollen der Komplexität der beobachteten Zusammenhänge gerecht werden.
-
Diagnosen können und sollen von den Beteiligten gemeinsam entwickelt werden.
-
Diagnosen können und sollen ressourcenorientiert sein.
-
Diagnosen können und sollen neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen, nicht verschließen. Nur dann sind sie nützlich (Walthes 2003, S. 59-65).
Wenn Diagnosen Kinder nicht als hyperaktiv, körperbehindert, verhaltensgestört usw. bezeichnen, sondern deren Sein und Tun so interpretieren, dass es zur Situation passt, in der sie ihr persönliches Verhalten zeigen, dann werden keine generalisierten Zustandsbeschreibungen, bzw. Stigmatisierungen gemacht, sondern Deutungen, die auch Veränderungen zulassen.
Generalisierte Zustandsbeschreibungen, wie Funktionsdiagnosen es sind, werden nicht nur von Eltern, Lehrpersonen und BetreuerInnen als belastend empfunden, sondern können sich auch negativ auf das Selbstbewusstsein des Kindes auswirken. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass sich der diagnostische Blick nicht auf das "Nicht-Können" richtet, sondern auf die Ressourcen des Kindes, des Jugendlichen.
|
Eine Betreuerin mit 12jähriger Erfahrung schildert ihre Erfahrung wie folgt: "Die Diagnosen! Ich kann mit der Diagnose selbst nichts anfangen. Als ich sie gelesen habe, dann war das ein Bild von einer ganz, ganz schweren geistigen Behinderung. Ich dachte mir, dass da gar nichts gehen würde! Auch von den Ärzten die Aussage: Sie wird weder gehen lernen, noch reden, noch -- also ganz negativ war das am Anfang gewesen. Wenn ich das mit der jetzigen Situation vergleiche, was sie für Fortschritte gemacht hat, dann denkst du wirklich, warum stellen sie so eine Diagnose?" (Interview Nr. 4). |
Erst wenn der Blick auf das gerichtet wird, was das Kind kann, seine Stärken und Fähigkeiten, können Diagnosen auch für die Schule handlungsweisend sein. Auch WALTHES betont, dass Diagnosen neue Perspektiven eröffnen sollen (Walthes 2003, S. 59-65).
Auch sollten Kinder, Jugendliche und Eltern bei der Erstellung der Diagnosen miteinbezogen werden, da sie selbst das größte Wissen um ihre Situation und die meiste Erfahrung im Umgang mit sich selbst haben. Es empfiehlt sich deshalb, auf hierarchische Strukturen und auf die Definitionsmacht der Professionellen weitgehend zu verzichten.
Diagnosen sollten auch immer mitberücksichtigen, dass Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene in der jeweiligen Testsituation ein verändertes Verhalten zeigen und gerade deshalb ein verfälschtes Bild liefern können.
|
Eine Integrationslehrperson mit langjähriger Erfahrung berichtet von ihrer Erfahrung mit Diagnosen: "Ich habe meine Schwierigkeiten mit psychologischen Gutachten. Ich kann sie nicht generell in Frage stellen, das traue ich mir nicht zu - das steht mir auch nicht zu. Ich habe ein wenig Probleme mit dieser einmaligen Testsituation, ich habe Probleme mit dem Vokabular und es ist doch meistens eine negative Beschreibung und das stört mich. Und ich handhabe das im Grunde ein wenig zweitrangig. Ich schaue mir zwar die Diagnose an, aber ich lese sie auch meistens erst ein wenig später und ich habe bis jetzt eigentlich nur wenig praktischen Nutzen für meine effektive Arbeit daraus ziehen können. Das sind meine Erfahrungen bis jetzt." (Interview Nr. 6). |
Es darf bei Diagnosen nicht darum gehen, die Behinderung, die Schwächen, die Mängel auf Papier zu bringen und das Anderssein von Menschen mit Behinderung zu betonen, sondern es sollte darum gehen, wie der Mensch mit dieser speziellen Bedingung, die er in die (soziale) Situation mit einbringt, im täglichen Leben, in der Schule, im Elternhaus, in seinem Dorf usw. zurechtkommt. Die Diagnostik sollte aus diesem Grund prozess- und alltagsorientiert sein und darf Folge dessen nicht im Zimmer eines Krankenhauses durchgeführt werden, sondern muss im gewohnten Umfeld stattfinden, in dem sich das Kind, der Jugendliche wohlfühlt, dessen Atmosphäre ihm vertraut ist. Auch die Anforderungen, die an das Kind, an den Jugendlichen gestellt werden, sollten Teil des Alltags sein. Die Beobachtungen selbst sollten unter optimalen Bedingungen durchgeführt werden, da nur so Handlungsoptionen für das pädagogische Tun abzuleiten sind!
Diagnosen sollten auch nicht dazu dienen, hierarchische Strukturen zwischen Könnerschaft und anderen aufzubauen, sondern sie müssen für alle Beteiligten nützlich sein. Aus diesem Grund sollten Diagnosen so geschrieben werden, dass sie auch von allen Beteiligten verstanden werden können. Wenn Diagnosen in einem angemessenen Umfeld stattfinden, bei dem sich Testpersonen und ihre Angehörigen wohlfühlen, eine Sprache sprechen, die von jedem verstanden werden kann, handlungsweisend sind und für alle SchülerInnen in Anspruch genommen werden können, dann verlieren Diagnosen ihren negativen Beigeschmack.
Ein respektvoller Umgang mit allen Schülern, ein Umgang der die Vielfalt der SchülerInnen als Bereicherung sieht, braucht keine selektive Diagnostik, die den Schülern bzw. den Kindern Kompetenzen abspricht und laut BOBAN und HINZ unterstellt, es könne klar zwischen SchülerInnen mit und ohne Förderbedarf unterschieden werden, sondern benötige eine inklusive Diagnostik, die allen SchülerInnen zu Gute komme. Die inklusive Diagnostik soll Lehrpersonen näher an ihre Kinder/SchülerInnen mit ihren speziellen Bedingungen, ihrem Wissen und Können heranführen, sollte Gültigkeit für alle SchülerInnen haben und als Grundlage für individualisiertes Lernen und Lehren gesehen werden und nicht als Spezialdiagnostik für das Kind mit FD missbraucht werden (Boban und Hinz 1998, S. 152).
Diagnostik sollte dazu führen, Kinder so wahrzunehmen, dass sie besser verstanden werden können. Erst wenn Lehrpersonen ihre SchülerInnen verstehen, kann eine Beziehung aufgebaut werden, die gemeinsames Lernen ermöglicht.
BOBAN und HINZ sprechen in diesem Zusammenhang vom Diagnostischen Mosaik, das dem Ziel dienen soll, nach Möglichkeiten für gemeinsames Handeln zu suchen, d. h. allen Schülern Angebote machen zu können.
Das Diagnostische Mosaik besteht aus mehreren Mosaiksteinen, die jeweils die Situation aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und so eine Annäherung an die Lebens- und Lernsituation eines Menschen ermöglicht (1998, S. 153).
Bei dieser Art der Diagnostik geht es nicht darum, die Wahrheit und Objektivität herauszufinden, da die Wahrnehmung individuell ist, d. h. meine Wahrnehmung ist meine, niemand kann so wahrnehmen wie ich wahrnehme, deshalb gibt es kein richtig oder falsch, kein besser oder schlechter (Walthes 2003, S. 59-65). Vielmehr sollte es bei der Diagnostik laut BOBAN und HINZ um das Bewusstmachen und das Zusammenbringen der gleichen, aber auch verschiedenen Vorwissen, Erfahrungen, Einschätzungen, Sichtweisen, individueller Bilder über eine Situation, über ein Kind gehen. Dieses Zusammentragen verschiedener Beobachtungen kann zu neuen Ein-Sichten, Haltungen und Ein-Schätzungen führen, mit denen das Team bewusst und kooperativ umgehen kann (1996, S. 5), um sich gemeinsam auf die Suche zu machen, das Kind besser verstehen zu können.
Dazu ist es notwendig die einzelnen Mosaiksteine zu einem Ganzen zusammenzufügen, wobei jedes Steinchen seine besondere Bedeutung hat.
Die biografische Analyse soll die Vergangenheit des Kindes aufzeigen, den bisherigen Lebensweg bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt reflektieren, bzw. all das ins Auge fassen, was der/die SchülerIn in seinem/ihrem Rucksack mit in die Schule bringt.
Es geht aber hierbei nicht um eine vollständige Widergabe der Biografie, sondern es geht darum, spezielle Ereignissen, Etappen, gegebenenfalls Brüche aufzuzeigen und ihnen Bedeutung beizumessen, damit dem/der Schüler/Schülerin ein besseres Verständnis entgegengebracht werden kann.
Dabei soll es nicht darum gehen, Erklärungen zu verfassen und Ursache-Wirkungszusammenhänge zu finden, sondern es geht darum, Raum zu lassen für Fragen. Fragen bedeutet, etwas verstehen zu wollen und dem Kind ein Stück näher gekommen zu sein.
Bei der Kontextanalyse geht es darum, das soziale Umfeld des Schülers/Kindes, die Familie, die Pädagoginnen, Freunde, Nachbarn, Haustiere, Mitschüler, Lehrpersonen, Therapeuten, Vereine, Freizeitgruppen usw. zu betrachten. Sie nimmt die derzeitige soziale Situation in den Blick und versucht das Netz der Beziehungen und deren Qualitäten aufzugreifen.
Auch für das pädagogische Tun ist es immer sinnvoll, Beobachtungen im Kontext zu sehen und nicht als isoliertes Bild im Raum stehen zu lassen.
Die Analyse der Lerndynamik umfasst alle Beobachtungen, die den Kindern beim Lernen helfen oder für das Lernen hinderlich sein können. Dabei geht es um die Wechselwirkung zwischen drei Polen: die Umwelt des Kindes, das Selbstwertgefühl und die Leistungsfähigkeit stehen in Wechselwirkung zueinander und werden vom sozialen, psychischen und pädagogischen Kreislauf beeinflusst. Dieser Einfluss kann sich fördernd, aber auch hemmend auf die Kinder auswirken und nimmt somit Einfluss auf die Entwicklung des Kindes.
Das Kind kann in einem Umfeld aufwachsen, das die Stärken, die Fähigkeiten erkennt und fördert, dadurch wird es dem Kind möglich sein, sein Selbstwertgefühl aufzubauen und zu stärken. Das positive Selbstwertgefühl, das Bewusstsein über eigene Stärken und Fähigkeiten, motiviert und bestärkt auch die Leistungsfähigkeit des Kindes (Boban und Hinz 1996, S. 15, 1998, S. 156).
Lehrpersonen sollten sich ihres enormen Einflusses, den sie nicht nur auf den Lernprozess, vor allem aber auf die Persönlichkeit des Kindes haben, bewusst sein und respektvoll damit umgehen!
Ziel der Analyse der Übertragungsbeziehung ist die Beziehung zwischen "SchülerIn und LehrerIn" zu beobachten und zu reflektieren und dabei mögliche Projektionen und Übertragungen aufzuspüren.
Nicht unbedeutend ist auch die Analyse über die Rollen der Teammitglieder, die sie im Zusammenhang mit diesem/dieser SchülerIn übertragen oder übernommen haben. Die Wahrnehmung und Verteilungen der Rollen ist auch für das Gelingen von Teamarbeit von großer Wichtigkeit (Boban und Hinz 1996, S. 16-18).
Beim Mosaikstein über die Analyse des Familienkontextes geht es um die Wechselwirkungen zwischen Biografie, Umfeld und Übertragungsdynamiken innerhalb der Familie. Dabei kann es darum gehen, emotional besetzte Themen, Daten und Konstellationen, die auch in der Familie tabuisiert werden aufzugreifen und bewusst zu machen, die unbewusst als Konflikt wirksam werden können (Boban und Hinz 1998, S. 158).
Anhand dieser Mosaiksteine wird es möglich sein, die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen, Beziehungen bewusst aufzubauen und es kann beim Zusammentragen der vielen Mosaiksteinen ein Bild des Kindes entstehen, das nicht durch einzelne pädagogische Beobachtungen entstanden ist, sondern verschiedene Sichtweisen innerhalb des Teams berücksichtigen.
Dabei kann ein weiteres Ziel die Verständigung innerhalb des Teams sein, das bewusster und kooperativer mit individuellen Beobachtungen umzugehen lernt. Die einzelnen Teamkollegen und -kolleginnen lernen mit individuellen Wahrnehmungs- und Konstruktionsweisen umzugehen, sie als einander ergänzend zu sehen und wertzuschätzen.
Wir müssen lernen nicht nur die Verschiedenheit der Kinder, sondern auch die Verschiedenheit anderer Wahrnehmungen zu respektieren und zu nutzen!
Eine inklusive Schule steht ihren SchülerInnen neugierig gegenüber und macht sich auf die Suche ihre SchülerInnen besser verstehen zu wollen. Darum gehört es zu einer professionellen Begleitung von SchülerInnen, ihre individuellen Wege des Lernens und Lebens zu beobachten. Die pädagogische Diagnostik ist die Basis für weitere didaktisch-pädagogische Überlegungen und hilft nicht nur Lehrpersonen ihre SchülerInnen besser kennen zu lernen, sondern hilft auch neue Strategien für den Umgang mit ihnen zu entwickeln. Sie liefert die Grundlage für Gespräche, für den Austausch im Team, aber auch mit Eltern und dokumentiert den Unterricht in der Weise, als dass er reflektiert werden kann.
Insofern versteht sich die pädagogische Diagnostik nicht als "Förderdiagnostik" für SchülerInnen mit einer Funktionsdiagnose, sondern erhebt den Anspruch, für alle SchülerInnen geltend gemacht zu werden. Ihr Ziel ist nicht die Beschaffung der Ressourcen, sondern eine wertschätzende Begleitung aller SchülerInnen in ihrer jeweiligen Lebens- und Lernsituation.
Inhaltsverzeichnis
Die Bewertung und Beurteilung ist das Ergebnis einer kontinuierlichen Beobachtung des Lernprozesses. Die Lehrpersonen haben die Aufgabe den Wert der Leistung zu erkennen und ihn wertzuschätzen.
Wenn Lehrpersonen der Individualität jedes einzelnen Schülers auch bei der Bewertung der Leistung gerecht werden wollen, ist es notwendig, eine andere Sichtweise in Bezug auf die Leistungen von Schülern zu bekommen.
"Adler erachtet es
als wünschenswert,
dass dem Lehrer
die nötige Einsicht
in die Grundlagen
der seelischen Entwicklung
vermittelt werde.
Dann kann seine Haltung
eine verstehende sein
und erschöpft sich nicht
im Bewerten von Leistungen und Handlungen" (Donner 1989,
zit. in Springer 1990, S. 15).
Damit Lehrpersonen auch beim Bewerten von Schülern eine verstehende Haltung einnehmen können, ist es notwendig, dass Leistungsbewertung individualisiert wird, prozessorientiert ist und ermutigend formuliert wird. Die Bewertung soll Aufschluss geben über die individuellen Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf die für sie definierten Entwicklungsziele. Da die Entwicklung der SchülerInnen individuell verläuft, muss dieser Aspekt auch bei der Bewertung berücksichtigt werden. Wie notwendig die Berücksichtigung der Heterogenität in einer Schulklasse ist zeigt die Curriculare Fabel auf.
Das Lernen in heterogenen Lerngruppen ist die Realität unserer Schulen. Diese weitgespannte Heterogenität wirft vor allem zum Thema Bewertung immer wieder Fragen auf.
Das folgende Bild bezieht sich auf die Schwierigkeiten, die sich in Schulklassen immer wieder ergeben und zur Diskussion stehen.
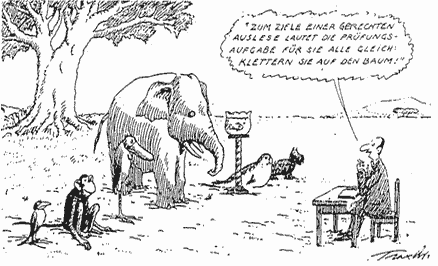
Abb. 3: Forum Schule heute 2001, S. 22
Das Denkmodell des Lehrers trägt nicht dazu bei, der Vielfältigkeit und Individualität der einzelnen Schüler gerecht zu werden. Der Lehrer glaubt Leistung nur dann gerecht beurteilen zu können, indem er die Vielfältigkeit der Schüler übersieht und allen Schülern, auch wenn deren Voraussetzungen unterschiedlich sind, die gleiche Frage, bzw. Anforderung stellt.
In der curricularen Fabel wird das Konzept der individuellen Unterschiede ersichtlich. Es wird von einer Schule erzählt, in denen unterschiedliche Tiere unterrichtet werden. Die Tiere, in diesem Fall die Schüler präsentieren alle ihre Stärken und Schwächen. Es wird von großen Begabungen auf der einen Seite gesprochen, von Mittelmäßigkeit und nicht ausreichenden Leistungen auf der anderen Seite.
Die Fabel beginnt mit der Beschreibung der Ente, die aufgrund ihrer physischen Ausstattung eine gute Schwimmerin war und deren Leistung bereits besser war, als jene des Lehrers. Im Rennen jedoch war sie ein hoffnungsloser Fall und benötigte Nachhilfestunden. Durch die Nachhilfestunden konnte die Ente ihre Schwimmstunden nicht mehr regelmäßig besuchen und dadurch verschlechterten sich ihre Fähigkeiten im Schwimmen.
Die Stärken der Ente wurden vom Lehrer sehr wohl erkannt, jedoch so sehr vernachlässigt, dass sogar angeborene, biologische Stärken verloren gegangen waren. Die weitere Förderung, die die Ente erhielt, knüpfte an den Defiziten, an den Schwächen der Ente an.
Auch in der Schulpraxis tendieren Lehrpersonen den Stärken der SchülerInnen weniger Aufmerksamkeit zu schenken und sie in jenen Bereichen zu fördern, in denen die Schwächen der SchülerInnen liegen. Jedoch bemüht man sich auch bei vorhandenen Schwächen dort anzuknüpfen, wo noch vorhandene Fähigkeiten bestehen.
Interessant ist auch der Hinweis, dass der Leistungsabfall der Ente im Bereich der Stärken niemandem aufgefallen ist, da die Leistung nicht unter dem Durchschnittsbereich lag und deshalb auch keine zusätzlichen Probleme in der Klasse erzeugte.
In der Fabel war der Leistungsabfall im Bereich der biologischen Fähigkeiten nur der Ente selbst bewusst, nicht aber dem Lehrer, da sein Unterricht dadurch nicht beeinträchtigt wurde.
Der Adler, der in der Kletterklasse nicht auf den Baum klettern will, trotzdem von seiner Klasse am schnellsten den Gipfel erreichen konnte, da er seinen eigenen Weg und seine persönliche Methode dafür entwickelt hatte, wird als Problemschüler bezeichnet.
An dieser Stelle weist die Fabel auf die Notwendigkeit der Methodenvielfalt hin, die im heutigen Schulalltag unabdingbar ist, um der Vielfalt der Schüler gerecht zu werden. SchülerInnen nehmen Informationen unterschiedlich auf, verarbeiten sie unterschiedlich und haben dafür eigene Wege, dies gilt in der Schule von heute zu respektieren.
Das Kaninchen stellt jenen Schüler dar, der auf Grund der ständigen Gewichtung der Schwächen die Schule verlässt, da er den Frustrationen nicht mehr entgegenwirken kann.
Auf die Schulpraxis bezogen kann man sagen, dass die Betonung der Schwächen, die defizitorientierte Sichtweise der Lehrpersonen Demotivation und Frustration zur Folge hat. Das Kaninchen sah keine andere Möglichkeit, als die Gruppe zu verlassen.
Die Förderung im Bereich des "Noch-nicht-Gekonnten" wird auch beim Eichhörnchen klar. Das Eichhörnchen musste, da es Klassenbester im Klettern war, seine Flugstunden am Boden beginnen. Es bekam davon einen derartigen Muskelkater, dass auch die Noten im Klettern und Rennen dadurch beeinträchtigt wurden. Und die Präriehunde gehen noch einen Schritt weiter. Sie gaben ihre Jungen zum Dachs in die Lehre, da die Schulbehörde das "Buddeln" nicht im Curriculum verankern wollte und sie darin besonders stark waren (Brabeck 1988, S. 100).
Das Lehrreiche in dieser Fabel ist die individuelle Förderung und der individuelle Bewertungsmaßstab, der aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslagen geltend gemacht werden muss, damit durch eine individualisierte, prozessorientierte und ermutigende Leistungsbewertung die Persönlichkeit des einzelnen Schülers nicht darunter leidet und die Motivation für den weiteren Lernprozess gegeben wird.
WOCKEN (1987, S. 70) wirft die These auf, dass integrative Schulen anders denken und handeln. "Eine Integrationsklasse ist bejahte und gewollte Heterogenität", sie besteht aus einer gut gemischten, vielfältigen Gruppe von Kindern mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Dieses bunte Gemisch von SchülerInnen, die Vielfalt, die sich aus diesem Mischungsprinzip ergibt, führt laut PETERSEN (1974, zit. in Wocken 1987, S. 70) zum "Bildungsgefälle". Kinder lernen von jenen Kindern, die schon etwas mehr und besser können als sie selbst. Kinder brauchen Kinder, die ihnen in der Entwicklung immer noch nahe genug stehen und zugleich schon ein Stück weiter vorangeschritten sind. Laut BANDURA (1979, zit. in Wocken 1987, S. 70) ergibt sich daraus der Wunsch, Mitzumachen und es anderen gleichzutun. Dieses Verlangen ist eine der stärksten Antriebe menschlicher Lern- und Entwicklungsprozesse. Somit bildet eine heterogene Gruppe eine natürliche Möglichkeit gegenseitiger Anregung und fruchtbare Gelegenheiten sozialen Lernens. Im Idealfall ist die Integrationsgruppe ein getreues Abbild der sozialen Umgebung einer Schule.
Gewollte und bejahte Heterogenität setzt voraus, dass der Unterricht der Verschiedenheit angepasst wird, damit alle Kinder zu ihren Möglichkeiten finden. Somit ist die Individualisierung unabdingbare Voraussetzung dafür, dass alle Kinder auf ihrem Entwicklungsniveau lernen können und auch Lernerfolge erfahren und erzielen können. Gerade die Idee des gemeinsamen Lernens in heterogenen Lerngruppen, der schwierige Balanceakt zwischen individuellen Lernangeboten und gemeinsamen Lernsituationen stellt auch die Anforderung in Bezug auf die Bewertungen entsprechend zu handeln (Wocken 1987, S. 70-75).
Als Lehrperson in einer Integrationsklasse wird einem sehr schnell bewusst, dass die üblichen und praktizierten Bewertungsrituale, die aufgrund von Schularbeiten, mündlichen Prüfungen usw. zu Stande kommen, der Individualität des/der einzelnen Schülers/Schülerin nicht gerecht werden, da sie nicht gleichzeitig der Individualität und der Vergleichsnorm entsprechen können. Sowohl Leistungsergebnisse, die aufgrund individueller Ausgangslagen, als auch Leistungsergebnisse, die durch die Vergleichsnorm entstanden sind, erheben den Anspruch objektiv zu sein.
Wie unterschiedlich der Fortschritt von Leistung für SchülerInnen sein kann, soll am folgenden Beispiel aufgezeigt werden. Wenn ein Schüler bei der ersten Mathematik Schularbeit nur 40 % der Aufgaben gelöst hat, bei der zweiten Schularbeit aber bereits 50 % der Aufgaben lösen konnte, kann das Ergebnis als individueller Leistungsfortschritt gewertet werden. Beim sozialen Vergleich bestimmt der erreichte Durchschnittswert der Schulklasse das eigene Leistungsergebnis, bzw. den persönlichen Erfolg oder Misserfolg (Oerter und Montada 1998, S. 990, S. 1004).
OERTER und MONTADA begründen Misserfolg und formales Schulversagen auf das Ergebnis negativer Fremdbewertung von Schülerleistungen. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass Lehrpersonen auf die subjektive Komponente im Bereich der Bewertung aufmerksam gemacht werden.
Die Leistungsfortschritte sollten sich somit an der Grundlage, an der Ausgangslage des/der Schülers/Schülerin messen, da nur so ein individueller Lernfortschritt beschrieben werden kann. Im Hinblick auf die Leistungsbewertung bedeutet dies die Forderung, individuell definierte Entwicklungsziele für alle SchülerInnen einer Klasse festzulegen.
Bereits am ersten Schultag entsteht nach wenigen Stunden des Zusammenseins ein Bild der SchülerInnen, ein subjektives Bild, aufgrund von spontanen Beobachtungen, die Lehrpersonen bewusst oder unbewusst registrieren.
Auch Lehrpersonen nehmen auf dem Hintergrund ihrer persönlichen Erfahrungen, ihrer jeweiligen Tagesverfassung und ihres Informationsstandes wahr, aber auch aufgrund von persönlichen Eigenschaften und Wertvorstellungen, von Zielsetzungen und der eigenen Sichtweise von Lernen und Lehren. Aus diesem Grund ist Leistung nie völlig objektivierbar, da das Bild des/der Schülers/Schülerin und dessen/deren Leistung immer ein beeinflusstes, subjektives ist!
Trotzdem hat jede Lehrperson die Pflicht, systematische Informationen über den allgemeinen Reifegrad, die Lernbereitschaft, das Verhalten sowie über die Kenntnisse und Fertigkeiten eines jeden Schülers zu sammeln (Brugger 2001, S. 227), die in einem späteren Moment die Kriterien für die Bewertung des/der Schülers/Schülerin darstellen.
Der/die SchülerIn mit FD arbeitet gemäß seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten, im Rahmen seiner individuellen Zielsetzungen und vielleicht in einem für manche Menschen im schulischen Kontext noch ungewohnten Ausmaß. Aufgrund seiner individuellen Möglichkeiten gilt es, die Arbeit als Leistung zu bezeichnen.
Die Leistungen entsprechen den individuellen Möglichkeiten des Schülers, nicht einem abstrakt vorgegebenen Lehrplan einer bestimmten Behinderungsart. Sie beziehen sich nicht nur auf den kognitiven Bereich, sondern schließen auch den sozialen, emotionalen und kommunikativen Bereich mit ein, sowie die Erreichung einer bestimmten Autonomie (Paggi o.J., S. 1-3).
Aus diesem Grund erfolgt die Bewertung des/der Schülers/Schülerin mit FD aufgrund der individuell für ihn festgelegten Ziele, die im Individuellen Erziehungsplan dokumentiert werden. Diese Ziele werden aufgrund der Ausgangslage des/der Schülers/Schülerin mit FD erstellt und erheben den Anspruch auf eine individuelle Bewertung, d. h. dass der individuelle Leistungsfortschritt bewertet wird und keine Vergleichbarkeit zu den in der Regelklasse geltenden Bewertungsstandards hergestellt werden kann.
Dadurch wird auch in Bezug auf die Bewertung der Individualität und der Einzigartigkeit der Schülerinnen und Schüler mit FD Rechnung getragen, nicht aber den restlichen Schülern und Schülerinnen ohne FD!
|
Eine Integrationslehrperson bringt die Praxis der Bewertung auf den Punkt: "Ich stehe voll hinter der individuellen Bewertung, merke aber, dass doch einige Lehrpersonen Schwierigkeiten damit haben und mehr die Vergleichsnorm im Kopf haben. Ich denke, einfacher ist die Bewertung sicher, wenn ein Kind einen ganz eigenen, individuellen Erziehungsplan mitbringt. Die größeren Schwierigkeiten sehe ich dann, wenn die Lernziele sich vom Jahresplan nur zum Teil oder kaum unterscheiden und dann z.B. in einigen Fächern die Kinder ohne Funktionsdiagnose kaum oder gar nicht individuell bewertet werden. Beim Kind mit Funktionsdiagnose kommt die individuelle Bewertung aber sehr wohl zum Tragen. Hier entsteht ein Ungleichgewicht! Und ich denke es wäre wichtig, generell der individuellen Bewertung einen größeren Raum für alle zu geben" (Interview Nr. 6). |
Im Schulalltag muss verstärkt betont werden, dass die Leistungen zwischen einzelnen SchülerInnen nicht vergleichbar sind, auch wenn diese die selbe Jahrgangsklasse besuchen.
Dies bedeutet aber in keiner Weise, dass aufgrund der Individualität, aufgrund eines Individuellen Erziehungsplanes vom Schüler/von der Schülerin mit FD keine Leistung abverlangt werden kann, muss oder soll; im Gegenteil, der Schüler mit Beeinträchtigung hat das Recht auf eine möglichst umfassende Förderung und Entwicklung und somit auch die Pflicht, seinen Möglichkeiten entsprechend dazu beizutragen (Paggi 1996, S. 816).
In gewissem Maße wird die Individualität in Bezug auf die Bewertung vor allem den SchülerInnen mit FD gewährt, nicht aber allen SchülerInnen der Klasse, da sie den in der Regelklasse geltenden Bewertungsstandards unterliegen.
In der Praxis merkt man gerade im Bereich der Bewertung immer wieder, dass Lehrpersonen sich aus Angst vor Rekursen genauestens an gesetzliche Bestimmungen halten und halten müssen. Die alleinige Bereitschaft der Lehrpersonen, auf die Vielfalt aller Schüler und Schülerinnen einzugehen und diese zu respektieren, reicht gerade beim Aspekt der Bewertungen nicht aus. Die Bewertungen vollständig aus der Schule zu verbannen, würde nicht die Lösung des Problems darstellen, da Ergebnisse auch von Schülern und Schülerinnen bewertet oder begutachtet werden wollen.
In diesen beiden Wörtern Bewertung und Begutachtung verbergen sich zwei wichtige Aspekte: "den Wert betonen" und "das Gute achten" (Gross 1996, S. 18-19). Aus diesem Grund muss die Bewertung einen anderen Sinn bekommen, sie soll nicht wertend sein, aber sie soll den Wert und auch das Gute, die erbrachte Leistung betonen.
FISCHER sagt: "Wertschätzung beginnt mit kleinsten Momenten, die einen Wert transportieren. Wir können ihn erspüren und uns auch in ihn versenken. Wertbesetzt kann alles sein, vorausgesetzt, es wird geliebt" (Fischer 2002, S. 46).
Den Wert in der Leistung eines Kindes zu erkennen, muss das Bedürfnis einer jeden Lehrperson sein. Wenn wir als Lehrpersonen den Wert der erbrachten Leistung ermitteln und davon ausgehen, dass hinter jeder Leistung ein Wert steckt, wenn wir dann diesen Wert betonen, verlieren Bewertung und Beurteilung den negativen Beigeschmack, der ihnen anhaftet.
Lehrpersonen stellen häufig die Frage nach einer sinnvollen Methode der Leistungsbewertung in Integrationsklassen, einer Methode, die der Vielseitigkeit aller SchülerInnen gerecht werden kann.
Eine mögliche Chance für SchülerInnen und Lehrpersonen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung ist die verbale Rückmeldung über den Lernprozess, das individuelle Gespräch zwischen SchülerInnen und Lehrpersonen.
In einem ausführlichen Gespräch kann der/die SchülerIn zunächst versuchen, seine/ihre Arbeit, die Leistungen zu beschreiben und versucht somit den Weg des Lernens zu rekonstruieren und ihn sich bewusst zu machen. Wichtig ist, dass der/die SchülerIn, wie auch die Lehrpersonen den Lernprozess erfassen und ihm bei der Bewertung mehr Bedeutung und Gewicht beimessen. Ebenso sollten die Beobachtungen, die der/die SchülerIn innerhalb des Lernprozesses an sich selbst macht in den Bereich der Bewertung mit einfließen. Die Auseinandersetzung mit dem Lernprozess kann anhand einiger Fragen erfolgen, die sich der/die SchülerIn selbst stellen kann oder auch von der Lehrperson gestellt werden können. Der/die SchülerIn kann sich über bestehende Schwierigkeiten bewusst werden, kann Fortschritte des Lernprozesses selber wahrnehmen und reflektieren. Vielleicht hat der/die SchülerIn bei einer nicht zufriedenstellenden Leistung eine Begründung dafür, die auch für Lehrpersonen nicht ohne Bedeutung sein sollte.
Der Lernprozess kann durch die gemeinsame Reflexion aufgeschlüsselt werden und wird dadurch dem/der SchülerIn und den Lehrpersonen transparenter. Im individuellen Gespräch können auch weitere Maßnahmen und Hilfestellungen, die den Lernprozess optimieren besprochen und ausgearbeitet werden. Die Reflexion fördert nicht nur die Kritikfähigkeit der jungen BürgerInnen, sondern wertet gleichzeitig auch die Denkweise der jungen Menschen auf.
In dem Moment, in dem Lehrpersonen Bewertungsgespräche mit allen Schülerinnen und Schülern einer Integrationsklasse führen, wird Bewertung transparenter und dadurch können Gefühle der Ungerechtigkeit zum größten Teil vermieden werden. Im Gespräch wird den SchülerInnen klar, dass annähernde Ergebnisse keineswegs auf die gleiche Leistung schließen lassen, vor allem dann, wenn die persönlichen Lernbedingungen von SchülerInnen in die Bewertung mit einfließen. Eine möglichst "gerechte" Bewertung für alle SchülerInnen kann nur dann erfolgen, wenn persönliche Ausgangslagen, individuelle Lernwege und -prozesse der SchülerInnen mitberücksichtigt werden.
|
Auch eine Integrationslehrerin mit 14jähriger Erfahrung berichtet: "Für mich werden Noten, bzw. die Bewertung mit zunehmender Unterrichtstätigkeit immer bedeutungsloser. Ich bin zwar verpflichtet, Bewertungen zu schreiben, bewerte aber individuell. Ich glaube, dass es sehr toll wäre, wenn man mit den SchülerInnen eine Art Portfolio machen könnte. Portfolio, wo sie ihre, für sie wertvollen Beiträge hineingeben und sie diese Mappe im Laufe der Schuljahre mit ihren Leistungen anreichern. Wichtig dabei wird auch die Selbsteinschätzung des Schülers. Durch Bewertungen, die nur von Seiten der Lehrpersonen getroffen werden, lernt der Schüler nicht sich selbst einzuschätzen. Ich glaube, dass gerade das für seine Zukunft sehr wichtig wäre. Die Reflexion über den Lernprozess, den der Schüler vielleicht auch gemeinsam mit dem Lehrer oder der Lehrerin angeht. Ich denke mir, dass man durch das individuelle Gespräch Transparenz zeigt und die Frage der Gerechtigkeit ausbleiben könnte". (Interview Nr. 7) |
Generell muss einmal der Zweck oder die Aufgabe der Bewertung näher ins Auge gefasst werden. Die Bewertung und Beurteilung soll nichts über den Wert oder die Würde eines Menschen aussagen, sondern den individuellen Lernfortschritt des/der Schülers/Schülerin beschreiben und zwar so, dass der /die SchülerIn über seine individuell erbrachte Leistung Aufschluss bekommt. Die Informationen sollten dem/der SchülerIn dazu dienen, eine prozessorientierte Übersicht zu bekommen und sollten sich auch motivierend auf die SchülerInnen auswirken. Lehrpersonen sollten sich stets bewusst sein, dass jede Form der Beurteilung nur eine relativ grobe Annäherung an die vom jeweiligen Schüler real erbrachten Leistung ist und dass gerade auch aus diesem Grund prognostische Werte eines Zeugnisses in Bezug auf die spätere Lebensleistung, bzw. Arbeit der beurteilten SchülerInnen in Frage gestellt werden müssen.
In diesem Zusammenhang spricht PRINZ VON HOHENZOLLERN von der "Unschärfe" der Noten. Er gibt an, dass der prognostische Wert eines Zeugnisses in Bezug auf die spätere Lebensleistung nicht ermittelt werden kann, da das schulische Leistungsspektrum in der Regel deutlich anders gelagert ist als etwa das berufliche. Aber nicht nur in Bezug auf die Zukunft des/der Schülers/Schülerin sind Bewertungen zu überdenken, sondern bereits das Wissen um die Unschärfe der Noten und die Tatsache, dass sich die Unschärfe von Beurteilungen mit der Zahl der Beurteiler und Beurteilten weiter verdichtet, lässt jegliche Form des Bewertens und Beurteilens in ein anderes Licht rücken (Prinz von Hohlenzollern 1991, S. 31 f.).
Wie unterschiedlich die Sichtweisen von Lehrpersonen in Bezug auf die Bewertungen von SchülerInnen ist, wird in der Praxis immer wieder bei Notenkonferenzen ersichtlich. Während einige Lehrpersonen die persönlichen Lernfortschritte der SchülerInnen beobachten und sie in den Prozess der Bewertung mit einbinden, gilt bei anderen Lehrpersonen die Vergleichsnorm. Da Lehrpersonen über die Unschärfe der Noten und ihre geringe Aussagekraft für die Zukunft der SchülerInnen im Bilde sind, wird auch die Diskrepanz für Lehrpersonen immer ersichtlicher: Einerseits sind sich Lehrpersonen bewusst darüber, sich ein subjektives Bild des/der Schülers/Schülerin gemacht zu haben, auf der anderen Seite hat die Schule bzw. die Lehrpersonen den Auftrag, die Leistungen der SchülerInnen zu beurteilen. Um diesem Auftrag gerecht werden zu können, würden Lehrpersonen ein geeignetes Instrumentarium benötigen, aber selbst dann könnte die Unschärfe der Leistungsbeurteilung nicht behoben werden.
Dies bedeutet, dass niemals ein perfektes Maß an Gerechtigkeit zu erreichen sein wird und gerade deshalb sollte man als Lehrperson sich um eine verbesserte, humanere und schülernähere Beurteilungen der schulischen Leistungen bemühen (Prinz von Hohenzollern 1991, S. 32).
Die Leistungsbeurteilung stellt auch für Eltern ein wichtiges Medium der Kommunikation dar. Sie informiert die Eltern über den derzeitigen Stand ihrer Kinder in der Schule, aber auch für SchülerInnen ist die Beurteilung der Leistung eine Mitteilung besonderer Art. Sie werden darüber informiert, wie erfolgreich sie in den Augen der Lehrpersonen sind, worauf die SchülerInnen dann entsprechend reagieren können. Generell kann Bewertung beim Schüler, bei der Schülerin dazu führen, dass er sich in seinem Verhalten und Handeln, in seinem Lernprozess bestätigt fühlt und hätte somit die Funktion der Verstärkung, der Ermutigung und der Motivation. Auf der anderen Seite kann Leistungsbeurteilung für SchülerInnen auch gegenteilige Auswirkungen haben. Der/die SchülerIn kann aufgrund der Beurteilung in seinem Selbstbild gekränkt werden, resignieren und die Motivation, die ausschlaggebend für den Lernprozess ist, auch gänzlich verlieren.
Bewusst werden muss man sich als Lehrperson, dass Unmut und Demotivation dem Schüler nicht helfen, seinen Lernprozess besser in Griff zu bekommen (Ziegenspeck 1999, S. 98 f.), sondern ihn eher dazu veranlassen, zu resignieren.
Auch wenn die Bewertung in den letzten Jahrzehnten im schulischen Bereich durch die Abschaffung der Ziffernnoten und der Einführung der verbalen Bewertung für alle Schüler der Pflichtschule viele Veränderungen erfahren hat und dabei auch dem Integrationsgedanken Rechnung getragen wurde, so bedarf es dennoch Überlegungen, wie Leistungsbewertung humaner gestaltet werden kann. HINZ fordert, dass der gemeinsame Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen und Kindern und Jugendlichen ohne diese besonderen Bedürfnisse auf Ziffernzeugnisse verzichten solle und durch einen verbalen Lernentwicklungsbericht ersetzt werden sollte (1995, S. 21).
Ein verbaler Lernentwicklungsbericht, der über die Leistungsfortschritte des/der Schülers/Schülerin informiert und auch auf noch bestehenden Schwächen und Schwierigkeiten aufmerksam macht, ein Bericht, bei dem verstärkt auf die Entwicklung des/der Schülers/Schülerin eingegangen wird - wobei die SchülerInnen auch das Recht haben sollten zu ihrer Entwicklung selbst Stellung zu nehmen - kann eine gerechte und humane Methode sein. Wichtig ist sich als Lehrperson bewusst zu sein, dass Berichte mit viel Sensibilität geschrieben werden müssen, da Sätze, die Kinder beurteilen und Negatives aussagen, sehr viel verletzender sein können als eine schlichte Note (Jaumann und Riedinger 1996, S. 51).
Aufhorchen lässt die Aussage von Reinhard Lempp aus kinderpsychiatrischer Sicht, der massiv gegen Noten votiert. Er behauptet, dass nur diejenigen für Noten und Zeugnisse eintreten, die vom herrschenden Schul- und Zeugnissystem profitiert haben: "Es sind immer diejenigen, die in der Unsolidarität, in der Abgrenzung von den Schlechteren ihren Erfolg gefunden haben, die, gewissermaßen auf den Schultern der anderen stehend, das Hochwasser überstehen konnten" (zit. in Schwark et al. 1991, S. 51-52).
Die Aussage vermittelt sehr deutlich das Bild der Abgrenzung zwischen den "guten" und "schlechten" SchülerInnen und muss als Anstoß gesehen werden, die Klassifizierungen, die durch Noten und Zeugnisse in Klassen entstehen können, kritischer ins Auge zu fassen. Wenn Noten oder Bewertungen jenes Resultat bewirken, dass SchülerInnen sich untereinander vergleichen und aufgrund dessen Kriterien für die Ausgrenzung geschaffen werden, so lässt dies erahnen, welche fatale Auswirkungen das auf die sozialen Beziehungen in einer Integrationsklasse, aber nicht nur in Integrationsklassen, haben.
|
Auch für Eltern sind Bewertungen, die sie über ihre Kinder lesen nicht immer angenehm und können unter Umständen auch verletzend wirken. Eine Mutter äußert sich in diesem Zusammenhang wie folgt: "Sie", damit meint sie die Integrationslehrperson, "hat ihn herausgenommen, wenn er gestört hat und ich glaube, am Anfang hat sie ihn ganz viel herausgenommen. Auch weil er es gewollt hat! Vielleicht war er wirklich in der Klasse überfordert, ich weiß es nicht! Am Nachmittag hat er dann schon Kontakt mit Klassenkameraden, das hat er schon, deshalb hat mich auch das Zeugnis so geärgert. Sie haben geschrieben, dass er wenig Kontakt zu seinen Mitschülern hat, das ist nicht -- Eltern berichten mir etwas ganz anderes, wo ich mir denke---//" (Interview Nr. 1). |
Gerade die Abgrenzung vom "Besseren" zum "Schlechteren", vom "Richtigen" zum "Falschen" lässt Heterogenität zu einem Merkmal der Ausgrenzung werden. Wenn in einer Schulklasse nur "falsch" und "richtig" existieren darf, wenn nur "schwarz" und "rot" Gültigkeit erreichen, haben bunte Farben des Regenbogens, auch wenn sie noch so strahlen, keine Wirkung mehr. In diesem Zusammenhang würde es nicht schwer fallen, gänzlich auf die Bewertung zu verzichten.
WOCKEN (1987, S. 279)wirft die These auf: "Wer für Integration ist, ist gegen Leistungen; wer für Leistungen ist, kann nicht für Integration sein." Die Beziehung zwischen Integration und Leistung wird als fragwürdig, ja als widersprüchlich und konfliktträchtig wahrgenommen und beurteilt.
Deshalb ist es wichtig, dass Lehrpersonen unterschiedliche Arbeiten der vielfältigen SchülerInnen nicht miteinander vergleichen und als Rang bewerten, sondern sie als intensive Arbeit eines/einer jeden Schülers/Schülerin achten, die die Fülle der gemeinsamen Arbeit bereichert. Auch müssen die unterschiedlichen Arbeiten der SchülerInnen auch für die anderen SchülerInnen transparent gemacht werden, d. h. dass Zwischenberichte oder Abschlussergebnisse allen Kindern mitgeteilt und honoriert werden, damit die SchülerInnen auf diese Weise lernen, neben ihren eigenen Erfahrungen, die unterschiedlichen Leistungsmöglichkeiten der Klassenkameraden einzuschätzen und zu würdigen lernen. Besondere Fähigkeiten, aber auch die individuellen Grenzen der am Lernen beteiligten Personen zu kennen, unterschiedliche Fähigkeiten und Grenzen wahrzunehmen, bedeutet sich mit der Vielfalt der Klasse auseinander zu setzen. Je gefestigter Kinder in der Entwicklung ihrer eigenen Persönlichkeit werden, desto mehr sind sie in der Lage, Kontakte zu Gleichaltrigen aufzunehmen, die in ihrem Aussehen oder in ihrer Art anders als gewohnt sind (Jaumann und Riedinger 1996, S. 33, S. 103).
Die Schule und somit auch die Lehrpersonen haben die Pflicht zur Persönlichkeitsentfaltung der SchülerInnen beizutragen und müssen somit allen SchülerInnen das Recht auf Entfaltung der individuellen Begabungen und Fähigkeiten gewährleisten.
Dann wird es SchülerInnen gelingen, aufgrund ihrer Stärken das nötige Selbstbewusstsein aufzubauen, das ihnen in einem anderen Moment den toleranten Umgang mit der Vielfalt ermöglichen wird. Nur wer selbst sicher ist, kann andere akzeptieren! Daraus ergibt sich an die Lehrpersonen die Forderung, die verschiedenen Fähigkeiten und Entwicklungsbedürfnisse der SchülerInnen zu erkennen und zu berücksichtigen und sie gemäß ihren Möglichkeiten zu fördern.
Gerade das scheint die Lösung für die Beurteilung und Bewertung in Klassen mit heterogenen SchülerInnen zu sein, dass alle SchülerInnen in den Genuss einer individuellen Förderung kommen und dann auch von der individuellen Bewertung profitieren.
Wenn das Recht auf Persönlichkeitsentfaltung für alle SchülerInnen in der Schule geltend gemacht wird, nicht nur für die "besonderen" Schüler, so kann von einer inklusiven Schule gesprochen werden.
PRINZ VON HOHENZOLLERN gibt an, dass Leistungen von allen Menschen wahrgenommen werden wollen und es inhuman ist, die Anstrengungen und Leistungen eines Menschen nicht zu beachten (Prinz von Hohenzollern und Liedtke 1991, S. 28f.). Deshalb ist es wichtig und notwendig, auch im Sinne der inklusiven Sichtweise, Leistungen von allen Schülern zu fordern, diese zu bewerten, wobei primär die Individualität in Bezug auf die Ansprüche gegeben sein muss. SchülerInnen sollen das Recht haben Aussagen über ihren persönlichen Lernfortschritt, über die Lernbedingungen, die Handlungsmöglichkeiten zu erhalten und nötige Hilfen zu bekommen. Wichtig ist nicht die Frage: Noten ja oder nein, sondern viel wichtiger ist es, sich um eine humanere und schülergerechtere Bewertung zu bemühen (Jaumann und Riedinger 1996, S. 51f.). Aus diesem Grund dürfen Bewertungen nicht in erster Linie informativen Charakter haben und als Berichterstattung für Eltern, SchülerInnen und Lehrpersonen dienen, sondern sie sollten ermutigende und förderdiagnostische Funktion haben. Dies erfordert ein anderes Verständnis von Schule, einer Schule, die nicht rein als Ort der Wissensvermittlung gesehen werden kann (Valtin 2002, S. 78).
In der inklusiven Schule wird der Leistungsbegriff nicht nur von kognitiven Aspekten geprägt, sondern umfasst vor allem auch Bereiche, wie z. B. die Sozial- und Selbstkompetenz der SchülerInnen. Daraus resultiert, dass den kognitiven Leistungen in Bezug auf die Bewertung keine größere Wichtigkeit geschenkt wird. Bewertung mit inklusiver Qualität bedeutet, dass ausgehend von der Verschiedenheit der SchülerInnen und den individuellen Entwicklungspotentialen Beobachtungen des individuellen Entwicklungsfortschrittes durchgeführt werden. Die individuellen Fortschritte erhalten nach deren Feststellung den Wert und werden betont.
Da Lehrpersonen in Bezug auf die Bewertung an gesetzliche Rahmenbedingungen gebunden sind, können diese nicht umgangen werden, sie können aber dafür Sorge tragen, dass die Bewertung humaner und schülergerechter gestaltet wird und vor allem zu keiner selektierenden Maßnahme wird. Dafür benötigen Lehrpersonen nicht nur eine veränderte Form der Bewertung, sondern auch eine veränderte Sichtweise in Bezug auf individuelle Entwicklungs- bzw. Leistungsprozesse. Lehrpersonen müssen dafür die ihnen als gerecht geltenden Wege der Vergleichsnorm verlassen und der Vielfalt in ihrer unterschiedlichen Dimension Rechnung tragen.
Inhaltsverzeichnis
In einer persönlichen Zukunftskonferenz geht es darum, Projektionen, Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Es ist ein geeignetes und bereits in den USA und Deutschland erprobtes Instrument, um viele Menschen in die Erarbeitung gemeinsamer Ziele einzubeziehen und sie für gemeinsame Ziele zu gewinnen.
Die vielen Menschen haben die Funktion, dass sie aus unterschiedlichen Umfeldern stammen, unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen mitbringen und einen repräsentative Querschnitt der Organisation in einem Raum zusammenbringen. Durch die Heterogenität des Unterstützerkreises, durch eine Vielfalt von Beziehungen und Wahrnehmungen können inspirierende Blicke in Bezug auf SchülerInnen entstehen (Boban und Hinz 1999, S. 13-23).
Die persönliche Zukunftskonferenz gibt Raum für Informationsphasen, Erfahrungsaustausch, Diskussion und gemeinsame Planung (Seidl und Graf-Götz 2002, S. 748f.).
Gemeinsam berät man über die Zukunft und entwickelt Strategien für deren Umsetzung. Man denkt und handelt miteinander!
Die Konferenz beginnt nicht damit, dass die verschiedenen Teilnehmer Probleme und Schwierigkeiten auflisten und bearbeiten, denn dies würde unweigerlich deprimieren und Ängste auslösen. Bei Zukunftskonferenzen ist der Ausgangspunkt vielmehr die Zukunft, nämlich eine Vision davon, was in einigen Jahren sein soll (Seidl und Graf-Götz 2002, S. 750).
Es geht zu Beginn darum, den Bezug zu vorhandenen Talenten und Fähigkeiten der betreffenden Person herzustellen und dann Möglichkeiten und Chancen von Situationen zu entwickeln. Dabei wird das Gegenwärtige betrachtet und Zukünftiges schrittweise geplant. Die defizitorientierte Sichtweise wird verbannt und die Stärken der betreffenden Person werden hervorgehoben.
Laut SEIDL und GRAF-GÖTZ verfolgt die Zukunftskonferenz vier Prinzipien:
-
Das ganze, offene System in einen Raum bringen, was soviel bedeutet, wie bereits vorhin erwähnt, dass durch die anwesenden Personen ein repräsentativer Querschnitt der Organisation vertreten ist und der Heterogenität Rechnung getragen wird.
-
Der Fokus wird auf die Zukunft gelenkt, nicht auf die Probleme, die bestehen oder auch nicht, denn das würde die defizitorientierte Sichtweise begünstigen und kreativen Lösungen von Beteiligten im Weg stehen. Zentraler Punkt müssen deshalb die Stärken, Fähigkeiten, Interessen und Neigungen der betreffenden Person sein.
-
Gemeinsamkeiten finden statt Konflikte bearbeiten. Oft werden Energien dafür verschwendet, um zu überlegen, was uns von anderen trennt. In Zukunftskonferenzen konzentrieren wir uns nicht auf das, was zwischen uns steht, sondern auf das, was uns verbindet.
-
Erst Maßnahmen planen, wenn der Konsens erreicht ist. In diesem Moment, indem Informationen ausgetauscht werden, wird auch die Notwendigkeit von allen gesehen etwas tun zu wollen, dabei müssen aber zuerst Gemeinsamkeiten erkannt werden, erst dann können erste Maßnahmen geplant werden (Seidl und Graf-Götz 2002, S. 750).
"Die einzige Möglichkeit, die Grenzen des Machbaren zu entdecken, ist das Unmögliche zu riskieren" (Verfasser unbekannt 2003).
Laut BOBAN muss es Ziel des Kreises sein, die Situation eines Menschen zu verbessern, indem alle Anwesenden sich gemeinsam für Möglichkeiten einsetzen und tragende Strukturen entstehen lassen (Boban 1996).
Folge dessen geht es bei einer Zukunftskonferenz um die Entwicklung einer gemeinsam getragenen Vorstellung der Zukunft, gleichzeitig aber auch um die Bereitschaft zum Helfen, auch um kurz- oder langfristig Projekte zu führen, die Schritte auf dem Weg in diese Zukunft darstellen (Seidl und Graf-Götz 2002, S. 750).
Zukunftsvorstellungen sind ein Spiegel unserer Gesellschaft, ihrer Wertvorstellungen, die über Erziehung und Bildung vermittelt werden.
In amerikanischen Schulen wird bereits drei Jahre vor Schulende mit einer individuellen Zukunftsplanung für den einzelnen Schüler/die einzelne Schülerin begonnen, bei der geklärt werden soll, wie sich der/die SchülerIn seinen/ihren weiteren Weg vorstellt. Es wird versucht konkrete Schritte zu ermitteln und sich bereits ein Bild von der Zukunft zu machen. Dabei müssen, wie bereits erwähnt, die Stärken und Interessen des/der Schülers/Schülerin im Vordergrund stehen (Doose 1997, S. 198f.).
In unseren Schulen im Lande findet jeweils beim Übertritt von einer Schulstufe in eine andere ein Übertrittsgespräch statt, an dem die Lehrpersonen der früheren Schule, die derzeitigen Lehrpersonen, die Eltern, Direktoren, Psychologen und all jene Personen, die auch den FEP erstellt haben, teil nehmen, um über die Situation der Zukunft zu sprechen. Dabei sind wir aber noch nicht auf dem Punkt, dass vorwiegend die Stärken und Fähigkeiten der SchülerInnen besprochen werden, sondern es geht um ein erstes Zusammentragen von Erfahrungen. Die Hauptperson, der/die SchülerIn selbst nimmt an diesem Übertrittsgespräch nicht teil.
In diesem Zusammenhang scheint ein Gedicht von Katharina SPRINGER treffend:
"Kinder sagen uns immer, was sie brauchen.
Wir müssen nur hören, sehen und verstehen lernen" (Springer 1990, S. 77).
Übertrittsgespräche sind weiters nur für SchülerInnen mit Förderdiagnosen gedacht, nicht aber für alle SchülerInnen einer Schule.
Sinnvoll sind Übertrittsgespräche deshalb, da Perspektiven und Sichtweisen von/über den Schüler eröffnet werden, damit ein wechselseitiger Lernprozess eingeleitet werden kann.
Auch BOBAN erklärt, dass gerade bei Übergängen der Bedarf an stützenden, problemlösenden Kreisen groß ist (1996).
Gleichzeitig wächst durch das gemeinsame Gespräch das gegenseitige Verständnis und die Bereitschaft, gemeinsam gefundene Ziele zu verfolgen und in die Praxis zu integrieren.
Bei neuen Situationen eines/einer SchülerIn ist es unbedingt erforderlich, dass Lehrpersonen, die die SchülerInnen bereits kennen und die "neuen" Lehrpersonen, sowie Eltern kooperativ sind, denn neue Lebensperspektiven, Veränderungen erfordern kooperatives Handeln aller Beteiligten. Alle möglichen Hilfen müssen angefordert werden, um in solchen Situationen angemessen zu begleiten. Dabei geht es auch darum, die Kompetenzen unterschiedlicher Fachkräfte Wert zu schätzen und dessen Hilfe anzunehmen und dabei die eigene Kompetenz nicht in den Schatten stellen zu müssen. Durch die Kooperation mehrerer Personen können sich vielseitige Ideen und vielseitige Wege für die SchülerInnen auftun.
Inhaltsverzeichnis
Der persönliche Unterstützerkreis setzt sich aus einem geladenen Kreis von Personen zusammen, die mit Lust und Offensive an Projektionen herangehen.
Diese Personen sind entweder Freunde desjenigen, der Beratung und Hilfe für seine Zukunft benötigt, oder Menschen, die bereits mit dem Kind/Jugendlichen professionell arbeiten, es können aber auch Personen aus der Nachbarschaft sein, die das/den Kind/Jugendlichen besser kennen lernen wollen. Es kann sich auch um interessierte Menschen handeln, deren Position wichtig für einen weiteren Schritt im Leben der zukunftsuchenden Person ist.
Es geht darum, dass man gemeinsam über die Zukunft berät, Pläne und Strategien für deren Umsetzung entwickelt, dabei wird der Kreativität der anwesenden Köpfe keine Grenzen gesetzt.
Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist die Frage von O`Brien: "Under what conditions can this person discover and express who she/he is as a known and valued contributor to our community?" - "Unter welchen Bedingungen kann diese Person sich entdecken und ausdrücken, wer sie als ein bekannter und geschätzter Beitragender zu unserer Gemeinschaft ist?" (zit. in Boban 2003)
Ziel dabei ist, ein tragfähiges Netz für den Beratungssuchenden aufzubauen, die als zentrales gemeinsames Geschenk die Zeit mitbringen, die sie gemeinsam nutzen, um kreative Ansätze für die Zukunft zu finden. Es geht in erster Linie darum, verschiedene Ideen und Vorstellungen zu sammeln, um daraus Lösungsansätze zu finden.
Die verschiedenen "Freunde" werden innerhalb von vier konzentrischen Kreisen zunächst zugeordnet. Von innen nach außen werden zunächst jene Menschen aufgeschrieben, mit denen die Person am vertrautesten ist, wie z. B. Familienangehörige. Zum zweiten Kreis zählen all jene Personen dazu, die der Person nahe stehen, wie z. B. Freunde, Schulkameraden usw. Zum nächsten Kreis gehören all jene Personen, mit denen die Person über Arbeits- und Interessenzusammenhänge verbunden ist und beim letzten Kreis dürfen sich all jene eintragen, die für den Kontakt zur Person bezahlt bekommen (Boban und Hinz 1998 S. 155 f.).
Wichtig erscheint zu diesem Zeitpunkt anzumerken, dass sich die beteiligten "Freunde" aufgrund der schematischen Zuordnung nicht klassifiziert fühlen und deshalb ihre Aussagen weniger oder mehr Gewicht haben. Der Sinn des "Circle of Friends" ist es, die leeren Kreise aufzuzeigen und sie zu füllen, da vor allem Menschen mit Beeinträchtigung außerhalb der Schule nur wenig Kontakt zu Gleichaltrigen haben.
Das Motto: Wenn sich Freunde miteinander treffen, um einem ihrer Freunde zu helfen, dann findet man sicher auch eine Lösung!
Viele Köpfte bringen unterschiedliche Sichtweisen ein, die auf neue Wege führen können und gerade deshalb ist jeder einzelne Beitrag wichtig!
BOBAN spricht von einem generellen Effekt. Die (Be-)Stärkung der Person ist bereits durch das Zusammentreten des Kreises wie auch die aller Beteiligten am Prozess festzustellen (Boban und Hinz 1998, S. 156-157).
Eine wichtige Rolle spielt der/die ModeratorIn, dessen Aufgabe es ist, die tragenden Elemente einer Diskussionsrunde aufzuzeigen und mit Humor und Geschick ein positives Gespräch zu leiten. Dabei strebt der/die ModeratorIn eine Orientierung der Kompetenzen, nicht der Defizite an! Wichtig ist dabei, die individuellen Ideen und Wünsche der anwesenden Personen gleichwertig zu behandeln, ihnen Gewicht zu schenken und die Ideen dann so zu formulieren, dass sie nicht nur dem Betroffenen, sondern auch den anwesenden Personen Motivation und Kraft geben, mit dem Ziel, dass diese sich in Zukunft dafür einsetzen. Jeder noch so unterschiedlicher Denkansatz wird ernstgenommen und daraus entwickeln sich weitere Planungsschritte, die im "Making Action Plan" aufgezeigt werden.
Um weitere Schritte einzuleiten versammeln sich die eingeladenen Menschen, von denen die betreffende Person sich Unterstützung ihrer Perspektiven verspricht, um einen Tisch. MAP besteht aus acht aufeinanderfolgenden Etappen, deren wesentliche Ergebnisse auf einem Plakat visualisiert werden.
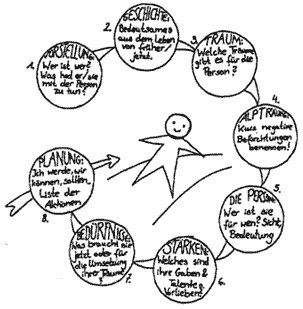
Abb. 4: Making Action Plans (MAP) (Boban und Hinz 1998, S. 159)
Zu aller erst stellen sich die anwesenden Personen vor und erläutern kurz, in welcher Beziehung sie zur betreffenden Person stehen.
Im zweiten Schritt werfen die Teilnehmer einen Blick auf die Geschichte der Person, sofern sie nicht schon informiert sind und Teil der Geschichte sind. Wenn alle Personen die notwendigen Informationen erhalten haben werden die Beteiligten angehalten, einen Traum für die betreffende Person zu formulieren. Durch die Angabe "Traum" wird den Teilnehmern suggeriert, dass alles erlaubt ist und gerade deshalb der Phantasie keine Grenzen gesetzt werden. Alpträume, negativen Befürchtungen werden zwar kurz genannt, werden aber nicht ausgebaut und besprochen, damit der Magnetismus des Positiven nicht gehemmt wird.
In einem weiteren Schritt überlegen die anwesenden Teilnehmer, welche Eigenschaften sie an der Person schätzen, ebenso werden ihre Vorlieben, Stärken und Begabungen thematisiert. Weiters wird abgeklärt, was es braucht, um die vorher gesammelten Träume zu realisieren.
Alle Impulse münden somit in ein Mindmap, das durch den/die ModeratorIn aus den Zurufen der TeilnehmerInnen erstellt wird.
Zum Schluss wird eine Verabredungsliste erstellt, bei der alle Anwesenden konkret angehalten werden, sich für die Erreichung des Ziels einzusetzen und dazu beizutragen.
Damit sich die formulierten Ziele in der Zukunft nicht verlieren, wird eine Agentin oder ein Agent aus der Runde ernannt, der die Aufgabe übernimmt, die Übersicht zu bewahren.
Das Verfahren MAP eignet sich besonders innerhalb von Klassen in Krisensituationen und um integrative Prozesse anzustoßen. Es hat aber auch klärende und orientierende Funktion für außer- und nachschulische Lebensphasen (Boban und Hinz 1998, S. 158f.).
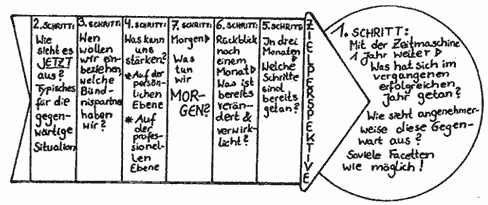
Abb. 5: Planning Alternative tomorrows with Hope (PAT) (Boban und Hinz 1998, S. 159)
Es geht auch hier darum, Zielsetzungen und/oder Veränderungsplanungen zu entwerfen und Zukunft zu planen. Mit einer imaginären Zeitmaschine lässt man sich in die Zukunft versetzen von der man dann auf ein erfolgreiches Jahr blicken darf.
Auch hier werden die anwesenden Personen bereits dadurch positiv gestimmt, da sie ja auf ein erfolgreiches Jahr blicken sollen. Jeder ist aufgefordert Ideen und Utopien zu entwickeln. Die Gruppe sammelt konkrete Ergebnisse, Nachrichten und Daten. Nach der Rückkehr ins JETZT setzt sich die Gruppe mit der Gegenwart auseinander und sammelt Begriffe und Bilder, die für die Gegenwart kennzeichnend sind. Beim dritten Schritt überlegt man, welche Personen in welcher Art und Weise involviert werden sollten, damit weitere Schritte wahr werden können. Der nächste Schritt gilt der Stärkung der eigenen Kräfte auf der persönlichen und auf der professionellen Ebene. Beim fünften Schritt geht es darum, aus der Zukunftsperspektive, wobei drei Monate bereits vergangen sind, einen Rückblick zu unternehmen. Der sechste Schritt nimmt den Zeitraum "ein vergangener Monat" in entsprechender Weise in den Blick.
Der letzte Schritt beschäftigt sich mit ersten konkreten Schritten, die am nächsten Tag in Angriff genommen werden und die den Anfang bilden, um dem gemeinsamen Ziel näher zu kommen.
Das Verfahren PATH erweist sich hilfreich für Zukunftsplanungen von SchulabgängerInnen, für die Klärung der Arbeitsschwerpunkte in Jahrgangsteams, für die Profilbildung eines Gesamtschulkollegiums usw. (Boban und Hinz 1998, S. 160).
Individuelle Entwicklungschancen zu beobachten, zu erkennen und aufzuzeigen ist eine wichtige Aufgabe der inklusiven Schule, da dadurch der Vielfalt der SchülerInnen Rechnung getragen wird. Kinder, bzw. SchülerInnen personifizieren die Gesellschaft von morgen, weshalb die Entwicklung gemeinsamer Zukunftsperspektiven und Visionen von großer Bedeutung ist. Zukunftskonferenzen können als Katalysator inklusiver Erziehung bezeichnet werden, da sich der inklusive Ansatz nicht nur auf das Klassenzimmer oder Schulgebäude beschränkt, sondern sich auf die gesamte gesellschaftliche Entwicklung ausdehnt. Es geht nicht nur darum, Lernziele für die Schule und für eine begrenzte Zeit zu formulieren, sondern es muss auch darum gehen realisierbare Teilschritte für die Zukunft der SchülerInnen zu entwerfen. Aus diesem Grund ist es notwendig, auch in Schulen zukunftsweisende Entwicklungsprozesse zu ermöglichen und diese in Form von Persönlichen Zukunftskonferenzen schrittweise zu verwirklichen. Der Blick in die Zukunft wird auch unseren Unterricht, unser tägliches Arbeiten mit SchülerInnen verändern. Es wird notwendig sein, die Unterrichtspraxis zu überdenken, zu reflektieren und gegebenenfalls zu verändern. Alle pädagogisch- didaktischen Maßnahmen sollten im Hinblick auf die Zukunft des Schülers, der Schülerin ausgerichtet sein, da die Schule den Auftrag hat, Kinder "auf das Leben" vorzubereiten. Diese Aufgabe zu erfüllen bedeutet, dass die Schule die Zukunft der SchülerInnen nicht außer Acht lassen kann! Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung der SchülerInnen sollten zukunftsweisende Perspektiven so früh wie möglich entwickelt und eingebaut werden. Gemeinsam mit Eltern, Freunden des Kindes, Verwandte, professionelle Mitarbeiter Visionen zu entwickeln, gemeinsam realistische Utopien für die Zukunft zu entwerfen bedeutet, bereits eine Vorstellung davon zu erhalten, was in der Zukunft sein soll. Bedeutet aber auch, dass wir ein kleines Stück dieser Zukunft bereits in die Gegenwart umgesetzt haben.
Gemeinsames Reflektieren hilft nicht nur Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen und aufzuzeigen, sondern ermöglicht auch, Entwicklungschancen wahrzunehmen und umzusetzen. Da bei einer Zukunftskonferenz verschiedene Vertreter von Institutionen, Freunde, Familienangehörige usw. in den Entwicklungsprozess miteingebunden werden, wird inklusive Qualität auch über die Schulmauern hinaus wirksam.
Die Inklusive Schule ist Lebens- und Lernraum, gilt als Ort der Kooperation und des Dialogs, sowie als Raum für Erziehung und Förderung für alle SchülerInnen. Die inklusive Schule ist eine Schule für alle Kinder, der inklusive Unterricht ist ein Unterricht für alle Kinder, die inklusive Lehrperson ist eine Lehrperson für alle Kinder, die inklusiven SchülerInnen sind SchülerInnen aller Lehrpersonen! Die inklusive Schule kommt ohne Kategorien, ohne Gruppen, ohne spezifische Lehrperson aus und garantiert optimale Förderungen für alle SchülerInnen.
Damit inklusive Schulen möglich gemacht werden können, bedarf es mehrerer Bausteine, die zur inklusiven Qualität beitragen. Ein Baustein davon ist die Unterrichtsorganisation, bei der jeder einzelne Schüler Teil des sozialen Kontextes ist und in seinem "Individuellen So-Sein" aufgefangen wird. Bei der gemeinsamen Planung wird ein Curriculum für alle SchülerInnen erstellt, in dem individuelle Stärken und Fähigkeiten, Interessen und Entwicklungen aller Schülerlnnen miteinbezogen werden. Gemeinsame Themen und Inhalte werden in ihrer Komplexität aufgefächert, damit Lehrpersonen allen SchülerInnen angemessene Angebote darbieten und bereitstellen können. Das erfordert die Zusammenarbeit aller Beteiligten im Team, die Bereitschaft zur Kooperation und den Mut, neue Wege zu gehen. Teamarbeit bedeutet, dass die Aufgaben der Lehrpersonen so miteinander vernetzt werden, dass sie fließend ineinander übergehen und den Unterricht nicht nur erleichtern, sondern auch bereichern. Teamarbeit ist ein Prozess, bei dem alle Beteiligten Akteure sind. Gegenseitiges Vertrauen ist nicht nur die Basis für das Gelingen der Teamarbeit, sondern auch die Basis für die Entwicklung der Kinder. Damit Lehrpersonen die Entwicklung der Kinder begleiten können, bedarf es der pädagogischen Diagnostik, die einen weiteren wichtigen Baustein der inklusiven Schule darstellt. Die pädagogische Diagnostik ermöglicht Lehrpersonen, individuelle Lebens- und Lernsituationen der SchülerInnen zu verstehen und hilft Lehrpersonen Handlungsstrategien für SchülerInnen zu eröffnen. Lehrpersonen machen sich gemeinsam auf die Suche, das Kind besser verstehen zu können und ihm wertschätzend zu begegnen. Das erfordert auch eine neue Sichtweise in Bezug auf die Bewertung von Leistungen. Eine Schule mit inklusiver Qualität heißt die Vielfalt willkommen, schätzt individuelle Entwicklungspotentiale und -fortschritte ihrer SchülerInnen und bemüht sich um eine ermutigende und prozessorientierte Bewertung. Die Schule der Zukunft ist eine Schule, die sich nicht rein als Wissensvermittlung versteht, sondern setzt sich zum Ziel, dass inklusives Denken auch in inklusives Handeln umgesetzt wird. Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung der SchülerInnen sollten auch zukunftsweisende Perspektiven nicht außer Acht gelassen werden. Es ist wichtig, gemeinsam mit SchülerInnen, Eltern, Freunden, professionellen Mitarbeitern Visionen zu entwickeln und eine Vorstellung dafür zu erhalten, was in Zukunft sein soll. Die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten, die anhand der pädagogischen Diagnostik in gemeinsamer Teamarbeit ermittelt wurden, werden bei Zukunftskonferenzen zu Entwicklungschancen, die es gilt wahrzunehmen und umzusetzen.
Sollte ich beim einen oder anderen Leser der Diplomarbeit in der Lage gewesen sein, einen Denkanstoß ausgelöst zu haben, dann bin ich meinem Ziel etwas näher gekommen. Abschließen möchte ich mit einem Gedicht von Eugen Roth:
"Schau in die Welt so vielgestaltig, sorgfältig, doch nicht sorgenfaltig!" (aus: "Der Wunderdoktor").
Wiesen, im Mai 2003
Antor, G. (1988), Zum Verhältnis von Gleichheit und Verschiedenheit in der Förderung Behinderter, in: Zeitschrift für Heilpädagogik 39/1988, S. 11-20
Awecker, P., Schratz, M. und Weiser, B. (2002), Das Schwungrad der Schul- und Unterrichtsentwicklung, Was wir brauchen, Effizientes Lernen, Journal für Schulentwicklung, 4/2002, 6. Jahrgang, S. 54-60
Biewer, G. (2001), Vom Integrationsmodell für Behinderte zur Schule für alle Kinder, Der Begriff über "Inclusive Schools", Berlin, Luchterhand
Bintinger, G., Wilhelm, M. und Eichelberger, H. (2002), Eine Schule für dich und mich!, Innsbruck, Studien Verlag
Boban, I. (1998), "Voll peacy!?!" - Sicht der SchülerInnen, in: Hildeschmidt, A. und Schnell, I. (1998) Integrationspädagogik, Auf dem Weg zu einer Schule für alle, Weinheim/München, S. 193-206
Boban, I. (2000), It's not Inclusion.... - Der Traum von einer Schule für alle Kinder, in: Maren, H. und Ginnold A. (Hrsg.) (2000), Integration von Menschen mit Behinderung - Entwicklungen in Europa, Berlin, Luchterhand, S. 238-247
Boban, I. und Hinz, A. (1996), Kinder verstehen - mit Kindern gemeinsam Schritte entwickeln, Annäherungen an die Lebens- und Lernsituation von Kindern mit Hilfe eines diagnostischen Mosaiks, Hamburg, unveröffentlichtes Skript
Boban, I. und Hinz, A. (1998), Diagnostik für Integrative Pädagogik, in: Eberwein, H. und Knauer, S. (Hrsg.), Handbuch Lernprozesse verstehen, Weinheim und Basel, Beltz, S. 151-164
Boban, I. und Hinz, A. (1999), Persönliche Zukunftskonferenzen, Unterstützung für individuelle Lebenswege, in: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 22 (1999) H. 4/5, S. 13-23
Boban, I. und Hinz, A. (2000), in: Sander, A. (2003), Über Integration zur Inklusion, Entwicklungen der schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Sonderpädagogischen Förderbedarf auf ökosystemischer Grundlage am Beispiel des Saarlandes, Saarbrücker Beiträge zur Integrationspädagogik, Band 12, St. Ingbert, Röhrig Universitätsverlag, S. 129
Böhnel, E. (2000), Individualisierender Unterricht in heterogenen Lerngruppen - ein immer wieder "neues" Thema?, Erziehung & Unterricht, 150, 1-2/2000, S. 51-57
Brabeck, H. (1988), Integration Behinderter in die allgemeine Schule als flächendeckendes Konzept, in: Meißner, K. und Heß, E. (Hrsg.), Integration in der pädagogischen Praxis, Berlin, Diesterweg-Hochschule, S. 97-102
Brugger, H. (2001), Rechte und Pflichten der Lehrperson, Bozen, Athesia
Demmer-Dieckmann, I. und Struck, B. (2001), Gemeinsamkeiten und Vielfalt, Pädagogik und Didaktik einer Schule ohne Aussonderung, Weilheim/München, Juventa)
Donner, R. (1989), Mut zur Überwindung, in: Erziehung und Unterricht, 5/89, S. 294-300
Doose, S. (1997), Persönliche Zukunftsplanung im Übergang von der Schule in das Erwachsenenleben, in: Wilken, E. (1997), Neue Perspektiven für Menschen mit Down-Syndrom, Erlangen, S. 198-215
Eberwein, H. (1997), Handbuch Integrationspädagogik, Kinder mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam, Weinheim/Basel, Beltz
Eggert, D. (1997), Von den Stärken ausgehen..., Individuelle Entwicklungspläne (IEP) in der Lernförderungsdiagnostik, Dortmund, Borgmann Publishing
Feuser, G. (1995), Behinderte Kinder und Jugendliche, Zwischen Integration und Aussonderung, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Fischer, D. (2002), Kunst und geistige Behinderung, Versuch einer Annäherung, Gleichstellung jetzt!, Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 6, S. 39-50
Forest, M., Pearpoint, J., Maiuri, F., Snow, J., Galati, R., Galati, D., und Bailey, L. (2000), It's not Inclusion, Warning Signs of bad Practice in Education, in: H. Maren und A. Ginnold, Integration von Menschen mit Behinderung - Entwicklungen in Europa, Berlin, Luchterhand, S. 238-246
Forum Schule heute (2001), Pädagogische Zeitschrift für Grund-, Mittel- und Oberschule in Südtirol, 15, 5, S. 22
Gerard, I. (2000), Schule im Wandel, Neuwied, Luchterhand
Gross, B. (1996), Vom Rückmelden und Bewerten, Das Gute achten, Prüfen und Beurteilen, Friedrich Jahresheft XIV, S. 18-19
Haeberlin, U., Fuchs, E. J. und Moser Opitz, E. (1992), Zusammenarbeit, Wie Lehrpersonen Kooperation zwischen Regel- und Sonderpädagogik in integrativen Kindergärten und Schulklassen erfahren, Bern/Stuttgart, Haupt
Haeberlin, U. (1989), Integration als pädagogische Vision und bürokratische Wirklichkeit - Gedanken zum integrationspädagogischen Perspektivenwechsel von der Integrationsfähigkeit des Kindes zur Integrationsfähigkeit der Schule, Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete VHN 59, S. 266-275
Hausotter, A. (2000), Integration und Inclusion - Europa macht sich auf den Weg, in: Maren, H. und Ginnold, A. (Hrsg.) (2000), Integration von Menschen mit Behinderung - Entwicklungen in Europa, Berlin, Luchterhand, S. 43-83
Hausotter, A. und Oertel, B. (2000), Integration in der Schule - Ein Weg in Richtung Chancengleichheit im Blickpunkt der Europäischen Union, in: Maren, H. und Ginnold, A. (Hrsg.) (2000), Integration von Menschen mit Behinderung - Entwicklungen in Europa, Berlin, Luchterhand, S. 25-42
Hinz, A. (1995), Kinder mit geistiger Behinderung in Integrationsklassen, Lernen konkret, 14, S. 20-21
Hinz, A. (2000), Vom halbvollen und halbleeren Glas der Integration - Gemeinsame Erziehung in der Bundesrepublik Deutschland, in: Maren, H. und Ginnold, A. (Hrsg.) (2000), Integration von Menschen mit Behinderung - Entwicklungen in Europa, Berlin, Luchterhand, S. 230-237
Hinz, A. (2002), Von der Integration zu Inklusion - terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung?, Zeitschrift für Heilpädagogik 53, S. 354-361
Hobmair, H., Altenthan S., Dirrigl, W., Gotthardt, W., Höhlein, R., Ott, W., Pöll, R. und Schneider, K.-H. (1996), Pädagogik, Köln, Stam
Jaumann, O. und Riedinger, W. (1996), Unterrichtspraxis: Grundschule, Integrativer Unterricht in der Grundschule, Frankfurt am Main, Moritz Diesterweg GmbH
Klee, E. (1981), Behinderten-Report I und II, in: H. Hobmair, S. Altenthan, W. Dirrigl, W. Gotthardt, R. Höhlein, W. Ott, R. Pöll und K.-H. Schneider (1996), Pädagogik, Köln, Stam
Klee, E. (1987), Behindert, Über die Enteignung von Körper und Bewusstsein, Frankfurt a.M., Fischer
Lamnek, S., (1993), Qualitative Sozialforschung Band II, Methoden und Techniken, Weinheim, Beltz
Landesgesetze: http://www.provinz.bz.it/ressorts/generaldirektion/lexbrowser_d.asp
Leinhofer, G. (1992), Verhalten als Botschaft, Auffälliges Verhalten von Kindern als Problem und Appell, Donauwörth, Auer
Lipsky, D. K. und Gartner, A. (1999), Inclusive education: a requirement of a democratic society, in: Daniels, H. und Garner P. (1999), Inclusive education, World yearbook of education 1999, London, Kogan Page Limited, S. 12-23
Mittler, P. (2000), Working towards Inclusive Education, Social Contexts, in: Hinz, A. (2000), Von der Integration zu Inklusion - terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung?, Reader zum fünften Integrationstag Sachsen-Anhalt, Halle, S. 38
Myscher, N. und Ortmann, M. (1999), Integrative Schulpädagogik, Grundlagen, Theorie und Praxis, Stuttgart, Kohlhammer
Nuding, A. (1999), Schüler beurteilen durch Beobachtung, Entwicklung eines Beobachtungsbogens zur Gewinnung schulrelevanter diagnostischer Informationen, Frankfurt, Peter Lang
O`Brien, J. und Forest, M. (1989), Action for Inclusion, How to Improve Schools by Welcoming Children with Wpecial Needs Into Regular Classrooms, Toronto
O'Brien, J. und O'Brien, C. L. (1997), Inclusion as a Force for School Renewal, zit. in: Hinz, A. (2002), Von der Integration zu Inklusion - terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung?, Reader zum fünften Integrationstag Sachsen-Anhalt, Halle
Oerter, R. und Montada, L. (1998), Entwicklungspsychologie, Weinheim, Psychologie Verlags Union
Otto, G. (1998), Den Arbeitsalltag planen und organisieren, Unterricht vorbereiten und Planen, Arbeitsplatz Schule, Friedrich Jahresheft 16, S. 61-62
Paggi, E. (1996), Integration von Schülern und Schülerinnen mit Behinderung in der Sekundarschule 1. Grades in Südtirol und Italien, Erziehung und Unterricht, 10/96, S. 816
Paggi, E. (2000a), Pädagogische Beilage, Integration: Gedanken zum Schulanfang, S. 16-20
Paggi, E. (2000b), Integration von Menschen mit Behinderung in Italien, in: Maren, H. und Ginnold A. (2000), Integration von Menschen mit Behinderung- Entwicklungen in Europa, Berlin, Luchterhand, S. 146-171
Paggi, E. (2001), Schulgesetzgebung, Historischer Rückblick, unveröffentlichtes Skriptum, S. 1-5
Paggi, E. (2002), Planung im gemeinsamen Unterricht, Info, Pädagogische Beilage, Nov.; S. 17-18
Paggi, E. (o.J.), Grundlagen der Bewertung, Lehrerfortbildung, S. 1-2, unveröffentlichtes Skript
Paggi, E. (o.J.), Die Integration von Kindern/Schülern mit Behinderung, Grundsätze und Verfahrensweisen, S. 1-3, unveröffentlichtes Skript
Parmentier, U. (1999), Die Salamanca Erklärung, in: Irmann, E. und Laper, H. (Hrsg.) (1999), Integration: Unterwegs zu einer gemeinsamen Schule, Ein Wegweiser für Eltern von Kindern mit speziellem Förderbedarf und andere Fachleute, Bern/Stuttgart/Wien, Haupt, S. 123-127
Pedrazzoli, G., http://www.lehrerforum.at/pedrazzoli/imagepages
Prinz von Hohenzollern, J.G. und Liedtke, M. (1991), Schülerbeurteilungen und Schulzeugnisse, Bad Heilbrunn, Klinkhardt
Reutterer, A. (1996), Erleben und Verhalten, Einführung in die Humanpsychologie, Wien, ÖBV Pädagogischer Verlag
Rittmeyer, C. (1999), Gemeinsamer Unterricht in Italien am Beispiel von geistig behinderten Kindern, Heidelberg, C. Winter
Roebke, C., Hüwe, B. und Rosenberger, M. (2000), Leben ohne Aussonderung, Eltern kämpfen für Kinder mit Beeinträchtigungen, Berlin, Luchterhand
Sander, A. (2003), Über Integration zur Inklusion, Entwicklungen der schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Sonderpädagogischen Förderbedarf auf ökosystemischer Grundlage am Beispiel des Saarlandes, Saarbrücker Beiträge zur Integrationspädagogik, Band 12, St. Ingbert, Röhrig Universitätsverlag, S. 129
Sander, A. und Christ, K. (1993), Qualifizierung für Integration, Integrativer Unterricht - Anforderungen an die Lehreraus- und -weiterbildung, St. Ingbert, J. Röhrig
Schor, B. und Eberhardt, H. (1994), Schulische Kooperation - ein wirkungsvoller Weg zur Integration, Donauwörth, Auer
Schley, W. (1998), Teamkooperation und Teamentwicklung in der Schule. in: H. Altrichter, W. Schley, und M. Schratz, (1998), Handbuch zur Schulentwicklung, Innsbruck/Wien, S. 116-117
Schley, W., Boban, I. und Hinz, A. (1989), Integrationsklassen in Hamburger Gesamtschulen, Hamburg, Curio
Schöler, J. (1987), Italienische Verhältnisse, Insbesondere in den Schulen von Florenz, Berlin, Guhl
Schöler, J. (1993), Integrative Schule-Integrativer Unterricht, Hamburg, Rowohlt
Schöler, J. (1995), Neue Bilder in die Köpfe bringen!, Zusammen 15, S. 6-11
Schöler, J. (1996), Italienische Verhältnisse Teil II, Menschen mit Behinderung auf dem Weg von der Schule in die Arbeitswelt, Berlin, Klaus Guhl
Schwark, W., Weiß, W. und Regelein S. (1991), Beurteilen und Benoten in der Grundschule, Bestandsaufnahme und Anregungen für die Praxis, München, Ehrenwirth
Seidl, G. und Graf-Götz, F. (2002), Zukunftskonferenzen an Schulen, Und dann laden wir alle ein, Erziehung und Unterricht, Mai/Juni, S. 748-757
Springer, K. (1990), Ich seh dich, Lesebuch für einen individuellen entwicklungsfördernden und heilsamen Unterricht, Linz, Veritas
Struck, B. und Lage, G. (2001), Gemeinsamkeit und Vielfalt, Zur Kooperation der Lehrerinnen und Lehrer im Gemeinsamen Unterricht, Weinheim und München, Juventa
Tetler, S. und Kreuzer, M. (2000), Integration von Menschen mit Behinderung - Entwicklungen in Europa, Gemeinsamer Unterricht in Dänemark, Berlin, Luchterhand
Tischler, P. (1998), Dolomiten, 19.02.1998, S. 11
Utz, K. (1996), Du gehörst zu uns!, Die Integration von Kindern mit auffälligem Verhalten, Freiburg im Breisgau, Herder
Valtin, R. (2002), Was ist ein gutes Zeugnis?, Noten und verbale Beurteilungen auf dem Prüfstand, Weinheim, Juventa
Vellas, E. (2002), Effizientes Lernen, Lernhindernisse als neue Basis künftiger Arbeitsorganisation, Journal für Schulentwicklung 4/2002, S. 24-35
Walthes, R. (2003), Einführung in die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, UTB, München
Wiater, W. (2001), Unterrichtsprinzipien, Donauwörth, Auer
Wilhelm, M., Bintinger, G. und Eichelberger, H. (2002), Eine Schule für dich und mich!, Innsbruck, Studien Verlag
Wocken, H. (1987), Integrationsklassen in Hamburg, Erfahrungen - Untersuchungen - Anregungen, Solms-Oberbiel, Jarick
Wocken, H., Antor, G. und Hinz, A. (1988), Integrationsklassen in Hamburger Grundschulen, Hamburg, Curio
Ziegenspeck, J. (1999), Handbuch Zensuren und Zeugnis in der Schule, Bad Heilbrunn, Klinkhardt
Zimbardo, P. (1995), Psychologie, Heidelberg, Springer
Verfasser unbekannt, (2003), Raiffeisenkalender, Freitag, 03. Januar 2003
Quelle:
Susanne Abram: Die internationale Theoriendiskussion von der Integration zur Inklusion und die Praxisentwicklung in Südtirol
Laureatsarbeit in Bildungswissenschaften, Freie Universität Bozen. Betreuer: Prof. Dr. Hinz Andreas und Prof. Boban Ines. Akademisches Jahr: 2002-2003
bidok - Volltextbibliothek. Wiederveröffentlichung im Internet
Stand: 20.03.2006
